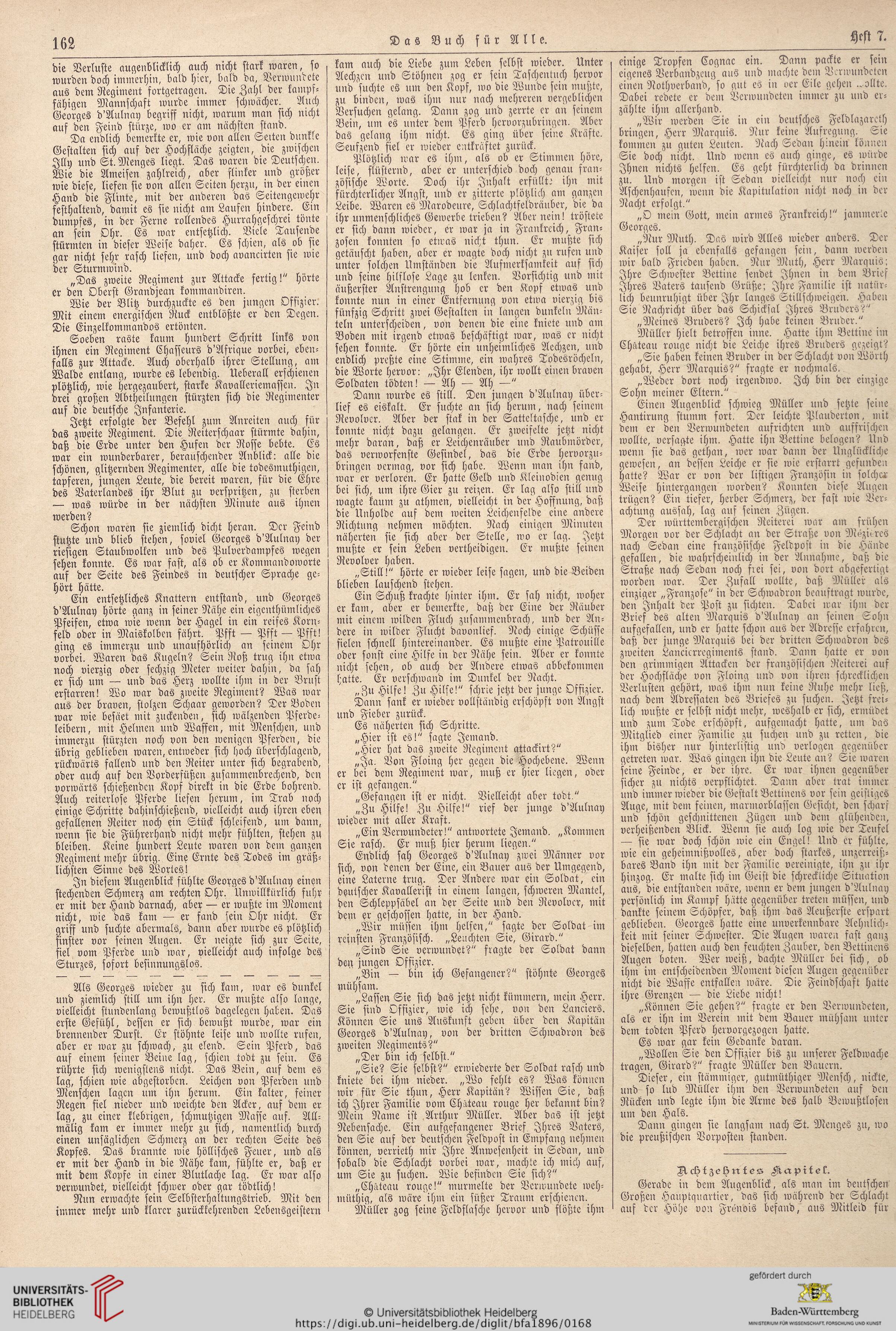162
Das Buch für Alle.
Heft 7.
die Verluſte augenblicklich auch nicht ſtark waren, ſo
wuͤrden doch immerhin, bald hier, bald da, Verwundete
aus dem Regiment fortgetragen. Die Zahl der kampf-
faͤhigen Maͤnnſchaft wurde immer ſchwächer, Auch
Georges d'Aulnay begriff nicht, waxun man ſich nicht
auf den Feind ſtuͤrze, wo er am nächſten ſtand.
Da euͤdlich bemerkte er, wie von allen Seiten dunkle
Geſtaͤlten fich auf der Hochfläche zeigten, die zwiſchen
Illh und St. Menges liegt Das waren die Deutſchen.
Wie die Ameifen zaͤhlreich, aber flinker und größer
wie dieſe, liefen ſie von allen Seiten herzu, in der einen
Hand die Flinte, mit der anderen das Seitengewehr
feſthaltend, damit es ſie nicht am Laufen hindere. Ein
dumipfes, in der Ferne rollendes Hurrahgeſchrei tönte
an fein Shr! Es war entſetzlich. Viele Tauſende
ſtürniten in dieſer Weiſe daher. Es ſchien, als ob ſie
gar nicht fehr raſch liefen, und doch avancirten ſie wie
der Sturmwind.
„Das zweite Regiment zur Attacke fertig!“ hörte
er den Oberſt Grandjean kommandiren.
Wie der Blitz duͤrchzuckte es den jungen Offizier.
Mit einem energiſchen Ruck entblößte er den Degen.
Die Einzelkommaͤndos ertönten.
Soeben raste kaum hundert Schritt links von
ihnen ein Regiment Chaſſeurs d Afrique vorbei, eben-
faͤlls zur Attacke. Auch oberhalb ihrer Stellung, am
Walde entlang, wurde es lebendig Ueberall erſchienen
plötzlich, wie hergezaubert, ſtarke Kavalleriemaſſen. In
drei großen Abtheilungen ſtürzten ſich die Regimenter
auf die deutſche Infanterie.
Jetzt erfolgte der Befehl zum Anreiten auch für
das zweite Regiment. Die Reiterſchaar ſtürmte dahin,
daß die Erde unter den Hufen der Roſſe bebte. Es
war ein wunderbarer, berauſchender Anblick: alle die
ſchönen, glitzernden Regimenter, alle die todesmuthigen,
tapferen, jungen Leute, die bereit waren, für die Ehre
des Vaterlandes ihr Blut zu verſpritzen, zu ſterben
— was würde in der nächſten Minute aus ihnen
werden?
Schon waren ſie ziemlich dicht heran. Der Feind
ſtutzte und blieb ſtehen, ſoviel Georges d'Aulnay der
rieſigen Staubwolken und des Pulverdampfes wegen
ſehen konnte. Es war faſt, als ob er Kommandoworte
auf der Seite des Feindes in deutſcher Sprache ge-
hört hätte.
Ein entſetzliches Knattern entſtand, und Georges
d'Aulnay hörte ganz in ſeiner Nähe ein eigenthümliches
Pfeifen, etwa wie wenn der Hagel in ein reifes Korn-
feld oder in Maiskolben fährt. Pfft — Pfft — Pfft!
ging es immerzu und unaufhörlich an ſeinem Ohr
vorbei. Waren das Kugeln? Sein Roß trug ihn etwa
noch vierzig oder ſechzig Meter weiter dahin, da ſah
er fich um und das Herz wollte ihm in der Bruſt
erſtarren! Wo mar das zweite Regiment? Was war
aus der braven, ſtolzen Schaar geworden? Der Boden
war wie beſäet mit zuckenden, ſich wälzenden Pferde-
leibern, mit Helmen und Waffen, mit Menſchen, und
immerzu ſtürzten noch von den wenigen Pferden, die
übrig geblieben waren, entweder ſich hoch übexrſchlagend,
rückwaͤrts fallend und den Reiter unter ſich begrabend,
oder auch auf den Vorderfüßen zuſammenbrechend, den
vorwärts ſchießenden Kopf direkt in die Erde bohrend.
Auch reiterloſe Pferde liefen hexum, im Irab noch
einige Schritte dahinſchießend, vielleicht auch ihren eben
gefallenen Reiter noch ein Stück ſchleifend, um dann,
wenn ſie die Führerhand nicht mehr fühlten, ſtehen zu
bleiben. Keine hundert Leute waren von dem ganzen
Regiment mehr übrig. Eine Ernte des Todes im gräß-
lichſten Sinne des Wortes!
In dieſem Augenblick fühlte Georges d'Aulnay einen
ſtechenden Schmerz am rechten Ohr. Unwillkürlich fuhr
er mit der Hand darnach, aber — er wußte im Moment
nicht, wie das kam — er fand ſein Ohr nicht. Er
griff und ſuchte abermals, dann aber wurde es plötzlich
finſter vor ſeinen Augen. Er neigte ſich zur Seite,
fiel vom Pferde und war, vielleicht auch infolge des
Sturzes, ſofort beſinnungslos.
Als Georges wieder zu ſich kam, war es dunkel
und ziemlich ſtill um ihn her. Er mußte alſo lange,
vielleicht ſtundenlang beivußtlos dagelegen haben. Das
erſte Gefühl, deſſen er ſich bewußt wurde, war ein
brennender Durſt. Er ſtöhnte leiſe und wollte rufen,
aber er war zu ſchwach, zu elend. Sein Pferd, das
auf einem ſeiner Beine lag, ſchien todt zu ſein. Es
rührte ſich wenigſtens nicht. . Das Bein, auf dem es
lag, ſchien wie abgeſtorben. Leichen von Pferden und
Menſchen lagen um ihn herum. Ein kalter, feiner
Regen fiel nieder und weichte den Acker, auf dem er
lag, zu einer klebrigen, ſchmutzigen Maſſe auf. All-
maͤlig kam er immer mehr zu ſich, namentlich durch
einen unſäglichen Schmerz an der rechten Seite des
Kopfes. Das brannte wie hölliſches Feuer, und als
er mit der Hand in die Nähe kam, fühlte er, daß er
mit dem Koßfe in einer Blutlache lag. Er war alſo
verwundet, vielleicht ſchwer oder gar tödtlich!
Nun erwachte ſein Selbſterhaltungstrieb. Mit den
immer mehr und klarer zurückkehrenden Lebensgeiſtern
kam auch die Liebe zum Leben ſelbſt wieder. Unter
Aechzen und Stöhnen zog er ſein Taſchentuch herpor
und ſuchte es um den Koßf, wo die Wunde ſein mußte,
zu binden, was ihm nur nach mehrexen vergehlichen
Verſuchen gelang. Dann zog und zerrte er an feinem
Bein, um e8 unter dem Pferd hervorzubringen. Aber
das gelang ihm nicht. Es ging über ſeine Kräfte.
Seufzend fiel er wieder entkräftet zurück.
Plötzlich war es ihm, als ob er Stimmen höre,
leiſe, flüſternd, aber er unterſchied doch genau fran-
zöſiſche Worte. Doch ihr Inhalt erfülltz ihn mit
fürchterlicher Angſt, und er zitterte plötzlich am ganzen
Leibe. Waren es Marodeure, Schlachtfeldräuber, die Da
ihr unmenſchliches Gewerbe trieben? Aber nein! tröſtete
er ſich dann wieder, er war ja in Frankreich, Fran-
zoſen konnten ſo etwas nicht thun. Er mußte ſich
getäuſcht haben, aber er wagle doch nicht zu rufen und
unter folchen Umſtänden dié Aufmerkſamkeit auf ſich
und ſeine hilfloſe Lage zu lenken. Vorſichtig und mit
äußerſter Anſtrengung hob er den Kopf etwas und
konnte nun in einer Entfernung von etwa vierzig bis
fünfzig Schritt zwei Geſtalten in langen dunkeln Män-
teln uͤnterſcheiden, von denen die eine kniete und am
Boden mit irgend etwas beſchäftigt war, was er nicht
ſehen konnte. Er hörte ein uͤnheimliches Aechzen, und
endlich preßte eine Stimme, ein wahres Todesröcheln,
die Worte hervor: „Ihr Elenden, ihr wollt einen braven
Soldaten tödten! — Ah — Ah —“
Dann wurde es ſtill. Den jungen d'Aulnay über-
lief es eiskalt. Er ſuchte an ſich herum, nach ſeinem
Revolver. Aber der ſtak in der Satteltaſche, und er
konnte nicht dazu gelangen. Er zweifelte jetzt nicht
mehr daran, daͤß er Leichenräuber und Raubmörder,
das verworfenſte Geſindel, das die Erde hervorzu-
bringen vermag, vor ſich habe. Wenn man ihn fand,
war er verloren. Er hatte Geld und Kleinodien genug
bei ſich, um ihre Gier zu reizen. Er lag alſo ſtill und
wagte kaum zu athmen! vielleicht in der Hoffnung, daß
die Unholde auf dem weiten Leichenfelde eine andere
Richtung nehmen möchten. Nach einigen Minuten
näherten ſie ſich aber der Stelle, mo er lag. Jetzt
mußte er ſein Leben vertheidigen. Er mußte ſeinen
Revolver haben.
„Still!“ hörte er wieder leiſe ſagen, und die Beiden
blieben lauſchend ſtehen.
Ein Schuß krachte hinter ihm. Er ſah nicht, woher
er kam, aber er bemerkte, daß der Eine der Räuber
mit einem wilden Fluch zuſammenbrach, und der An-
dere in wilder Fluͤcht davonlief. Noch einige Schüſſe
fielen ſchnell hinkereinander. Es mußte eine Patrouille
oder ſonſt eine Hilfe in der Nähe ſein. Aber er konnte
nicht ſehen, ob auch der Andere etwas abbekommen
hatte. Er verſchwand im Dunkel der Nacht.
„Zu Hilfe! Zu Hilfe!“ ſchrie jetzt der junge Offizier.
Dann ſank er wieder vollſtändig erſchöpft von Angſt
Es näherten ſich Schritte.
„Hier iſt es!“ ſagte Jemand.
Hier hat das zweite Regiment attackirt?“
Ja. Von Floing her gegen die Hochebene. Wenn
er bei dem Regiment war, muß er hier liegen, oder
er iſt gefangen.“
„Gefangen iſt er nicht. Vielleicht aber todt.“
Zu Hilfe! Zu Hilfe!“ rief der junge d'Aulnay
wieder mit aller Kraft.
„Ein Verwundeter!“ antwortete Jemand. „Kommen
Sie raſch. Er muß hier herum liegen.“
Endlich ſah Georges d'Aulnay zwei Männer vor
ſich, von denen der Eine, ein Bauer aus der Umgegend,
eine Laterne trug. Der Andere war ein Soldat, ein
deutſcher Kavalleriſt in einem langen, ſchweren Mantel,
den Schleppſäbel an der Seite und den Revolver, mit
dem er geſchoſſen hatte, in der Hand.
„Wir müſſen ihm helfen,“ ſagte der Soldat im
reinſten Franzöſiſch. „Leuchten Sie, Girard.“
„Sind Sie verwundet?“ fragte der Soldat dann
den jungen Offizier. 2
„Bin — bin ich Gefangener?“ ſtöhnte Georges
mühſam.
„Laſſen Sie ſich das jetzt nicht kümmern, mein Herr.
Sie ſind Offizier, wie ich ſehe, von den Lanciers.
Können Sie uns Auskunft geben über den Kapitän
Georges d'Aulnay, von der dritten Schwadron des
zweitẽn Regiments?!
„Der bin ich ſelbſt.“
„Sie? Sie ſelbſt?“ erwiederte der Soldat raſch und
kniele bei ihm nieder. „Wo fehlt es? Was können
wir für Sié thun, Herr Kapitän? Wiſſen Sie, daß
ich Ihrer Familie vom Chateau rouge her bekannt bin?
Mein Name iſt Arthur Müller. Aber das iſt jetzt
Nebenſache. Ein aufgefangener Brief Ihres Vaters,
den Sie auf der deutſchen Feldpoſt in Empfang nehmen
können, verrieth mir Ihre Anweſenheit in Sedan, und
ſobald die Schlacht vorbei war, machte ich mich auf,
um Sie zu ſuchen. Wie befinden Sie ſich?“
„Chateau rouge!“ murmelte der Verwundete weh-
müthig, als wäre ihm ein ſüßer Traum erſchienen.
Müller zog ſeine Feldflaſche hervor und flößte ihm
einige Tropfen Cognac ein. Dann padte er ſein
eigenes Verbandzeug aus und machte dem Vexwundeten
einen Nothverband, ſo gut es in ver Eile gehen . ollte,
Dabei redete er dem Verwundeten immer zu und er-
zählte ihm allerhand.
„Wir werden Sie in ein deutſches Feldlazareth
brinzen, Herr Marquis. Nur keine Aufregung. Sie
fommen zu guten Leuten. Nach Sedan hinein können
Sie doch nicht. Und wenn es auch ginge, es würde
Ihnen nichts helfen. Es geht fürchterlich da drinnen
zu. Und morgen iſt Sedan vielleicht nur noch ein
Aſchenhaufen, ibenn die Kapitulation nicht noch in der
Nacht erfolgt.“
„O mein Gott, mein armes Frankreich!“ jammerle
Georges.
„Nur Muth. Das wird Alles wieder anders. Der
Kaiſer ſoll ja ebenfalls gefangen ſein, dann werden
wir bald Frieden haben. Nur Muth, Herr Marquis;
Ihre Schweſter Bettine ſendet Ihnen in dem Brief
Ihres Vaͤters tauſend Grüße; Ihre Familie iſt natür-
lich beunruhigt über Ihr langes Stillſchweigen. Haben
Sie Nachricht über das Schickſal Ihres Bruders?“
„Meines Bruders? Ich habe keinen Bruder.“
Müller hielt betroffen inne. Hatte ihm Bettine im
Chateau rouge nicht die Leiche ihres Bruͤders gezeigt?
„Sie haben keinen Bruder in der Schlacht von Wörth
gehabt, Herr Marquis?“ fragte er nochmals.
„Weder dort noch irgendwo. Ich bin der einzige
Sohn meiner Eltern.“
Einen Augenblick ſchwieg Müller und ſetzte ſeine
Hantirung ſtumm fort. Der leichte Plauderton mit -
dem er den Verwundeten aufrichten und auffriſchen
wollte, verſagte ihm. Hatte ihn Bettine belagen? Und
wenn ſie das gethan, wer war dann der Unglückliche
geweſen, an deſſen Leiche er ſie wie erſtarrt gefunden
hatte? War er von der liſtigen Franzöſin in ſolcher
Weiſe hintergangen worden? Konnten dieſe Augen
trügen? Ein tiefer, herber Schmerz, der faſt wie Ver-
achtung ausſah, lag auf ſeinen Zügen.
Der württembergiſchen Reiterei war am frühen
Morgen vor der Schlacht an der Straße von Mezicres
nach Sedan eine franzöſiſche Feldpoſt In die Hände
gefallen, die wahrſcheinlich in der Annahme, daß die
Straße nach Sedan noch frei ſei, von dort abgefertigt
worden war. Der Zufall wollte, daß Muller als
einziger „Franzoſe“ in der Schwadron beauftragt wurde,
den Inhalt der Poſt zu ſichten. Dabei war ihm der
Brief des alten Marquis d'Aulnay an ſeinen Sohn
aufgefallen, und er hatte ſchon aus der Adreſſe erfahren,
daß der junge Marquis bei der dritten Schwadron des
zweiten Lancierregiments ſtand. Dann hatte er von
den grimmigen Attacken der franzöſiſchen Reiterei auf
der Hochfläche von Floing und von ihren ſchrecklichen
Verluſten gehört, was ihm nun keine Ruhe mehr ließ,
nach dem Adreſſaten des Briefes zu ſuchen. Jetzt frei-
lich wußte er ſelbſt nicht mehr, weshalb er ſich, ermüdet.
und zum Tode erſchöpft, aufgemacht hatte, um das
Mitglied einer Familie zu ſuchen und zu retten, die
ihm bisher nur hinterliſtig und verlogen gegenüber
getreten war. Was gingen ihn die Leute an? Sie waren
ſeine Feinde, er der ihre. Ex war ihnen gegenüber
ſicher zu nichts verpflichtet. Dann aber trat immer
und immer wieder die Geſtalt Bettinens vor ſein geiſtiges
Auge, mit dem feinen, marmorblaſſen Geſicht, den ſcharf
und ſchön geſchnittenen Zügen und dem glühenden,
verheißenden Blick. Wenn ſie auch log wie der Teufel
— ſie war doch ſchön wie ein Engel! Und er fühlte,
wie ein geheimnißvolles, aber doch ſtarkes, unzerreiß-
bares Band ihn mit der Familie vereinigte, ihn zu ihr
hinzog. Er malte ſich im Geiſt die ſchreckliche Situation
aus, die entſtanden wäre, wenn er dem jungen d Aulnay
perſönlich im Kampf hätte gegenüber treten müſſen, und
geblieben. Georges hatte eine unverkennbare Aehnlich-
keit mit ſeiner Schweſter. Die Augen waren faſt ganz
dieſelben, hatten auch den feuchten Zaubex, den Bettinens
Augen boten. Wer weiß, dachte Müller bei ſich, ob
ihm im entſcheidenden Moment dieſen Augen gegenüber
nicht die Waffe entfallen wäre. Die Feindſchaft hatte
ihre Grenzen — die Liebe nicht!
„Können Sie gehen?“ fragte er den Vexwundeten,
als er ihn im Verein mit dem Bauer mühſam unter
dem todten Pferd hervorgezogen hatte.
Es war gar kein Gedanke daran.
„Wollen Sie den Offizier bis zu unſerer Feldwache
tragen, Girard? fragte Müller den Bauern.
Dieſer, ein ſtämmiger, gutmüthiger Menſch, nickte,
und ſo lud Müller ihm den Verwundeten auf den
Rücken und legte ihm die Arme des halb Bewußtloſen
um den Hals.
Dann gingen ſie langſam nach St. Menges zu, wo
die preußiſchen Vorpoſten ſtanden.
Achtze hutes Kapiftel.
Gerade in dem Augenblick, als man im deutſchen
Großen Hauptquartier, das ſich während der Schlacht
auf der Höhe von Fréndis befand, aus Mitleid für
Das Buch für Alle.
Heft 7.
die Verluſte augenblicklich auch nicht ſtark waren, ſo
wuͤrden doch immerhin, bald hier, bald da, Verwundete
aus dem Regiment fortgetragen. Die Zahl der kampf-
faͤhigen Maͤnnſchaft wurde immer ſchwächer, Auch
Georges d'Aulnay begriff nicht, waxun man ſich nicht
auf den Feind ſtuͤrze, wo er am nächſten ſtand.
Da euͤdlich bemerkte er, wie von allen Seiten dunkle
Geſtaͤlten fich auf der Hochfläche zeigten, die zwiſchen
Illh und St. Menges liegt Das waren die Deutſchen.
Wie die Ameifen zaͤhlreich, aber flinker und größer
wie dieſe, liefen ſie von allen Seiten herzu, in der einen
Hand die Flinte, mit der anderen das Seitengewehr
feſthaltend, damit es ſie nicht am Laufen hindere. Ein
dumipfes, in der Ferne rollendes Hurrahgeſchrei tönte
an fein Shr! Es war entſetzlich. Viele Tauſende
ſtürniten in dieſer Weiſe daher. Es ſchien, als ob ſie
gar nicht fehr raſch liefen, und doch avancirten ſie wie
der Sturmwind.
„Das zweite Regiment zur Attacke fertig!“ hörte
er den Oberſt Grandjean kommandiren.
Wie der Blitz duͤrchzuckte es den jungen Offizier.
Mit einem energiſchen Ruck entblößte er den Degen.
Die Einzelkommaͤndos ertönten.
Soeben raste kaum hundert Schritt links von
ihnen ein Regiment Chaſſeurs d Afrique vorbei, eben-
faͤlls zur Attacke. Auch oberhalb ihrer Stellung, am
Walde entlang, wurde es lebendig Ueberall erſchienen
plötzlich, wie hergezaubert, ſtarke Kavalleriemaſſen. In
drei großen Abtheilungen ſtürzten ſich die Regimenter
auf die deutſche Infanterie.
Jetzt erfolgte der Befehl zum Anreiten auch für
das zweite Regiment. Die Reiterſchaar ſtürmte dahin,
daß die Erde unter den Hufen der Roſſe bebte. Es
war ein wunderbarer, berauſchender Anblick: alle die
ſchönen, glitzernden Regimenter, alle die todesmuthigen,
tapferen, jungen Leute, die bereit waren, für die Ehre
des Vaterlandes ihr Blut zu verſpritzen, zu ſterben
— was würde in der nächſten Minute aus ihnen
werden?
Schon waren ſie ziemlich dicht heran. Der Feind
ſtutzte und blieb ſtehen, ſoviel Georges d'Aulnay der
rieſigen Staubwolken und des Pulverdampfes wegen
ſehen konnte. Es war faſt, als ob er Kommandoworte
auf der Seite des Feindes in deutſcher Sprache ge-
hört hätte.
Ein entſetzliches Knattern entſtand, und Georges
d'Aulnay hörte ganz in ſeiner Nähe ein eigenthümliches
Pfeifen, etwa wie wenn der Hagel in ein reifes Korn-
feld oder in Maiskolben fährt. Pfft — Pfft — Pfft!
ging es immerzu und unaufhörlich an ſeinem Ohr
vorbei. Waren das Kugeln? Sein Roß trug ihn etwa
noch vierzig oder ſechzig Meter weiter dahin, da ſah
er fich um und das Herz wollte ihm in der Bruſt
erſtarren! Wo mar das zweite Regiment? Was war
aus der braven, ſtolzen Schaar geworden? Der Boden
war wie beſäet mit zuckenden, ſich wälzenden Pferde-
leibern, mit Helmen und Waffen, mit Menſchen, und
immerzu ſtürzten noch von den wenigen Pferden, die
übrig geblieben waren, entweder ſich hoch übexrſchlagend,
rückwaͤrts fallend und den Reiter unter ſich begrabend,
oder auch auf den Vorderfüßen zuſammenbrechend, den
vorwärts ſchießenden Kopf direkt in die Erde bohrend.
Auch reiterloſe Pferde liefen hexum, im Irab noch
einige Schritte dahinſchießend, vielleicht auch ihren eben
gefallenen Reiter noch ein Stück ſchleifend, um dann,
wenn ſie die Führerhand nicht mehr fühlten, ſtehen zu
bleiben. Keine hundert Leute waren von dem ganzen
Regiment mehr übrig. Eine Ernte des Todes im gräß-
lichſten Sinne des Wortes!
In dieſem Augenblick fühlte Georges d'Aulnay einen
ſtechenden Schmerz am rechten Ohr. Unwillkürlich fuhr
er mit der Hand darnach, aber — er wußte im Moment
nicht, wie das kam — er fand ſein Ohr nicht. Er
griff und ſuchte abermals, dann aber wurde es plötzlich
finſter vor ſeinen Augen. Er neigte ſich zur Seite,
fiel vom Pferde und war, vielleicht auch infolge des
Sturzes, ſofort beſinnungslos.
Als Georges wieder zu ſich kam, war es dunkel
und ziemlich ſtill um ihn her. Er mußte alſo lange,
vielleicht ſtundenlang beivußtlos dagelegen haben. Das
erſte Gefühl, deſſen er ſich bewußt wurde, war ein
brennender Durſt. Er ſtöhnte leiſe und wollte rufen,
aber er war zu ſchwach, zu elend. Sein Pferd, das
auf einem ſeiner Beine lag, ſchien todt zu ſein. Es
rührte ſich wenigſtens nicht. . Das Bein, auf dem es
lag, ſchien wie abgeſtorben. Leichen von Pferden und
Menſchen lagen um ihn herum. Ein kalter, feiner
Regen fiel nieder und weichte den Acker, auf dem er
lag, zu einer klebrigen, ſchmutzigen Maſſe auf. All-
maͤlig kam er immer mehr zu ſich, namentlich durch
einen unſäglichen Schmerz an der rechten Seite des
Kopfes. Das brannte wie hölliſches Feuer, und als
er mit der Hand in die Nähe kam, fühlte er, daß er
mit dem Koßfe in einer Blutlache lag. Er war alſo
verwundet, vielleicht ſchwer oder gar tödtlich!
Nun erwachte ſein Selbſterhaltungstrieb. Mit den
immer mehr und klarer zurückkehrenden Lebensgeiſtern
kam auch die Liebe zum Leben ſelbſt wieder. Unter
Aechzen und Stöhnen zog er ſein Taſchentuch herpor
und ſuchte es um den Koßf, wo die Wunde ſein mußte,
zu binden, was ihm nur nach mehrexen vergehlichen
Verſuchen gelang. Dann zog und zerrte er an feinem
Bein, um e8 unter dem Pferd hervorzubringen. Aber
das gelang ihm nicht. Es ging über ſeine Kräfte.
Seufzend fiel er wieder entkräftet zurück.
Plötzlich war es ihm, als ob er Stimmen höre,
leiſe, flüſternd, aber er unterſchied doch genau fran-
zöſiſche Worte. Doch ihr Inhalt erfülltz ihn mit
fürchterlicher Angſt, und er zitterte plötzlich am ganzen
Leibe. Waren es Marodeure, Schlachtfeldräuber, die Da
ihr unmenſchliches Gewerbe trieben? Aber nein! tröſtete
er ſich dann wieder, er war ja in Frankreich, Fran-
zoſen konnten ſo etwas nicht thun. Er mußte ſich
getäuſcht haben, aber er wagle doch nicht zu rufen und
unter folchen Umſtänden dié Aufmerkſamkeit auf ſich
und ſeine hilfloſe Lage zu lenken. Vorſichtig und mit
äußerſter Anſtrengung hob er den Kopf etwas und
konnte nun in einer Entfernung von etwa vierzig bis
fünfzig Schritt zwei Geſtalten in langen dunkeln Män-
teln uͤnterſcheiden, von denen die eine kniete und am
Boden mit irgend etwas beſchäftigt war, was er nicht
ſehen konnte. Er hörte ein uͤnheimliches Aechzen, und
endlich preßte eine Stimme, ein wahres Todesröcheln,
die Worte hervor: „Ihr Elenden, ihr wollt einen braven
Soldaten tödten! — Ah — Ah —“
Dann wurde es ſtill. Den jungen d'Aulnay über-
lief es eiskalt. Er ſuchte an ſich herum, nach ſeinem
Revolver. Aber der ſtak in der Satteltaſche, und er
konnte nicht dazu gelangen. Er zweifelte jetzt nicht
mehr daran, daͤß er Leichenräuber und Raubmörder,
das verworfenſte Geſindel, das die Erde hervorzu-
bringen vermag, vor ſich habe. Wenn man ihn fand,
war er verloren. Er hatte Geld und Kleinodien genug
bei ſich, um ihre Gier zu reizen. Er lag alſo ſtill und
wagte kaum zu athmen! vielleicht in der Hoffnung, daß
die Unholde auf dem weiten Leichenfelde eine andere
Richtung nehmen möchten. Nach einigen Minuten
näherten ſie ſich aber der Stelle, mo er lag. Jetzt
mußte er ſein Leben vertheidigen. Er mußte ſeinen
Revolver haben.
„Still!“ hörte er wieder leiſe ſagen, und die Beiden
blieben lauſchend ſtehen.
Ein Schuß krachte hinter ihm. Er ſah nicht, woher
er kam, aber er bemerkte, daß der Eine der Räuber
mit einem wilden Fluch zuſammenbrach, und der An-
dere in wilder Fluͤcht davonlief. Noch einige Schüſſe
fielen ſchnell hinkereinander. Es mußte eine Patrouille
oder ſonſt eine Hilfe in der Nähe ſein. Aber er konnte
nicht ſehen, ob auch der Andere etwas abbekommen
hatte. Er verſchwand im Dunkel der Nacht.
„Zu Hilfe! Zu Hilfe!“ ſchrie jetzt der junge Offizier.
Dann ſank er wieder vollſtändig erſchöpft von Angſt
Es näherten ſich Schritte.
„Hier iſt es!“ ſagte Jemand.
Hier hat das zweite Regiment attackirt?“
Ja. Von Floing her gegen die Hochebene. Wenn
er bei dem Regiment war, muß er hier liegen, oder
er iſt gefangen.“
„Gefangen iſt er nicht. Vielleicht aber todt.“
Zu Hilfe! Zu Hilfe!“ rief der junge d'Aulnay
wieder mit aller Kraft.
„Ein Verwundeter!“ antwortete Jemand. „Kommen
Sie raſch. Er muß hier herum liegen.“
Endlich ſah Georges d'Aulnay zwei Männer vor
ſich, von denen der Eine, ein Bauer aus der Umgegend,
eine Laterne trug. Der Andere war ein Soldat, ein
deutſcher Kavalleriſt in einem langen, ſchweren Mantel,
den Schleppſäbel an der Seite und den Revolver, mit
dem er geſchoſſen hatte, in der Hand.
„Wir müſſen ihm helfen,“ ſagte der Soldat im
reinſten Franzöſiſch. „Leuchten Sie, Girard.“
„Sind Sie verwundet?“ fragte der Soldat dann
den jungen Offizier. 2
„Bin — bin ich Gefangener?“ ſtöhnte Georges
mühſam.
„Laſſen Sie ſich das jetzt nicht kümmern, mein Herr.
Sie ſind Offizier, wie ich ſehe, von den Lanciers.
Können Sie uns Auskunft geben über den Kapitän
Georges d'Aulnay, von der dritten Schwadron des
zweitẽn Regiments?!
„Der bin ich ſelbſt.“
„Sie? Sie ſelbſt?“ erwiederte der Soldat raſch und
kniele bei ihm nieder. „Wo fehlt es? Was können
wir für Sié thun, Herr Kapitän? Wiſſen Sie, daß
ich Ihrer Familie vom Chateau rouge her bekannt bin?
Mein Name iſt Arthur Müller. Aber das iſt jetzt
Nebenſache. Ein aufgefangener Brief Ihres Vaters,
den Sie auf der deutſchen Feldpoſt in Empfang nehmen
können, verrieth mir Ihre Anweſenheit in Sedan, und
ſobald die Schlacht vorbei war, machte ich mich auf,
um Sie zu ſuchen. Wie befinden Sie ſich?“
„Chateau rouge!“ murmelte der Verwundete weh-
müthig, als wäre ihm ein ſüßer Traum erſchienen.
Müller zog ſeine Feldflaſche hervor und flößte ihm
einige Tropfen Cognac ein. Dann padte er ſein
eigenes Verbandzeug aus und machte dem Vexwundeten
einen Nothverband, ſo gut es in ver Eile gehen . ollte,
Dabei redete er dem Verwundeten immer zu und er-
zählte ihm allerhand.
„Wir werden Sie in ein deutſches Feldlazareth
brinzen, Herr Marquis. Nur keine Aufregung. Sie
fommen zu guten Leuten. Nach Sedan hinein können
Sie doch nicht. Und wenn es auch ginge, es würde
Ihnen nichts helfen. Es geht fürchterlich da drinnen
zu. Und morgen iſt Sedan vielleicht nur noch ein
Aſchenhaufen, ibenn die Kapitulation nicht noch in der
Nacht erfolgt.“
„O mein Gott, mein armes Frankreich!“ jammerle
Georges.
„Nur Muth. Das wird Alles wieder anders. Der
Kaiſer ſoll ja ebenfalls gefangen ſein, dann werden
wir bald Frieden haben. Nur Muth, Herr Marquis;
Ihre Schweſter Bettine ſendet Ihnen in dem Brief
Ihres Vaͤters tauſend Grüße; Ihre Familie iſt natür-
lich beunruhigt über Ihr langes Stillſchweigen. Haben
Sie Nachricht über das Schickſal Ihres Bruders?“
„Meines Bruders? Ich habe keinen Bruder.“
Müller hielt betroffen inne. Hatte ihm Bettine im
Chateau rouge nicht die Leiche ihres Bruͤders gezeigt?
„Sie haben keinen Bruder in der Schlacht von Wörth
gehabt, Herr Marquis?“ fragte er nochmals.
„Weder dort noch irgendwo. Ich bin der einzige
Sohn meiner Eltern.“
Einen Augenblick ſchwieg Müller und ſetzte ſeine
Hantirung ſtumm fort. Der leichte Plauderton mit -
dem er den Verwundeten aufrichten und auffriſchen
wollte, verſagte ihm. Hatte ihn Bettine belagen? Und
wenn ſie das gethan, wer war dann der Unglückliche
geweſen, an deſſen Leiche er ſie wie erſtarrt gefunden
hatte? War er von der liſtigen Franzöſin in ſolcher
Weiſe hintergangen worden? Konnten dieſe Augen
trügen? Ein tiefer, herber Schmerz, der faſt wie Ver-
achtung ausſah, lag auf ſeinen Zügen.
Der württembergiſchen Reiterei war am frühen
Morgen vor der Schlacht an der Straße von Mezicres
nach Sedan eine franzöſiſche Feldpoſt In die Hände
gefallen, die wahrſcheinlich in der Annahme, daß die
Straße nach Sedan noch frei ſei, von dort abgefertigt
worden war. Der Zufall wollte, daß Muller als
einziger „Franzoſe“ in der Schwadron beauftragt wurde,
den Inhalt der Poſt zu ſichten. Dabei war ihm der
Brief des alten Marquis d'Aulnay an ſeinen Sohn
aufgefallen, und er hatte ſchon aus der Adreſſe erfahren,
daß der junge Marquis bei der dritten Schwadron des
zweiten Lancierregiments ſtand. Dann hatte er von
den grimmigen Attacken der franzöſiſchen Reiterei auf
der Hochfläche von Floing und von ihren ſchrecklichen
Verluſten gehört, was ihm nun keine Ruhe mehr ließ,
nach dem Adreſſaten des Briefes zu ſuchen. Jetzt frei-
lich wußte er ſelbſt nicht mehr, weshalb er ſich, ermüdet.
und zum Tode erſchöpft, aufgemacht hatte, um das
Mitglied einer Familie zu ſuchen und zu retten, die
ihm bisher nur hinterliſtig und verlogen gegenüber
getreten war. Was gingen ihn die Leute an? Sie waren
ſeine Feinde, er der ihre. Ex war ihnen gegenüber
ſicher zu nichts verpflichtet. Dann aber trat immer
und immer wieder die Geſtalt Bettinens vor ſein geiſtiges
Auge, mit dem feinen, marmorblaſſen Geſicht, den ſcharf
und ſchön geſchnittenen Zügen und dem glühenden,
verheißenden Blick. Wenn ſie auch log wie der Teufel
— ſie war doch ſchön wie ein Engel! Und er fühlte,
wie ein geheimnißvolles, aber doch ſtarkes, unzerreiß-
bares Band ihn mit der Familie vereinigte, ihn zu ihr
hinzog. Er malte ſich im Geiſt die ſchreckliche Situation
aus, die entſtanden wäre, wenn er dem jungen d Aulnay
perſönlich im Kampf hätte gegenüber treten müſſen, und
geblieben. Georges hatte eine unverkennbare Aehnlich-
keit mit ſeiner Schweſter. Die Augen waren faſt ganz
dieſelben, hatten auch den feuchten Zaubex, den Bettinens
Augen boten. Wer weiß, dachte Müller bei ſich, ob
ihm im entſcheidenden Moment dieſen Augen gegenüber
nicht die Waffe entfallen wäre. Die Feindſchaft hatte
ihre Grenzen — die Liebe nicht!
„Können Sie gehen?“ fragte er den Vexwundeten,
als er ihn im Verein mit dem Bauer mühſam unter
dem todten Pferd hervorgezogen hatte.
Es war gar kein Gedanke daran.
„Wollen Sie den Offizier bis zu unſerer Feldwache
tragen, Girard? fragte Müller den Bauern.
Dieſer, ein ſtämmiger, gutmüthiger Menſch, nickte,
und ſo lud Müller ihm den Verwundeten auf den
Rücken und legte ihm die Arme des halb Bewußtloſen
um den Hals.
Dann gingen ſie langſam nach St. Menges zu, wo
die preußiſchen Vorpoſten ſtanden.
Achtze hutes Kapiftel.
Gerade in dem Augenblick, als man im deutſchen
Großen Hauptquartier, das ſich während der Schlacht
auf der Höhe von Fréndis befand, aus Mitleid für