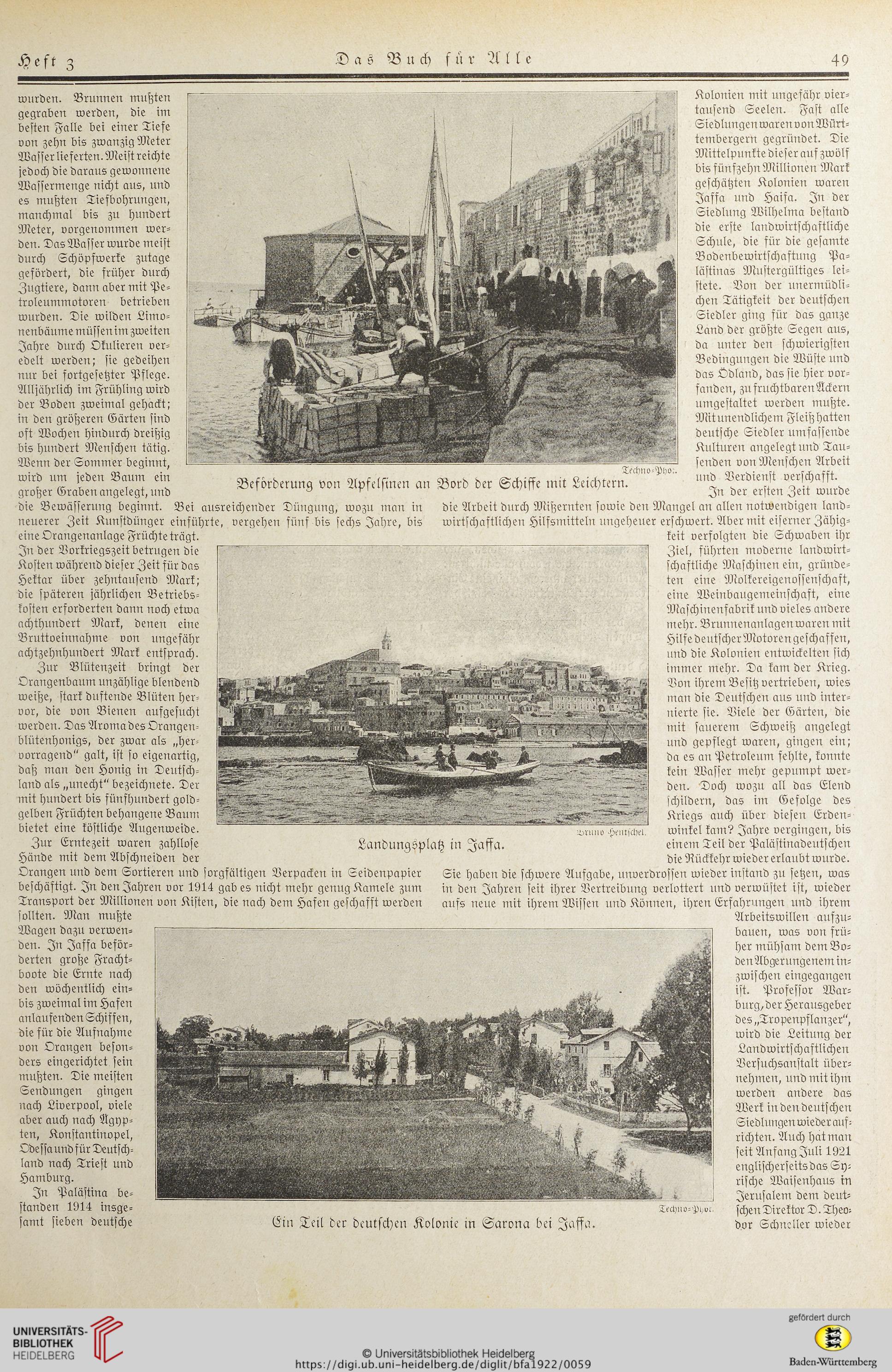Heft z
D a s Buch f ü r Alle
49
Landungsplatz in Jaffa.
Ein Teil der deutschen Kolonie in Sarona bei Jaffa.
Kolonien mit ungefähr vier-
tausend Seelen. Fast alle
Siedlungen waren von Würt-
tembergern gegründet. Die
Mittelpunkte dieser auf zwölf
bis fünfzehn Millionen Mark
geschätzten Kolonien waren
Jaffa und Haifa. In der
Siedlung Wilhelma bestand
die erste landwirtschaftliche
Schule, die für die gesamte
Bodenbewirtschaftuug Pa-
lästinas Mustergültiges lei-
stete. Von der unermüdli-
chen Tätigkeit der deutschen
Siedler ging für das ganze
Land der größte Segen aus,
da unter den schwierigsten
Bedingungen die Wüste und
das Ödland, das sie hier vor-
fanden, zufruchtbarenAckern
umgestaltet werden mutzte.
Mit unendlichem Fleitz hatten
deutsche Siedler umfassende
Kulturen angelegt und Tau-
senden von Menschen Arbeit
und Verdienst verschafft.
In der ersten Zeit wurde
keit verfolgten die Schwaben ihr
Ziel, führten moderne landwirt-
schaftliche Maschinen ein, gründe-
ten eine Molkereigenossenschaft,
eine Weinbaugemeinschaft, eine
Maschinenfabrik und vieles andere
mehr. Brunnenanlagenwaren mit
Hilfe deutscher Motoren geschaffen,
und die Kolonien entwickelten sich
immer mehr. Da kam der Krieg.
Von ihrem Besitz vertrieben, wies
man die Deutschen aus uud inter-
nierte sie. Viele der Gärten, die
mit sauerem Schweitz angelegt
und gepflegt waren, gingen ein;
da es an Petroleum fehlte, konnte
kein Wasser mehr gepumpt wer-
den. Doch wozu all das Elend
schildern, das im Gefolge des
Kriegs auch über diesen Erden-
winkel kam? Jahre vergingen, bis
einem Teil der Palästinadeutschen
die Rückkehr wieder erlaubt wurde.
Sie haben die schwere Aufgabe, unverdrossen wieder instand zu setzen, was
in den Jahren seit ihrer Vertreibung verlottert und verwüstet ist, wieder
aufs ueue mit ihrem Wissen und Können, ihren Erfahrungen und ihrem
Arbeitswillen aufzu-
bauen, was von frü-
her mühsam dem Bo-
den Abgerungenem in-
zwischen eingegangen
ist. Professor War-
burg, der Herausgeber
des „Tropenpflanzer",
wird die Leitung der
Landwirtschaftlichen
Versuchsanstalt über-
nehmen, und mit ihm
werden andere das
Werk in den deutschen
Siedlungen wieder auf-
richten. Auch hat man
seit Anfang Juli 1921
englischerseits das Sy-
rische Waisenhaus in
Jerusalem dem deut-
schen Direktor D. Theo-
dor Schneller wieder
Techno-Pho:.
Beförderung von Apfelsinen an Bord der Schiffe mit Leichtern.
wurden. Brunnen mutzten
gegraben werden, die im
besten Falle bei einer Tiefe
von zehn bis zwanzig Meter
Wasser lieferten. Meist reichte
jedoch die daraus gewounene
Wassermenge nicht aus, und
es mutzten Tiefbohrungen,
manchmal bis zu hundert
Meter, vorgenommen wer¬
den. Das Wasser wurde meist
durch Schöpfwerke zutage
gefördert, die früher durch
Zugtiere, danu aber mit Pe¬
troleummotoren betrieben
wurden. Die wilden Limo¬
nenbäume müssen im zweiten
Jahre durch Okulieren ver¬
edelt werden; sie gedeihen
nur bei fortgesetzter Pflege.
Alljährlich im Frühling wird
der Boden zweimal gehackt;
in den größeren Gärten sind
oft Wochen hindurch dreißig
bis hundert Menschen tätig.
Wenn der Sommer beginnt,
wird um jeden Baum ein
großer Graben angelegt, und
die Bewässerung beginnt. Bei ausreichender Düngung, wozu inan in die Arbeit durch Mißernten sowie den Mangel an allen notwendigen land-
neuerer Zeit Kunstdünger einführte, vergehen fünf bis sechs Jahre, bis wirtschaftlichen Hilfsmitteln ungeheuer erschwert. Aber mit eiserner Zähig-
eine Orangenanlage Früchte trägt.
In der Vorkriegszeit betrugen die
Kosten während dieser Zeit für das
Hektar über zehntausend Mark;
die späteren jährlichen Betriebs¬
kosten erforderten dann noch etwa
achthundert Mark, denen eine
Bruttoeinnahme von ungefähr
achtzehnhundert Mark entsprach.
Zur Blütenzeit bringt der
Orangenbaum unzählige blendend
weiße, stark duftende Blüten her¬
vor, die von Bienen aufgesucht
werden. Das Aromades Orangen¬
blütenhonigs, der zwar als „her¬
vorragend" galt, ist so eigenartig,
daß man den Honig in Deutsch¬
land als „unecht" bezeichnete. Der
mit hundert bis fünfhundert gold¬
gelben Früchten behangene Baum
bietet eine köstliche Augenweide.
Zur Erntezeit waren zahllose
Hände mit dem Abschneiden der
Orangen und dem Sortieren und sorgfältigen Verpacken in Seidenpapier
beschäftigt. In den Jahren vor 1914 gab es nicht mehr genng Kamele zum
Transport der Millionen von Kisten, die nach dem Hafen geschafft werden
sollten. Man mutzte
Wagen dazu verwen¬
den. In Jaffa beför¬
derten große Fracht¬
boote die Ernte nach
den wöchentlich ein-
bis zweimal im Hafen
anlaufenden Schiffen,
die für die Aufnahme
von Orangen beson¬
ders eingerichtet sein
mutzten. Die meisten
Sendungen gingen
nach Liverpool, viele
aber auch nach Ägyp¬
ten, Konstantinopel,
Odessa undfür Deutsch¬
land nach Triest und
Hamburg.
In Palästina be¬
standen 1914 insge¬
samt sieben deutsche
D a s Buch f ü r Alle
49
Landungsplatz in Jaffa.
Ein Teil der deutschen Kolonie in Sarona bei Jaffa.
Kolonien mit ungefähr vier-
tausend Seelen. Fast alle
Siedlungen waren von Würt-
tembergern gegründet. Die
Mittelpunkte dieser auf zwölf
bis fünfzehn Millionen Mark
geschätzten Kolonien waren
Jaffa und Haifa. In der
Siedlung Wilhelma bestand
die erste landwirtschaftliche
Schule, die für die gesamte
Bodenbewirtschaftuug Pa-
lästinas Mustergültiges lei-
stete. Von der unermüdli-
chen Tätigkeit der deutschen
Siedler ging für das ganze
Land der größte Segen aus,
da unter den schwierigsten
Bedingungen die Wüste und
das Ödland, das sie hier vor-
fanden, zufruchtbarenAckern
umgestaltet werden mutzte.
Mit unendlichem Fleitz hatten
deutsche Siedler umfassende
Kulturen angelegt und Tau-
senden von Menschen Arbeit
und Verdienst verschafft.
In der ersten Zeit wurde
keit verfolgten die Schwaben ihr
Ziel, führten moderne landwirt-
schaftliche Maschinen ein, gründe-
ten eine Molkereigenossenschaft,
eine Weinbaugemeinschaft, eine
Maschinenfabrik und vieles andere
mehr. Brunnenanlagenwaren mit
Hilfe deutscher Motoren geschaffen,
und die Kolonien entwickelten sich
immer mehr. Da kam der Krieg.
Von ihrem Besitz vertrieben, wies
man die Deutschen aus uud inter-
nierte sie. Viele der Gärten, die
mit sauerem Schweitz angelegt
und gepflegt waren, gingen ein;
da es an Petroleum fehlte, konnte
kein Wasser mehr gepumpt wer-
den. Doch wozu all das Elend
schildern, das im Gefolge des
Kriegs auch über diesen Erden-
winkel kam? Jahre vergingen, bis
einem Teil der Palästinadeutschen
die Rückkehr wieder erlaubt wurde.
Sie haben die schwere Aufgabe, unverdrossen wieder instand zu setzen, was
in den Jahren seit ihrer Vertreibung verlottert und verwüstet ist, wieder
aufs ueue mit ihrem Wissen und Können, ihren Erfahrungen und ihrem
Arbeitswillen aufzu-
bauen, was von frü-
her mühsam dem Bo-
den Abgerungenem in-
zwischen eingegangen
ist. Professor War-
burg, der Herausgeber
des „Tropenpflanzer",
wird die Leitung der
Landwirtschaftlichen
Versuchsanstalt über-
nehmen, und mit ihm
werden andere das
Werk in den deutschen
Siedlungen wieder auf-
richten. Auch hat man
seit Anfang Juli 1921
englischerseits das Sy-
rische Waisenhaus in
Jerusalem dem deut-
schen Direktor D. Theo-
dor Schneller wieder
Techno-Pho:.
Beförderung von Apfelsinen an Bord der Schiffe mit Leichtern.
wurden. Brunnen mutzten
gegraben werden, die im
besten Falle bei einer Tiefe
von zehn bis zwanzig Meter
Wasser lieferten. Meist reichte
jedoch die daraus gewounene
Wassermenge nicht aus, und
es mutzten Tiefbohrungen,
manchmal bis zu hundert
Meter, vorgenommen wer¬
den. Das Wasser wurde meist
durch Schöpfwerke zutage
gefördert, die früher durch
Zugtiere, danu aber mit Pe¬
troleummotoren betrieben
wurden. Die wilden Limo¬
nenbäume müssen im zweiten
Jahre durch Okulieren ver¬
edelt werden; sie gedeihen
nur bei fortgesetzter Pflege.
Alljährlich im Frühling wird
der Boden zweimal gehackt;
in den größeren Gärten sind
oft Wochen hindurch dreißig
bis hundert Menschen tätig.
Wenn der Sommer beginnt,
wird um jeden Baum ein
großer Graben angelegt, und
die Bewässerung beginnt. Bei ausreichender Düngung, wozu inan in die Arbeit durch Mißernten sowie den Mangel an allen notwendigen land-
neuerer Zeit Kunstdünger einführte, vergehen fünf bis sechs Jahre, bis wirtschaftlichen Hilfsmitteln ungeheuer erschwert. Aber mit eiserner Zähig-
eine Orangenanlage Früchte trägt.
In der Vorkriegszeit betrugen die
Kosten während dieser Zeit für das
Hektar über zehntausend Mark;
die späteren jährlichen Betriebs¬
kosten erforderten dann noch etwa
achthundert Mark, denen eine
Bruttoeinnahme von ungefähr
achtzehnhundert Mark entsprach.
Zur Blütenzeit bringt der
Orangenbaum unzählige blendend
weiße, stark duftende Blüten her¬
vor, die von Bienen aufgesucht
werden. Das Aromades Orangen¬
blütenhonigs, der zwar als „her¬
vorragend" galt, ist so eigenartig,
daß man den Honig in Deutsch¬
land als „unecht" bezeichnete. Der
mit hundert bis fünfhundert gold¬
gelben Früchten behangene Baum
bietet eine köstliche Augenweide.
Zur Erntezeit waren zahllose
Hände mit dem Abschneiden der
Orangen und dem Sortieren und sorgfältigen Verpacken in Seidenpapier
beschäftigt. In den Jahren vor 1914 gab es nicht mehr genng Kamele zum
Transport der Millionen von Kisten, die nach dem Hafen geschafft werden
sollten. Man mutzte
Wagen dazu verwen¬
den. In Jaffa beför¬
derten große Fracht¬
boote die Ernte nach
den wöchentlich ein-
bis zweimal im Hafen
anlaufenden Schiffen,
die für die Aufnahme
von Orangen beson¬
ders eingerichtet sein
mutzten. Die meisten
Sendungen gingen
nach Liverpool, viele
aber auch nach Ägyp¬
ten, Konstantinopel,
Odessa undfür Deutsch¬
land nach Triest und
Hamburg.
In Palästina be¬
standen 1914 insge¬
samt sieben deutsche