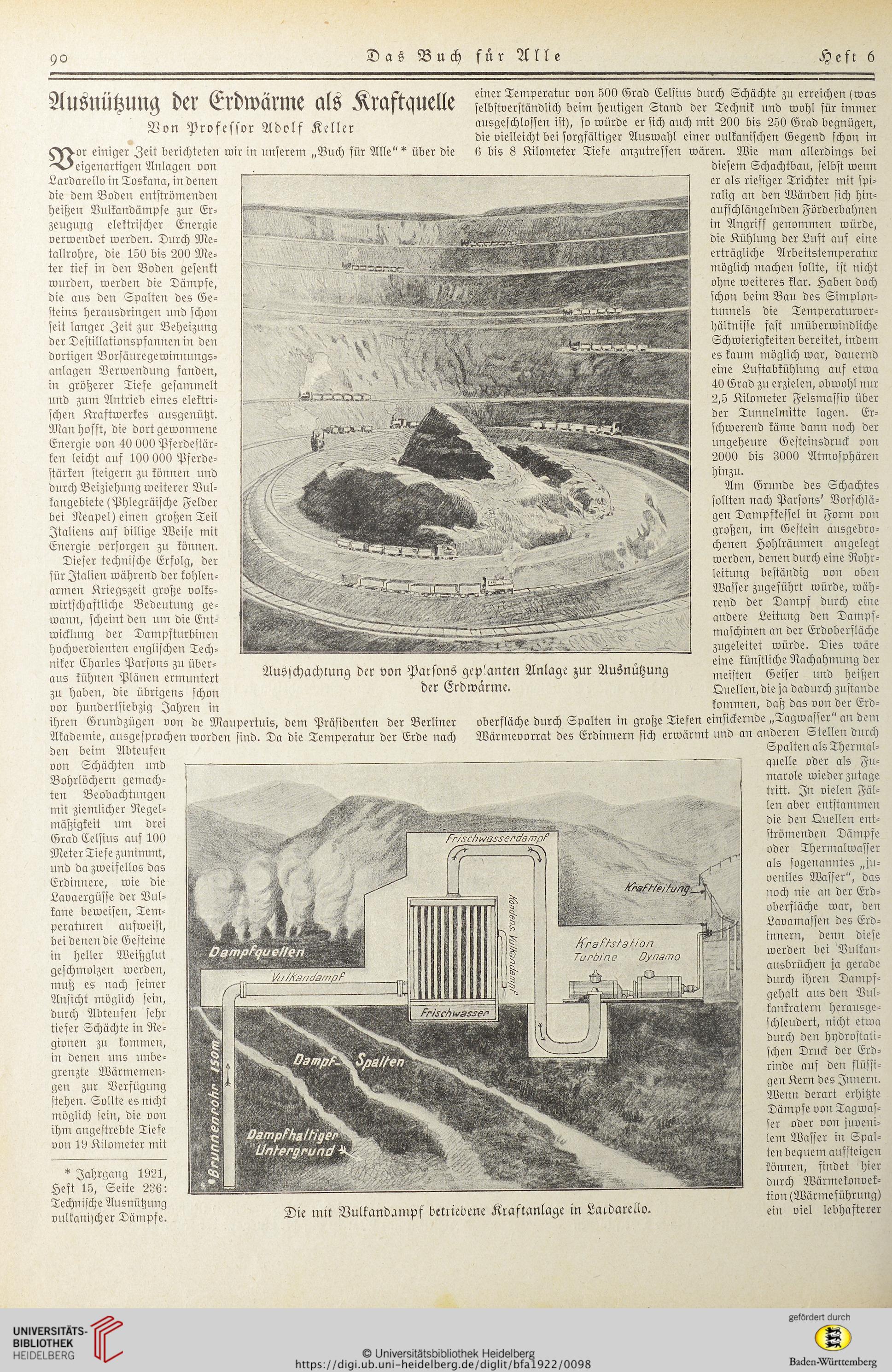yo
Das Buch für Alle
Heft 6
/rSs/vS/s//o/7
Z?//7S/770
- tg
--
Ausnützung der Erdwärme als Kraftquelle
Von Professor Adolf Keller
^VXor einiger Zeit berichteten wir in unserem „Brich für Alle" * über die
eigenartigen Anlagen von
Lardarello in Toskana, in denen
die dem Boden entströmenden
heißen Vulkandämpfe zur Er¬
zeugung elektrischer Energie
verwendet werden. Durch Me¬
tallrohre, die 150 bis 200 Me¬
ter tief in den Boden gesenkt
wurden, werden die Dämpfe,
die aus den Spalten des Ge¬
steins herausdringen und schon
seit langer Zeit zur Beheizung
der Destillationspfannen in den
dortigen Borsäuregewinnungs¬
anlagen Verwendung fanden,
in größerer Tiefe gesammelt
und zum Antrieb eines elektri¬
schen Kraftwerkes ausgenüht.
Man hofft, die dort gewonnene
Energie von 40 000 Pferdestär¬
ken leicht auf 100 000 Pferde¬
stärken steigern zu können und
durch Beiziehung weiterer Vul¬
kangebiete (Phlegräische Felder
bei Neapel) einen großen Teil
Italiens auf billige Weise mit
Energie versorgen zu können.
Dieser technische Erfolg, der
für Italien während der kohlen-
armen Kriegszeit große volks¬
wirtschaftliche Bedeutung ge¬
wann, scheint den um die Ent¬
wicklung der Dampfturbinen
hochverdienten englischen Tech¬
niker Charles Parsons zu über¬
aus kühnen Plänen ermuntert
zu haben, die übrigens schon
vor hundertsiebzig Jahren in
ihren Grundzügen von de Maupertuis, dem Präsidenten der Berliner
Akademie, ausgesprochen worden sind. Da die Temperatur der Erde nach
den beim Abteufen
von Schächten und
Bohrlöchern gemach¬
ten Beobachtungen
mit ziemlicher Regel¬
mäßigkeit um drei
Grad Celsius auf 100
Meter Tiefe zunimmt,
und da zweifellos das
Erdinnere, wie die
Lavaergüsse der Vul¬
kane beweisen, Tem¬
peraturen aufweist,
bei denen die Gesteine
in Heller Weißglut
geschmolzen werden,
muß es nach seiner
Ansicht möglich sein,
durch Abteufen sehr
tiefer Schächte in Re¬
gionen zu kommen,
in denen uns unbe¬
grenzte Wärmemen¬
gen zur Verfügung
stehen. Sollte es nicht
möglich sein, die von
ihm angestrebte Tiefe
von 10 Kilometer mit
* Jahrgang 1921,
Heft 15, Seite 236:
Technische Ausnützung
vulkanycher Dämpfe.
einer Temperatur von 500 Grad Celsius durch Schächte zu erreichen (was
selbstverständlich beim heutigen Stand der Technik und wohl für immer
ausgeschlossen ist), so würde er sich auch mit 200 bis 250 Grad begnügen,
die vielleicht bei sorgfältiger Auswahl einer vulkanischen Gegend schon in
6 bis 8 Kilometer Tiefe anzutreffen wären. Wie man allerdings bei
diesem Schachtbau, selbst wenn
er als riesiger Trichter mit spi-
ralig an den Wänden sich hin-
aufschlängelnden Förderbahnen
in Angriff genommen würde,
die Kühlung der Luft auf eine
erträgliche Arbeitstemperatur
möglich machen sollte, ist nicht
ohne weiteres klar. Haben doch
schon beim Bau des Simplon-
tunnels die Temperaturver-
hältnisse fast unüberwindliche
Schwierigkeiten bereitet, indem
es kaum möglich war, dauernd
eine Luftabkühlung auf etwa
40 Grad zu erzielen, obwohl nur
2,5 Kilometer Felsmassiv über
der Tunnelmitte lagen. Er-
schwerend käme dann noch der
ungeheure Gesteinsdruck von
2000 bis 3000 Atmosphären
hinzu.
Am Grunde des Schachtes
sollten nach Parsons' Vorschlä-
gen Dampfkessel in Form von
großen, im Gestein ausgebro-
chenen Hohlräumen angelegt
werden, denen durch eine Rohr-
leitung beständig von oben
Wasser zugeführt würde, wäh-
rend der Dampf durch eine
andere Leitung den Dampf-
maschinen an der Erdoberfläche
zugeleitet würde. Dies wäre
eine künstliche Nachahmung der
meisten Geiser und heißen
Quellen, die ja dadurch zustande
kommen, daß das von der Erd-
einsickernde „Tagwasser" an dem
und an anderen Stellen durch
Spalten als Thermal-
quelle oder als Fu-
marole wieder zutage
tritt. In vielen Fäl-
len aber entstammen
die den Quellen ent-
strömenden Dämpfe
oder Thermalwasser
als sogenanntes „ju-
veniles Wasser", das
noch nie an der Erd-
oberfläche war, den
Lavamassen des Erd-
innern, denn diese
werden bei Vulkan-
ausbrüchen ja gerade
durch ihren Dampf-
gehalt aus den Vul-
kankratern herausge-
schleudert, nicht etwa
durch den hydrostati-
schen Druck der Erd-
rinde auf den flüssi-
gen Kern des Innern.
Wenn derart erhitzte
Dämpfe von Tagwas-
ser oder von juveni-
lem Wasser in Spal-
ten bequem aufsteigen
können, findet hier
durch Wärmekonvek-
tion (Würmeführung)
ein viel lebhafterer
Ausschachtung der von Parsons gep'anten Anlage zur Ausnützung
der Erdwärme.
oberfläche durch Spalten in große Tiefen
Wärmevorrat des Erdinnern sich erwärmt
Die mit Vulkandampf betriebene Kraftanlage in Lardarello.
Das Buch für Alle
Heft 6
/rSs/vS/s//o/7
Z?//7S/770
- tg
--
Ausnützung der Erdwärme als Kraftquelle
Von Professor Adolf Keller
^VXor einiger Zeit berichteten wir in unserem „Brich für Alle" * über die
eigenartigen Anlagen von
Lardarello in Toskana, in denen
die dem Boden entströmenden
heißen Vulkandämpfe zur Er¬
zeugung elektrischer Energie
verwendet werden. Durch Me¬
tallrohre, die 150 bis 200 Me¬
ter tief in den Boden gesenkt
wurden, werden die Dämpfe,
die aus den Spalten des Ge¬
steins herausdringen und schon
seit langer Zeit zur Beheizung
der Destillationspfannen in den
dortigen Borsäuregewinnungs¬
anlagen Verwendung fanden,
in größerer Tiefe gesammelt
und zum Antrieb eines elektri¬
schen Kraftwerkes ausgenüht.
Man hofft, die dort gewonnene
Energie von 40 000 Pferdestär¬
ken leicht auf 100 000 Pferde¬
stärken steigern zu können und
durch Beiziehung weiterer Vul¬
kangebiete (Phlegräische Felder
bei Neapel) einen großen Teil
Italiens auf billige Weise mit
Energie versorgen zu können.
Dieser technische Erfolg, der
für Italien während der kohlen-
armen Kriegszeit große volks¬
wirtschaftliche Bedeutung ge¬
wann, scheint den um die Ent¬
wicklung der Dampfturbinen
hochverdienten englischen Tech¬
niker Charles Parsons zu über¬
aus kühnen Plänen ermuntert
zu haben, die übrigens schon
vor hundertsiebzig Jahren in
ihren Grundzügen von de Maupertuis, dem Präsidenten der Berliner
Akademie, ausgesprochen worden sind. Da die Temperatur der Erde nach
den beim Abteufen
von Schächten und
Bohrlöchern gemach¬
ten Beobachtungen
mit ziemlicher Regel¬
mäßigkeit um drei
Grad Celsius auf 100
Meter Tiefe zunimmt,
und da zweifellos das
Erdinnere, wie die
Lavaergüsse der Vul¬
kane beweisen, Tem¬
peraturen aufweist,
bei denen die Gesteine
in Heller Weißglut
geschmolzen werden,
muß es nach seiner
Ansicht möglich sein,
durch Abteufen sehr
tiefer Schächte in Re¬
gionen zu kommen,
in denen uns unbe¬
grenzte Wärmemen¬
gen zur Verfügung
stehen. Sollte es nicht
möglich sein, die von
ihm angestrebte Tiefe
von 10 Kilometer mit
* Jahrgang 1921,
Heft 15, Seite 236:
Technische Ausnützung
vulkanycher Dämpfe.
einer Temperatur von 500 Grad Celsius durch Schächte zu erreichen (was
selbstverständlich beim heutigen Stand der Technik und wohl für immer
ausgeschlossen ist), so würde er sich auch mit 200 bis 250 Grad begnügen,
die vielleicht bei sorgfältiger Auswahl einer vulkanischen Gegend schon in
6 bis 8 Kilometer Tiefe anzutreffen wären. Wie man allerdings bei
diesem Schachtbau, selbst wenn
er als riesiger Trichter mit spi-
ralig an den Wänden sich hin-
aufschlängelnden Förderbahnen
in Angriff genommen würde,
die Kühlung der Luft auf eine
erträgliche Arbeitstemperatur
möglich machen sollte, ist nicht
ohne weiteres klar. Haben doch
schon beim Bau des Simplon-
tunnels die Temperaturver-
hältnisse fast unüberwindliche
Schwierigkeiten bereitet, indem
es kaum möglich war, dauernd
eine Luftabkühlung auf etwa
40 Grad zu erzielen, obwohl nur
2,5 Kilometer Felsmassiv über
der Tunnelmitte lagen. Er-
schwerend käme dann noch der
ungeheure Gesteinsdruck von
2000 bis 3000 Atmosphären
hinzu.
Am Grunde des Schachtes
sollten nach Parsons' Vorschlä-
gen Dampfkessel in Form von
großen, im Gestein ausgebro-
chenen Hohlräumen angelegt
werden, denen durch eine Rohr-
leitung beständig von oben
Wasser zugeführt würde, wäh-
rend der Dampf durch eine
andere Leitung den Dampf-
maschinen an der Erdoberfläche
zugeleitet würde. Dies wäre
eine künstliche Nachahmung der
meisten Geiser und heißen
Quellen, die ja dadurch zustande
kommen, daß das von der Erd-
einsickernde „Tagwasser" an dem
und an anderen Stellen durch
Spalten als Thermal-
quelle oder als Fu-
marole wieder zutage
tritt. In vielen Fäl-
len aber entstammen
die den Quellen ent-
strömenden Dämpfe
oder Thermalwasser
als sogenanntes „ju-
veniles Wasser", das
noch nie an der Erd-
oberfläche war, den
Lavamassen des Erd-
innern, denn diese
werden bei Vulkan-
ausbrüchen ja gerade
durch ihren Dampf-
gehalt aus den Vul-
kankratern herausge-
schleudert, nicht etwa
durch den hydrostati-
schen Druck der Erd-
rinde auf den flüssi-
gen Kern des Innern.
Wenn derart erhitzte
Dämpfe von Tagwas-
ser oder von juveni-
lem Wasser in Spal-
ten bequem aufsteigen
können, findet hier
durch Wärmekonvek-
tion (Würmeführung)
ein viel lebhafterer
Ausschachtung der von Parsons gep'anten Anlage zur Ausnützung
der Erdwärme.
oberfläche durch Spalten in große Tiefen
Wärmevorrat des Erdinnern sich erwärmt
Die mit Vulkandampf betriebene Kraftanlage in Lardarello.