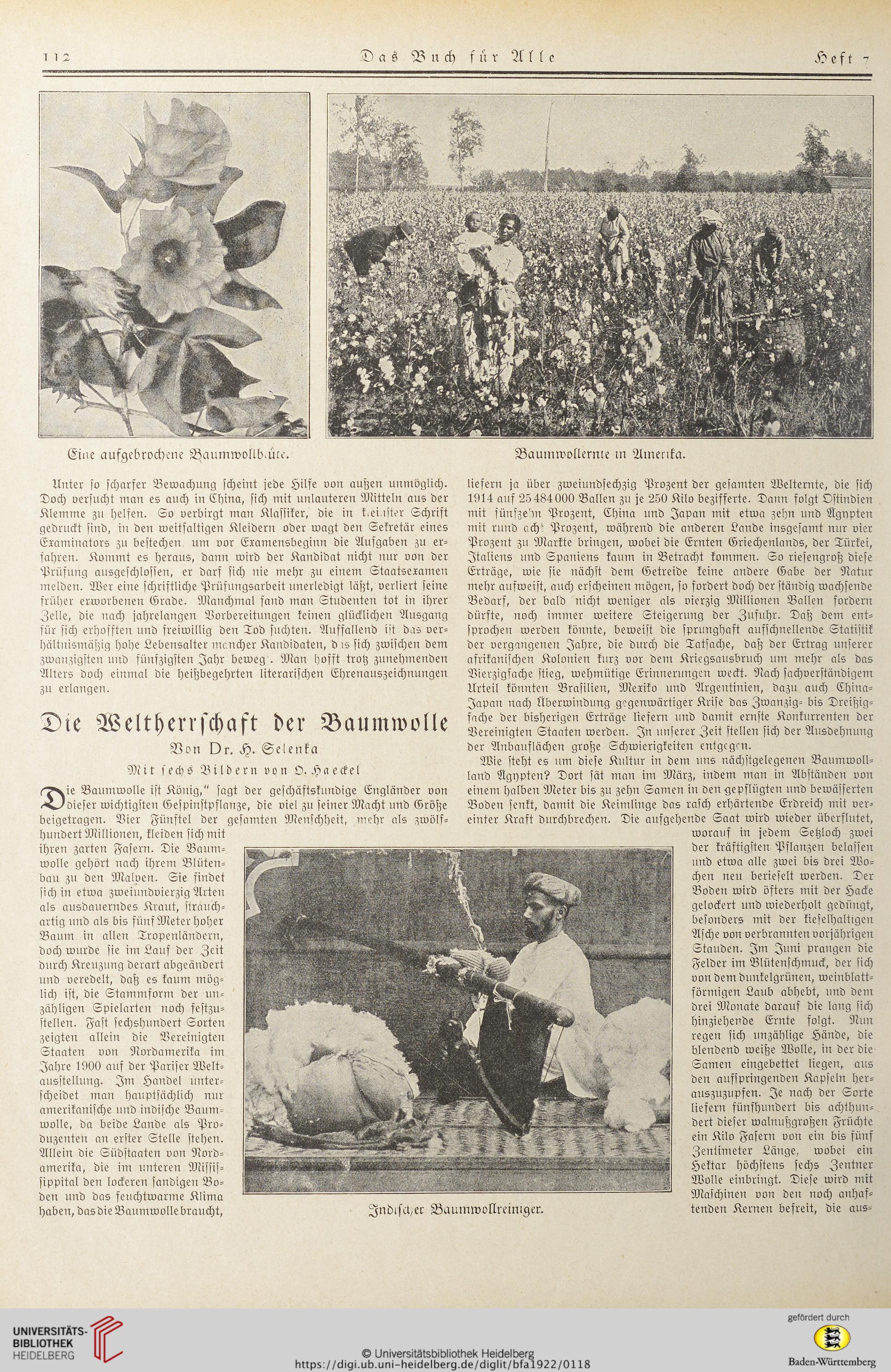Deft -
Eine aufgebrochcne BaumwollbPce.
Baumwollernte m Ainerika.
Unter so scharfer Bewachung scheint jede Hilfe von außen unmöglich.
Doch versucht man es auch in China, sich mit unlauteren Mitteln aus der
Klemme zu helfen. So verbirgt man Klassiker, die in k.eiuster Schrift
gedruckt sind, in den weitfaltigen Kleidern oder wagt den Sekretär eines
Examinators zu bestechen, um vor Eramensbeginn die Aufgaben zu er-
fahren. Kommt es heraus, dann wird der Kandidat nicht nur von der
Prüfung ausgeschlossen, er darf sich nie mehr zu einem Staatsexamen
melden. Wer eine schriftliche Prüfungsarbeit unerledigt läßt, verliert seine
früher erworbenen Grade. Manchmal fand man Studenten tot in ihrer
Zelle, die nach jahrelangen Vorbereitungen keinen glücklichen Ausgang
für sich erhofften und freiwillig den Tod suchten. Auffallend ist das ver-
hältnismäßig hohe Lebensalter mancher Kandidaten, d is sich zwischen dem
zwanzigsten und fünfzigsten Jahr beweg . Man hofft trotz zunehmenden
Alters doch einmal die heißbegehrten literarischen Ehrenauszeichnungen
zu erlangen.
Die Weltherrschaft der Baumwolle
Von Or. H. Selenka
Mit sechs Bildern von O. Haeckel
ie Baumwolle ist König," sagt der geschäftskundige Engländer von
dieser wichtigsten Gespinstpflanze, die viel zu seiner Macht und Größe
beigetragen. Vier Fünftel der gesamten Menschheit, mehr als zwölf-
hundert Millionen, kleiden sich mit
ihren zarten Fasern. Die Baum¬
wolle gehört nach ihrem Blüten¬
bau zu den Malven. Sie findet
sich in etwa zweiundvierzig Arten
als ausdauerndes Kraut, strauch¬
artig und als bis fünf Meter hoher
Baum in allen Tropenländern,
doch wurde sie im Lauf der Zeit
durch Kreuzung derart abgeändert
und veredelt, daß es kaum mög¬
lich ist, die Stammform der un¬
zähligen Spielarten noch festzu¬
stellen. Fast sechshundert Sorten
zeigten allein die Vereinigten
Staaten von Nordamerika im
Jahre 1900 auf der Pariser Welt¬
ausstellung. Im Handel unter¬
scheidet man hauptsächlich nur¬
amerikanische und indische Baum¬
wolle, da beide Lande als Pro¬
duzenten an erster Stelle stehen.
Allein die Südstaaten von Nord¬
amerika, die im unteren Missis-
sippital den lockeren sandigen Bo¬
den und das feuchtwarme Klima
haben, das die Baumwolle braucht,
liefern ja über zweiundsechzig Prozent der gesamten Welternte, die sich
1914 auf 25 484000 Ballen zu je 250 Kilo bezifferte. Dann folgt Ostindien
mit fünfzehn Prozent, China und Japan mit etwa zehn und Ägypten
mit rnnd ackst Prozent, während die anderen Lande insgesamt nur vier
Prozent zu Markte bringen, wobei die Ernten Griechenlands, der Türkei,
Italiens und Spaniens kaum in Betracht kommen. So riesengroß diese
Erträge, wie sie nächst dem Getreide keine andere Gabe der Natur
mehr aufweist, auch erscheinen mögen, so fordert doch der ständig wachsende
Bedarf, der bald nicht weniger als vierzig Millionen Ballen fordern
dürfte, noch immer weitere Steigerung der Zufuhr. Daß dem ent-
sprochen werden könnte, beweist die sprunghaft aufschnellende Statistik
der vergangenen Jahre, die durch die Tatsache, daß der Ertrag unserer
afrikanischen Kolonien kurz vor dem Kriegsausbruch um mehr als das
Vier-zigfache stieg, wehmütige Erinnerungen weckt. Nach sachverständigem
Urteil könnten Brasilien, Mexiko und Argentinien, dazu auch China-
Japan nach Überwindung gegenwärtiger Krise das Zwanzig- bis Dreißig-
fache der bisherigen Erträge liefern und damit ernste Konkurrenten der
Vereinigten Staaten werden. In unserer Zeit stellen sich der Ausdehnung
der Anbauflächen große Schwierigkeiten entgegen.
Wie steht es um diese Kultur in dem uns nächstgelegenen Baumwoll-
land Ägypten? Dort sät man im März, indem man in Abständen von
einem halben Meter bis zn zehn Samen in den gepflügten und bewässerten
Boden senkt, damit die Keimlinge das rasch erhärtende Erdreich mit ver-
einter Kraft durchbrechen. Die aufgehende Saat wird wieder überflutet,
worauf in jedem Setzloch zwei
der kräftigsten Pflanzen belassen
und etwa alle zwei bis drei Wo-
chen neu berieselt werden. Der
Boden wird öfters mit der Hacke
gelockert und wiederholt gedüngt,
besonders mit der kieselhaltigen
Asche von verbrannten vorjährigen
Stauden. Im Juni prangen die
Felder im Vlütenschmuck, der sich
von dem dunkelgrünen, weinblatt-
förmigen Laub abhebt, und dem
drei Monate darauf die lang sich
hinziehende Ernte folgt. Nun
regen sich unzählige Hände, die
blendend weiße Wolle, in der die
Samen eingebettet liegen, aus
den aufspringenden Kapseln her-
auszuzupfen. Je nach der Sorte
liefern fünfhundert bis achthun-
dert dieser walnußgroßen Früchte
ein Kilo Fasern von ein bis fünf
Zentimeter Länge, wobei ein
Hektar höchstens sechs Zentner-
Wolle einbringt. Diese wird mit
Maschinen von den noch anhaf-
tenden Kernen befreit, die aus-
Jndlschec Baumwollreimger.