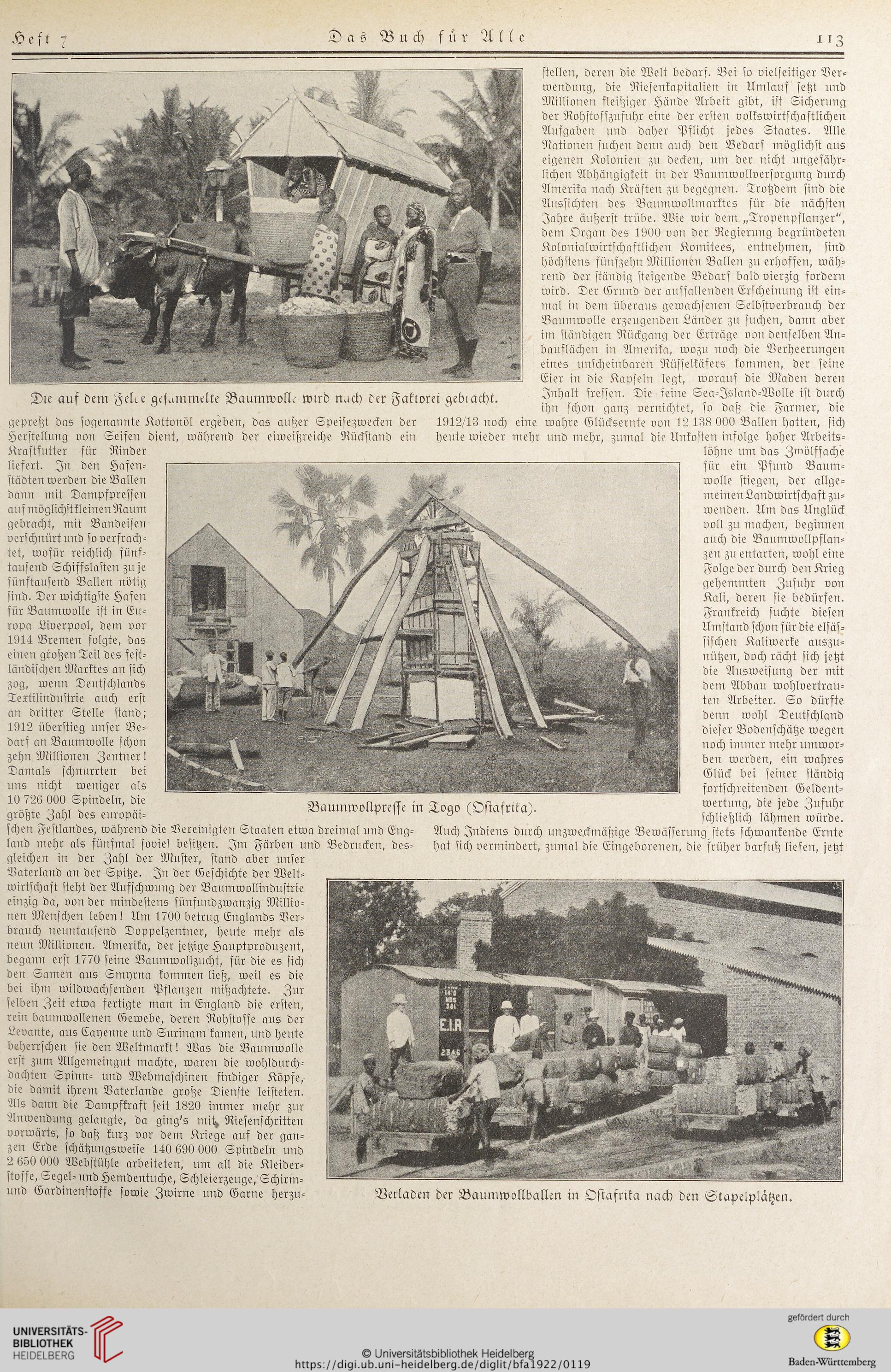Heft 7
Das Buch f ü r l l e
Dre auf dem Fefte gefummelte Baumwolle wird nach der Faktorei gebiacht.
gepreßt das sogenannte Kottonöl ergeben, das außer Speisezwecken der
Herstellung von Seifen dient, während der eiweißreiche Rückstand ein
Kraftfutter für Rinder
liefert. In den Hafen¬
städten werden die Ballen
dann mit Dampfpressen
auf möglichsttleinen Raum
gebracht, mit Bandeisen
verschnürt und so verfrach¬
tet, wofür reichlich fünf¬
tausend Schiffslasten znje
fünftausend Ballen nötig
sind. Der wichtigste Hafen
für Baumwolle ist in Eu¬
ropa Liverpool, dem vor
1914 Bremen folgte, das
einen großen Teil des fest¬
ländischen Marktes an sich
Zog, wenn Deutschlands
Textilindustrie auch erst
an dritter Stelle stand;
1912 überstieg unser Be¬
darf an Baumwolle schou
zehn Millionen Zentner!
Damals schnarrten bei
uns nicht weniger als
10 726 000 Spindeln, die
größte Zahl des europäi¬
schen Festlandes, während die Vereinigten Staaten etwa dreimal und Eng-
land mehr als fünfmal soviel besitzen. Im Färben und
gleichen in der Zahl der Muster, stand aber unser
Vaterland an der Spitze. In der Geschichte der Welt¬
wirtschaft steht der Aufschwung der Baumwollindustrie
einzig da, von der mindestens fünfundzwanzig Millio-
nen Menschen leben! Um 1700 betrug Englands Ver-
brauch neuntausend Doppelzentner, heute mehr als
neun Millionen. Amerika, der jetzige Hauptprodnzent,
begann erst 1770 seine Baumwollzucht, für die es sich
den Samen aus Smyrna kommen ließ, weil es die
bei ihm wildwachsenden Pflanzen mißachtete. Zur
selben Zeit etwa fertigte man in England die ersten,
rein baumwollenen Gewebe, deren Rohstoffe aus der
Levante, aus Cayenne und Surinam kamen, und heilte
beherrschen sie den Weltmarkt! Was die Baumwolle
erst zum Allgemeingut machte, waren die wohldurch-
dachten Spinn- und Webmaschinen findiger Köpfe,
die damit ihrem Vaterlande große Dienste leisteten.
Als dann die Dampfkrnft seit 1820 immer mehr zur
Anwendung gelangte, da ging's mit^ Riesenschritten
vorwärts, so daß kurz vor dem Kriege auf der gan¬
zen Erde schätzungsweise 140 690 000 Spindeln und
2 650 000 Webstühle arbeiteten, um all die Kleider-
stoffe, Segel-und Hemdentuche, Schleierzeuge, Schirm-
und Gardinenstoffe sowie Zwirne und Garne herzu-
stellen, deren die Welt bedarf. Bei so vielseitiger Ver-
wendung, die Riesenkapitalien in Umlauf setzt und
Millionen fleißiger Hände Arbeit gibt, ist Sicherung
der Rohstoffzufuhr eine der ersten volkswirtschaftlichen
Aufgaben und daher Pflicht jedes Staates. Alle
Nationen suchen denn auch den Bedarf möglichst aus
eigenen Kolonien zu decken, um der nicht ungefähr-
licher: Abhängigkeit in der Baumwollversorgnng durch
Amerika uach Kräften zu begegnen. Trotzdem sind die
Aussichten des Baumwollmarktes für die nächsten
Jahre äußerst trübe. Wie wir dem „Tropenpflanzer",
dem Organ des 1900 von der Regierung begründeten
Kolonialwirtschaftlichen Komitees, entnehmen, sind
höchstens fünfzehn Millionen Ballen zn erhoffen, wäh-
rend der ständig steigende Bedarf bald vierzig fordern
wird. Der Grund der auffallenden Erscheinung ist ein-
mal in dem überaus gewachsenen Selbstverbrauch der
Baumwolle erzeugeudeu Länder zn suchen, dann aber
im stündigen Rückgang der Erträge von denselben An-
bauflächen in Amerika, wozu noch die Verheerungen
eines unscheinbaren Rüsselkäfers kommen, der seine
Eier in die Kapseln legt, worauf die Maden deren
Inhalt fressen. Die seine Sea-Jsland-Wolle ist durch
ihn schon ganz vernichtet, so daß die Farmer, die
1912/18 noch eine wahre Glücksernte von 12 138 000 Ballen hatten, sich
heute wieder mehr und mehr, zumal die Unkosten infolge hoher Arbeits-
löhne um das Zmölffache
für ein Pfund Baum-
wolle stiegen, der allge-
meinenLandwirtschaft zu-
wenden. Um das Unglück
voll zu machen, beginnen
auch die Baumwollpflan-
zen zu entarten, wohl eine
Folge der durch den Krieg
gehemmten Zufuhr von
Kali, deren sie bedürfen.
Frankreich suchte diesen
Umstand schon für die elsäs-
sischen Kaliwerke auszu-
nützen, doch rächt sich jetzt
die Ausweisung der mit
dem Abbau wohlvertrau-
ten Arbeiter. So dürfte
denn wohl Deutschland
dieser Bodenschätze wegen
noch immer mehr umwor-
ben werden, ein wahres
Glück bei seiner ständig
fortschreitenden Geldent-
Baulnwollpresse in Togo (Ostafrita). Zufuhr
schließlich lähmen würde.
Auch Indiens durch unzweckmäßige Bewässerung stets schwankende Ernte
Bedrucken, des- hat sich vermindert, zumal die Eingeborenen, die früher barfuß liefen, jetzt
Das Buch f ü r l l e
Dre auf dem Fefte gefummelte Baumwolle wird nach der Faktorei gebiacht.
gepreßt das sogenannte Kottonöl ergeben, das außer Speisezwecken der
Herstellung von Seifen dient, während der eiweißreiche Rückstand ein
Kraftfutter für Rinder
liefert. In den Hafen¬
städten werden die Ballen
dann mit Dampfpressen
auf möglichsttleinen Raum
gebracht, mit Bandeisen
verschnürt und so verfrach¬
tet, wofür reichlich fünf¬
tausend Schiffslasten znje
fünftausend Ballen nötig
sind. Der wichtigste Hafen
für Baumwolle ist in Eu¬
ropa Liverpool, dem vor
1914 Bremen folgte, das
einen großen Teil des fest¬
ländischen Marktes an sich
Zog, wenn Deutschlands
Textilindustrie auch erst
an dritter Stelle stand;
1912 überstieg unser Be¬
darf an Baumwolle schou
zehn Millionen Zentner!
Damals schnarrten bei
uns nicht weniger als
10 726 000 Spindeln, die
größte Zahl des europäi¬
schen Festlandes, während die Vereinigten Staaten etwa dreimal und Eng-
land mehr als fünfmal soviel besitzen. Im Färben und
gleichen in der Zahl der Muster, stand aber unser
Vaterland an der Spitze. In der Geschichte der Welt¬
wirtschaft steht der Aufschwung der Baumwollindustrie
einzig da, von der mindestens fünfundzwanzig Millio-
nen Menschen leben! Um 1700 betrug Englands Ver-
brauch neuntausend Doppelzentner, heute mehr als
neun Millionen. Amerika, der jetzige Hauptprodnzent,
begann erst 1770 seine Baumwollzucht, für die es sich
den Samen aus Smyrna kommen ließ, weil es die
bei ihm wildwachsenden Pflanzen mißachtete. Zur
selben Zeit etwa fertigte man in England die ersten,
rein baumwollenen Gewebe, deren Rohstoffe aus der
Levante, aus Cayenne und Surinam kamen, und heilte
beherrschen sie den Weltmarkt! Was die Baumwolle
erst zum Allgemeingut machte, waren die wohldurch-
dachten Spinn- und Webmaschinen findiger Köpfe,
die damit ihrem Vaterlande große Dienste leisteten.
Als dann die Dampfkrnft seit 1820 immer mehr zur
Anwendung gelangte, da ging's mit^ Riesenschritten
vorwärts, so daß kurz vor dem Kriege auf der gan¬
zen Erde schätzungsweise 140 690 000 Spindeln und
2 650 000 Webstühle arbeiteten, um all die Kleider-
stoffe, Segel-und Hemdentuche, Schleierzeuge, Schirm-
und Gardinenstoffe sowie Zwirne und Garne herzu-
stellen, deren die Welt bedarf. Bei so vielseitiger Ver-
wendung, die Riesenkapitalien in Umlauf setzt und
Millionen fleißiger Hände Arbeit gibt, ist Sicherung
der Rohstoffzufuhr eine der ersten volkswirtschaftlichen
Aufgaben und daher Pflicht jedes Staates. Alle
Nationen suchen denn auch den Bedarf möglichst aus
eigenen Kolonien zu decken, um der nicht ungefähr-
licher: Abhängigkeit in der Baumwollversorgnng durch
Amerika uach Kräften zu begegnen. Trotzdem sind die
Aussichten des Baumwollmarktes für die nächsten
Jahre äußerst trübe. Wie wir dem „Tropenpflanzer",
dem Organ des 1900 von der Regierung begründeten
Kolonialwirtschaftlichen Komitees, entnehmen, sind
höchstens fünfzehn Millionen Ballen zn erhoffen, wäh-
rend der ständig steigende Bedarf bald vierzig fordern
wird. Der Grund der auffallenden Erscheinung ist ein-
mal in dem überaus gewachsenen Selbstverbrauch der
Baumwolle erzeugeudeu Länder zn suchen, dann aber
im stündigen Rückgang der Erträge von denselben An-
bauflächen in Amerika, wozu noch die Verheerungen
eines unscheinbaren Rüsselkäfers kommen, der seine
Eier in die Kapseln legt, worauf die Maden deren
Inhalt fressen. Die seine Sea-Jsland-Wolle ist durch
ihn schon ganz vernichtet, so daß die Farmer, die
1912/18 noch eine wahre Glücksernte von 12 138 000 Ballen hatten, sich
heute wieder mehr und mehr, zumal die Unkosten infolge hoher Arbeits-
löhne um das Zmölffache
für ein Pfund Baum-
wolle stiegen, der allge-
meinenLandwirtschaft zu-
wenden. Um das Unglück
voll zu machen, beginnen
auch die Baumwollpflan-
zen zu entarten, wohl eine
Folge der durch den Krieg
gehemmten Zufuhr von
Kali, deren sie bedürfen.
Frankreich suchte diesen
Umstand schon für die elsäs-
sischen Kaliwerke auszu-
nützen, doch rächt sich jetzt
die Ausweisung der mit
dem Abbau wohlvertrau-
ten Arbeiter. So dürfte
denn wohl Deutschland
dieser Bodenschätze wegen
noch immer mehr umwor-
ben werden, ein wahres
Glück bei seiner ständig
fortschreitenden Geldent-
Baulnwollpresse in Togo (Ostafrita). Zufuhr
schließlich lähmen würde.
Auch Indiens durch unzweckmäßige Bewässerung stets schwankende Ernte
Bedrucken, des- hat sich vermindert, zumal die Eingeborenen, die früher barfuß liefen, jetzt