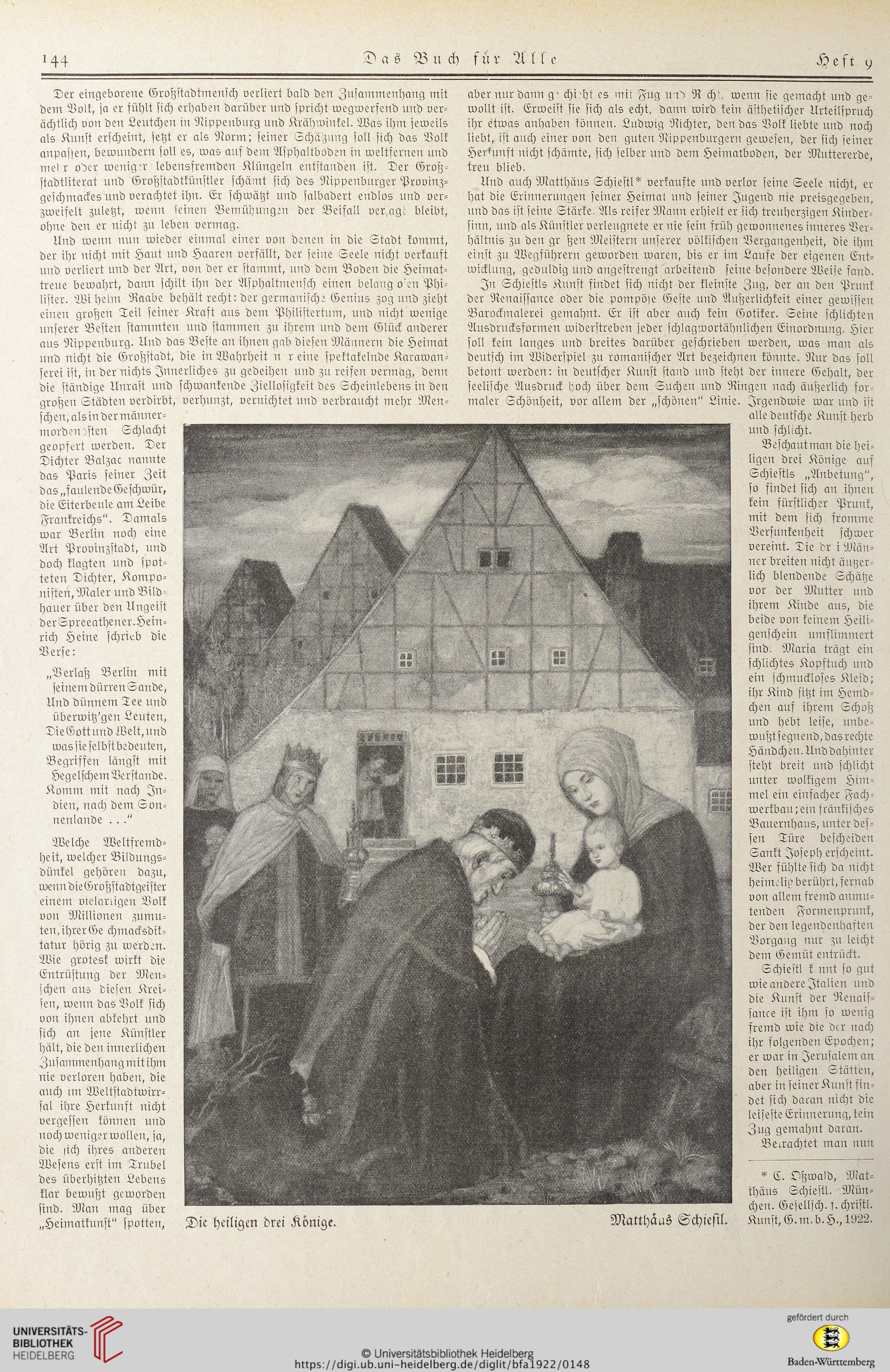144
Das Buch f ü r A l l e
Heft 2
Der eingeborene Großstadtmensch verliert bald den Zusammenhang mit
dem Volt, ja er fühlt sich erhaben darüber nnd spricht wegwerfend und ver-
ächtlich von den Leutchen in Nippenburg lind Krähwinkel. Was ihm jeweils
als Kirnst erscheint, setzt er als Norm: seiner Schätzung soll sich das Volk
anpassen, bewundern soll es, was auf dem Asphaltboden in weltfernen und
mel r oder weniger lebensfremden Klüngeln entstanden ist. Der Groß-
stadtliterat und Großstadtkünstler schämt sich des Nippenburger Provinz-
geschmackes und verachtet ihn. Er schwätzt und salbadert endlos und ver-
zweifelt zuletzt, wenn seinen Bemühungen der Beifall vermag- bleibt,
ohne den er nicht zu leben vermag.
Und wenn nun wieder einmal einer von denen in die Stadt kommt,
der ihr nicht mit Haut uud Haaren verfällt, der seine Seele nicht verkauft
und verliert und der Art, von der er stammt, und dein Boden die Heimat-
treue bewahrt, dann schilt ihn der Asphaltmensch einen belang o'en Phi-
lister. Wi helm Raabe behält recht: der germanische Genius zog und zieht
einen groszen Teil seiner Kraft aus dem Philistertum, uud nicht wenige
unserer Besten stammten und stammen zu ihrem und dem Glück anderer
aus Nippenburg. Uud das Beste an ihnen gab diesen Männern die Heimat
und nicht die Großstadt, die in Wahrheit n r eine spektakelnde Karawan-
serei ist, in der nichts Innerliches zu gedeihen und zu reifen vermäg, denn
die ständige Unrast und schwankende Ziellosigkeit des Scheinlebens in den
groszen Städten verdirbt, verhunzt, vernichtet und verbraucht mehr Men-
schen, alsindermänner-
morderwsten Schlacht
geopfert werden. Der
Dichter Balzac nannte
das Paris seiner Zeit
das „faulendeGe schwür,
die Eiterbeule am Leibe
Frankreichs". Damals
war Berlin noch eine
Art Provinzstadt, und
doch klagten und spot¬
teten Dichter, Kompo¬
nisten, Maler und Bild¬
hauer über den Ungeist
derSpreeathener.Hein¬
rich Heine schrieb die
Verse:
„Verlas; Berlin mit
seinem dürren Sande,
Und dünnem Tee und
überwitz'gen Leuten,
DieGottund Welt,und
was sie selbstbrdeuten,
Begriffen längst mit
HegelschemVerstande.
Komm mit nach In¬
dien, nach dem Son¬
nenlande ..."
Welche Weltfremd¬
heit, welcher Bildungs¬
dünkel gehören dazu,
wenn dieGroszstadtgeister
einem vielarügen Volk
von Millionen zumu¬
ten, ihrer Ge chmacksdik-
tatur hörig zu werden.
Wie grotesk wirkt die
Entrüstung der Men¬
schen aus diesen Krei¬
sen, wenn das Volk sich
von ihnen abkehrt und
sich an jene Künstler
hält, die den innerlichen
Zusammenhang mit ihm
nie verloren haben, die
auch mr Weltstadtwirr-
sal ihre Herkunft nicht
vergessen können und
noch weniger wollen, ja,
die lich ihres anderen
Wesens erst im Trubel
des überhitzteu Lebens
klar bewuszt geworden
sind. Man mag über
„Heimatkunst" spotten,
aber nur dann g' chicht es mit Fug rm> R cht, wenn sie gemacht und ge-
wollt ist. Erweist sie sich als echt, dann wird kein ästhetischer Urteilspruch
ihr etwas anhaben können. Ludwig Richter, den das Volk liebte und noch
liebt, ist auch einer von den guten Nippenburgern gewesen, der sich seiner
Herkunft nicht schämte, sich selber und dem Heimalboden, der Muttererde,
treu blieb.
Uud auch Matthäus Schiestl* verkaufte und verlor seine Seele nicht, er
hat die Erinnerungen seiner Heimal und seiner Jugend nie preisgegeben,
und das ist seine Stärke. Als reifer Mann erhielt er sich treuherzigen Kinder-
sinn, und als Künstler verleugnete er nie sein früh gewonnenes inneres Ver-
hältnis zu deu gr szen Meistern unserer völkischen Vergangenheit, die ihm
einst zu Wegführern geworden waren, bis er im Laufe der eigenen Ent-
wicklung, geduldig und angestrengt arbeitend seine besondere Weise fand.
In Schiestls Kunst findet sich nicht der kleinste Zug, der an den Prunk
der Renaissance oder die pompche Geste und Äußerlichkeit eurer gewisser:
Barockmalerei gemahut. Er ist aber auch kein Gotiker. Seine schlichten
Ausdrucksformen widerstreben jeder schlagwortähnlichen Einordnung. Hier
soll kein langes und breites darüber geschrieben werden, was man als
deutsch im Widerspiel zu romanischer Art bezeichnen könnte. Nur das soll
betout werden: in deutscher Kunst stand und steht der innere Gehalt, der
seelische Ausdruck hoch über dem Suchen und Ringen nach äußerlich for-
maler Schönheit, vor allem der „schönen" Linie. Irgendwie war und ist
alle deutsche Kunst herb
und schlicht.
Beschautman die hei-
ligen drei Könige auf
Schiestls „Anbetung",
so findet sich an ihnen
kein fürstlicher Prunk,
mit dem sich fromme
Versunkenheit schwer
vereint. Tie dr i Män-
ner breiten nicht äußer-
lich blendende Schätze
vor der Mutter und
ihrem Kinde aus, die
beide von keinem Heili-
genschein umflimmert
sind. Maria trägt ein
schlichtes Kopftuch und
ein schmuckloses Kleid;
ihr Kind sitzt im Hemd-
chen auf ihrem Schoß
und hebt leise, unbe-
wußt segnend, dasrechte
Händchen, kinddahinter
steht breit und schlicht
unter wolkigem Him-
mel ein einfacher Fach-
werkbau; ein fränkisches
Bauernhaus, unter des-
sen Türe bescheiden
Sankt Joseph erscheint.
Wer fühlte sich da nicht
heimelig berührt, fernab
von allem fremd anmu-
tenden Formenprunk,
der den legendenhaften
Vorgang nur zu leicht
dem Gemüt entrückt.
Schiestl k nnt so gut
wie auoereItalien und
die Kunst der Renais-
sance ist ihm so wenig
fremd wie die dcr nach
ihr folgenden Epochen;
er war in Jerusalem an
den heiligen Stätten,
aber in seiner Kunst fin-
det sich daran nicht die
leiseste Erinnerung, kein
Zug gemahnt daran.
Befrachtet man nun
* E. Oßwald, Mat-
thäus Schiestl. Mün-
chen. Gcsellsch. z. christl.
Kunst, G. m. b. H., 1922.
Die heiligen drei Könige. Matthäus Schiehl.
Das Buch f ü r A l l e
Heft 2
Der eingeborene Großstadtmensch verliert bald den Zusammenhang mit
dem Volt, ja er fühlt sich erhaben darüber nnd spricht wegwerfend und ver-
ächtlich von den Leutchen in Nippenburg lind Krähwinkel. Was ihm jeweils
als Kirnst erscheint, setzt er als Norm: seiner Schätzung soll sich das Volk
anpassen, bewundern soll es, was auf dem Asphaltboden in weltfernen und
mel r oder weniger lebensfremden Klüngeln entstanden ist. Der Groß-
stadtliterat und Großstadtkünstler schämt sich des Nippenburger Provinz-
geschmackes und verachtet ihn. Er schwätzt und salbadert endlos und ver-
zweifelt zuletzt, wenn seinen Bemühungen der Beifall vermag- bleibt,
ohne den er nicht zu leben vermag.
Und wenn nun wieder einmal einer von denen in die Stadt kommt,
der ihr nicht mit Haut uud Haaren verfällt, der seine Seele nicht verkauft
und verliert und der Art, von der er stammt, und dein Boden die Heimat-
treue bewahrt, dann schilt ihn der Asphaltmensch einen belang o'en Phi-
lister. Wi helm Raabe behält recht: der germanische Genius zog und zieht
einen groszen Teil seiner Kraft aus dem Philistertum, uud nicht wenige
unserer Besten stammten und stammen zu ihrem und dem Glück anderer
aus Nippenburg. Uud das Beste an ihnen gab diesen Männern die Heimat
und nicht die Großstadt, die in Wahrheit n r eine spektakelnde Karawan-
serei ist, in der nichts Innerliches zu gedeihen und zu reifen vermäg, denn
die ständige Unrast und schwankende Ziellosigkeit des Scheinlebens in den
groszen Städten verdirbt, verhunzt, vernichtet und verbraucht mehr Men-
schen, alsindermänner-
morderwsten Schlacht
geopfert werden. Der
Dichter Balzac nannte
das Paris seiner Zeit
das „faulendeGe schwür,
die Eiterbeule am Leibe
Frankreichs". Damals
war Berlin noch eine
Art Provinzstadt, und
doch klagten und spot¬
teten Dichter, Kompo¬
nisten, Maler und Bild¬
hauer über den Ungeist
derSpreeathener.Hein¬
rich Heine schrieb die
Verse:
„Verlas; Berlin mit
seinem dürren Sande,
Und dünnem Tee und
überwitz'gen Leuten,
DieGottund Welt,und
was sie selbstbrdeuten,
Begriffen längst mit
HegelschemVerstande.
Komm mit nach In¬
dien, nach dem Son¬
nenlande ..."
Welche Weltfremd¬
heit, welcher Bildungs¬
dünkel gehören dazu,
wenn dieGroszstadtgeister
einem vielarügen Volk
von Millionen zumu¬
ten, ihrer Ge chmacksdik-
tatur hörig zu werden.
Wie grotesk wirkt die
Entrüstung der Men¬
schen aus diesen Krei¬
sen, wenn das Volk sich
von ihnen abkehrt und
sich an jene Künstler
hält, die den innerlichen
Zusammenhang mit ihm
nie verloren haben, die
auch mr Weltstadtwirr-
sal ihre Herkunft nicht
vergessen können und
noch weniger wollen, ja,
die lich ihres anderen
Wesens erst im Trubel
des überhitzteu Lebens
klar bewuszt geworden
sind. Man mag über
„Heimatkunst" spotten,
aber nur dann g' chicht es mit Fug rm> R cht, wenn sie gemacht und ge-
wollt ist. Erweist sie sich als echt, dann wird kein ästhetischer Urteilspruch
ihr etwas anhaben können. Ludwig Richter, den das Volk liebte und noch
liebt, ist auch einer von den guten Nippenburgern gewesen, der sich seiner
Herkunft nicht schämte, sich selber und dem Heimalboden, der Muttererde,
treu blieb.
Uud auch Matthäus Schiestl* verkaufte und verlor seine Seele nicht, er
hat die Erinnerungen seiner Heimal und seiner Jugend nie preisgegeben,
und das ist seine Stärke. Als reifer Mann erhielt er sich treuherzigen Kinder-
sinn, und als Künstler verleugnete er nie sein früh gewonnenes inneres Ver-
hältnis zu deu gr szen Meistern unserer völkischen Vergangenheit, die ihm
einst zu Wegführern geworden waren, bis er im Laufe der eigenen Ent-
wicklung, geduldig und angestrengt arbeitend seine besondere Weise fand.
In Schiestls Kunst findet sich nicht der kleinste Zug, der an den Prunk
der Renaissance oder die pompche Geste und Äußerlichkeit eurer gewisser:
Barockmalerei gemahut. Er ist aber auch kein Gotiker. Seine schlichten
Ausdrucksformen widerstreben jeder schlagwortähnlichen Einordnung. Hier
soll kein langes und breites darüber geschrieben werden, was man als
deutsch im Widerspiel zu romanischer Art bezeichnen könnte. Nur das soll
betout werden: in deutscher Kunst stand und steht der innere Gehalt, der
seelische Ausdruck hoch über dem Suchen und Ringen nach äußerlich for-
maler Schönheit, vor allem der „schönen" Linie. Irgendwie war und ist
alle deutsche Kunst herb
und schlicht.
Beschautman die hei-
ligen drei Könige auf
Schiestls „Anbetung",
so findet sich an ihnen
kein fürstlicher Prunk,
mit dem sich fromme
Versunkenheit schwer
vereint. Tie dr i Män-
ner breiten nicht äußer-
lich blendende Schätze
vor der Mutter und
ihrem Kinde aus, die
beide von keinem Heili-
genschein umflimmert
sind. Maria trägt ein
schlichtes Kopftuch und
ein schmuckloses Kleid;
ihr Kind sitzt im Hemd-
chen auf ihrem Schoß
und hebt leise, unbe-
wußt segnend, dasrechte
Händchen, kinddahinter
steht breit und schlicht
unter wolkigem Him-
mel ein einfacher Fach-
werkbau; ein fränkisches
Bauernhaus, unter des-
sen Türe bescheiden
Sankt Joseph erscheint.
Wer fühlte sich da nicht
heimelig berührt, fernab
von allem fremd anmu-
tenden Formenprunk,
der den legendenhaften
Vorgang nur zu leicht
dem Gemüt entrückt.
Schiestl k nnt so gut
wie auoereItalien und
die Kunst der Renais-
sance ist ihm so wenig
fremd wie die dcr nach
ihr folgenden Epochen;
er war in Jerusalem an
den heiligen Stätten,
aber in seiner Kunst fin-
det sich daran nicht die
leiseste Erinnerung, kein
Zug gemahnt daran.
Befrachtet man nun
* E. Oßwald, Mat-
thäus Schiestl. Mün-
chen. Gcsellsch. z. christl.
Kunst, G. m. b. H., 1922.
Die heiligen drei Könige. Matthäus Schiehl.