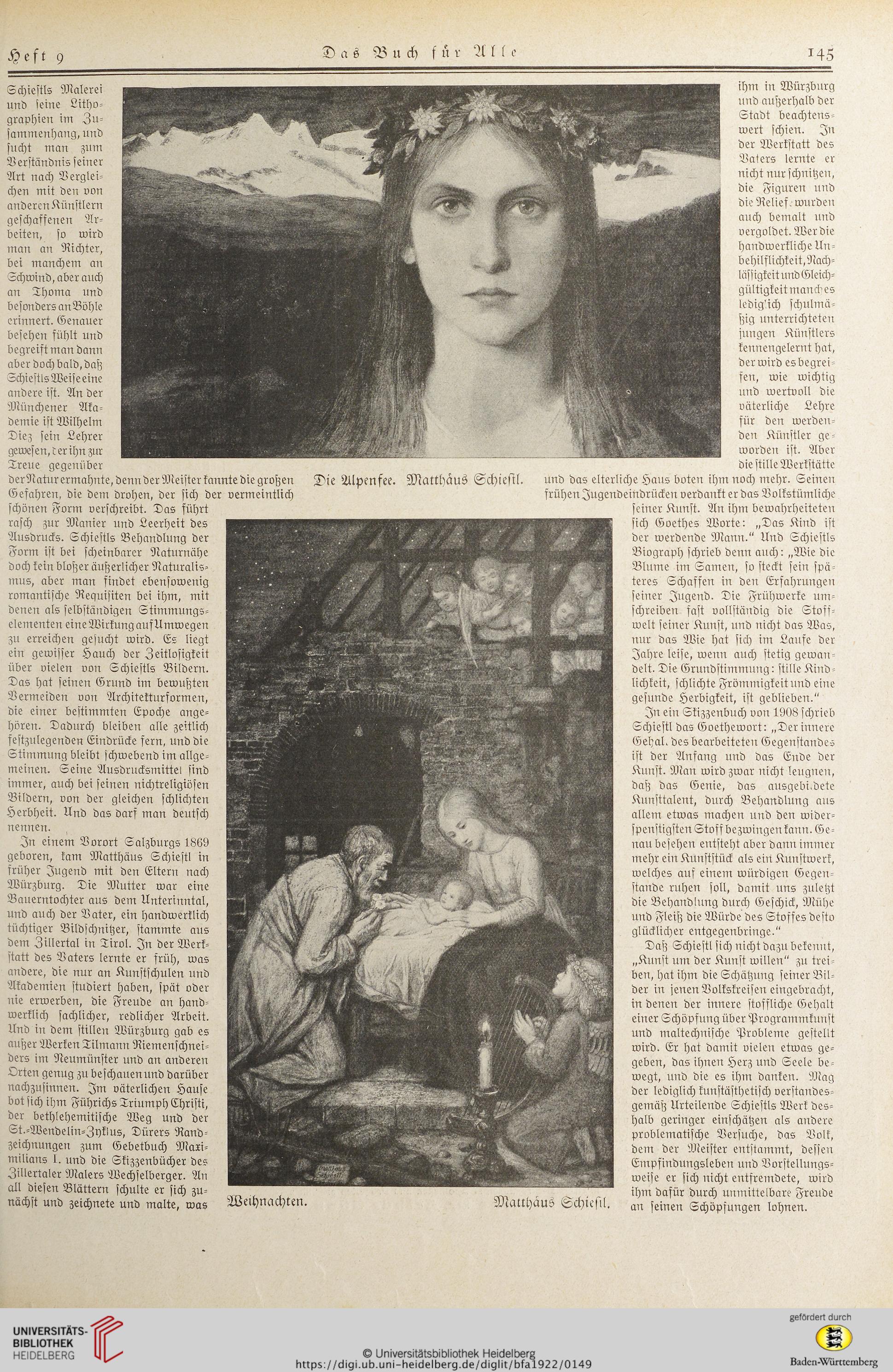Heft 9
Das B u ch fü r 'A l l e
145
Weihnachten.
Matthaus Schiefil.
-ihm in Würzburg
und außerhalb der
Stadt beachtens-
wert schien. In
der Werkstatt des
Vaters lernte er
nicht nur schnitzen,
die Figuren und
die Relief, wurden
auch bemalt und
vergoldet. Wer die
handwerkliche Un-
behilflichkeit,Nach-
lässigkeit und Gleich-
gültigkeit mamb es
ledig'ich schulmü-
ßig unterrichteten
jungen Künstlers
kennengelernt hat,
der wird esbegrei-
fen, wie wichtig
und wertvoll die
väterliche Lehre
für den werden-
den Künstler ge-
worden ist. Aber
die stille Werkstätte
und das elterliche Haus boteu ihm noch mehr. Seinen
frühen Jugendeindrücken verdankt er das Volkstümliche
seiner Kunst. An ihm bewahrheiteten
sich Goethes Worte: „Das Kind ist
der werdende Mann." Und Schiestls
Biograph schrieb denn anch: „Wie die
Blume im Samen, so steckt sein spä-
teres Schaffen in den Erfahrungen
seiner Jugend. Die Frühwerke um-
schreiben fast vollständig die Stoff-
welt seiner Kunst, und nicht das Was,
nur das Wie hat sich im Laufe der
Jahre leise, wenn auch stetig gewan-
delt. Die Grundstimmung: stille Kind-
lichkeit, schlichte Frömmigkeit und eine
gesunde Herbigkeit, ist geblieben."
In ein Skizzenbuch von 1908 schrieb
Schiestl das Goethewort: „Der innere
Eehal. des bearbeiteten Gegenstandes
ist der Anfang und das Ende der
Kunst. Man wird zwar nicht leugnen,
daß das Genie, das ausgebüdete
Kunsttalent, durch Behandlung aus
allem etwas machen und den wider-
spenstigsten Stoff bezwingen kann. Ge-
nau besehen entsteht aber dann immer
mehr ein Kunststück als ein Kunstwerk,
welches aus einem würdigen Gegen-
stände ruhen soll, damit uns zuletzt
die Behandlung durch Geschick, Mühe
und Fleiß die Würde des Stoffes desto
glücklicher entgegenbringe."
Daß Schiestl sich nicht dazu bekennt,
„Kunst um der Kunst willen" zu trei-
ben, hat ihm die Schätzung seiner Bil-
der in jenen Volkskreisen eingebracht,
in denen der innere stoffliche Gehalt
einer Schöpfung über Programmkunst
und maltechnische Probleme gestellt
wird. Er hat damit vielen etwas ge-
geben, das ihnen Herz und Seele be-
wegt, und die es ihm danken. Mag
der lediglich kunstästhetisch verstandes-
gemäß Urteilende Schiestls Werk des-
halb geringer einschätzen als andere
problematische Versuche, das Volk,
dem der Meister entstammt, dessen
Empfindungsleben und Vorstellungs-
weise er sich nicht entfremdete, wird
ihm dafür durch unmittelbare Freude
an seinen Schöpfungen lohnen.
Schiestls Malerei >
und seine Litho¬
graphien im Zu¬
sammenhang, und
sucht man zum j
Verständnis seiner
Art nach Verglei¬
chen mit den von
anderen Künstlern
geschaffenen Ar¬
beiten, so wird
man an Richter, s
bei manchem an
Schwind, aber auch
an Thoma und
besonders an Bühle
erinnert. Genauer §
besehen fühlt und
begreift man dann
aber doch bald, daß
Schiestls Weise eine l
andere ist. An der
Münchener Aka¬
demie ist Wilhelm -
Diez sein Lehrer !
gewesen, ter ihn zur j_
Treue gegenüber
derNaturermahnte,dennderMeisterkanntediegroßen Die Alpenfee. Matthäus Schiesäl.
Gefahren, die dem drohen, der sich der vermeintlich
schönen Form verschreibt. Das führt
rasch zur Manier und Leerheit des
Ausdrucks. Schiestls Behandlung der
Form ist bei scheinbarer Naturnähe
doch kein bloßer äußerlicher Naturalis¬
mus, aber man findet ebensowenig
romantische Requisiten bei ihm, mit
denen als selbständigen Stimmungs¬
elementen eine Wirkung aufUmwegen
zu erreichen gesucht wird. Es liegt
ein gewisser Hauch der Zeitlosigkeit
über vielen von Schiestls Bildern.
Das hat seinen Grund im bewußten
Vermeiden von Archikekturformen,
die einer bestimmten Epoche ange¬
hören. Dadurch bleiben alle zeitlich
festzulegenden Eindrücke fern, und die
Stimmung bleibt schwebend im allge¬
meinen. Seine Ausdrucksmittel sind
immer, auch bei seinen nichtreligiösen
Bildern, von der gleichen schlichten
Herbheit. Und das darf man deutsch
nennen.
In einem Vorort Salzburgs 1869
geboren, kam Matthäus Schiestl in
früher Jugend mit den Eltern nach
Würzburg. Die Mutter war eine
Bauerntochter aus dem Unterinntal,
und auch der Vater, ein handwerklich
tüchtiger Bildschnitzer, stammte aus
dem Zillertal in Tirol. In der Werk¬
statt des Vaters lernte er früh, was
andere, die nur an Kunstschulen und
Akademien studiert haben, spät oder
nie erwerben, die Freude an hand¬
werklich sachlicher, redlicher Arbeit.
Und in dem stillen Würzburg gab es
außer Werken Tilmann Riemenschnei¬
ders im Neumünster und an anderen
Orten genug zu beschauen und darüber
nachzusinnen. Im väterlichen Hause
bot sich ihm Führichs Triumph Christi,
der bethlehemitische Weg und der
St.-Wendelin-Zyklus, Dürers Rand¬
zeichnungen zum Gebetbuch Mari-
milians 1. und die Skizzenbücher des
Zillertaler Malers Wechselberger. An
all diesen Blättern schulte er sich zu¬
nächst und zeichnete und malte, was
Das B u ch fü r 'A l l e
145
Weihnachten.
Matthaus Schiefil.
-ihm in Würzburg
und außerhalb der
Stadt beachtens-
wert schien. In
der Werkstatt des
Vaters lernte er
nicht nur schnitzen,
die Figuren und
die Relief, wurden
auch bemalt und
vergoldet. Wer die
handwerkliche Un-
behilflichkeit,Nach-
lässigkeit und Gleich-
gültigkeit mamb es
ledig'ich schulmü-
ßig unterrichteten
jungen Künstlers
kennengelernt hat,
der wird esbegrei-
fen, wie wichtig
und wertvoll die
väterliche Lehre
für den werden-
den Künstler ge-
worden ist. Aber
die stille Werkstätte
und das elterliche Haus boteu ihm noch mehr. Seinen
frühen Jugendeindrücken verdankt er das Volkstümliche
seiner Kunst. An ihm bewahrheiteten
sich Goethes Worte: „Das Kind ist
der werdende Mann." Und Schiestls
Biograph schrieb denn anch: „Wie die
Blume im Samen, so steckt sein spä-
teres Schaffen in den Erfahrungen
seiner Jugend. Die Frühwerke um-
schreiben fast vollständig die Stoff-
welt seiner Kunst, und nicht das Was,
nur das Wie hat sich im Laufe der
Jahre leise, wenn auch stetig gewan-
delt. Die Grundstimmung: stille Kind-
lichkeit, schlichte Frömmigkeit und eine
gesunde Herbigkeit, ist geblieben."
In ein Skizzenbuch von 1908 schrieb
Schiestl das Goethewort: „Der innere
Eehal. des bearbeiteten Gegenstandes
ist der Anfang und das Ende der
Kunst. Man wird zwar nicht leugnen,
daß das Genie, das ausgebüdete
Kunsttalent, durch Behandlung aus
allem etwas machen und den wider-
spenstigsten Stoff bezwingen kann. Ge-
nau besehen entsteht aber dann immer
mehr ein Kunststück als ein Kunstwerk,
welches aus einem würdigen Gegen-
stände ruhen soll, damit uns zuletzt
die Behandlung durch Geschick, Mühe
und Fleiß die Würde des Stoffes desto
glücklicher entgegenbringe."
Daß Schiestl sich nicht dazu bekennt,
„Kunst um der Kunst willen" zu trei-
ben, hat ihm die Schätzung seiner Bil-
der in jenen Volkskreisen eingebracht,
in denen der innere stoffliche Gehalt
einer Schöpfung über Programmkunst
und maltechnische Probleme gestellt
wird. Er hat damit vielen etwas ge-
geben, das ihnen Herz und Seele be-
wegt, und die es ihm danken. Mag
der lediglich kunstästhetisch verstandes-
gemäß Urteilende Schiestls Werk des-
halb geringer einschätzen als andere
problematische Versuche, das Volk,
dem der Meister entstammt, dessen
Empfindungsleben und Vorstellungs-
weise er sich nicht entfremdete, wird
ihm dafür durch unmittelbare Freude
an seinen Schöpfungen lohnen.
Schiestls Malerei >
und seine Litho¬
graphien im Zu¬
sammenhang, und
sucht man zum j
Verständnis seiner
Art nach Verglei¬
chen mit den von
anderen Künstlern
geschaffenen Ar¬
beiten, so wird
man an Richter, s
bei manchem an
Schwind, aber auch
an Thoma und
besonders an Bühle
erinnert. Genauer §
besehen fühlt und
begreift man dann
aber doch bald, daß
Schiestls Weise eine l
andere ist. An der
Münchener Aka¬
demie ist Wilhelm -
Diez sein Lehrer !
gewesen, ter ihn zur j_
Treue gegenüber
derNaturermahnte,dennderMeisterkanntediegroßen Die Alpenfee. Matthäus Schiesäl.
Gefahren, die dem drohen, der sich der vermeintlich
schönen Form verschreibt. Das führt
rasch zur Manier und Leerheit des
Ausdrucks. Schiestls Behandlung der
Form ist bei scheinbarer Naturnähe
doch kein bloßer äußerlicher Naturalis¬
mus, aber man findet ebensowenig
romantische Requisiten bei ihm, mit
denen als selbständigen Stimmungs¬
elementen eine Wirkung aufUmwegen
zu erreichen gesucht wird. Es liegt
ein gewisser Hauch der Zeitlosigkeit
über vielen von Schiestls Bildern.
Das hat seinen Grund im bewußten
Vermeiden von Archikekturformen,
die einer bestimmten Epoche ange¬
hören. Dadurch bleiben alle zeitlich
festzulegenden Eindrücke fern, und die
Stimmung bleibt schwebend im allge¬
meinen. Seine Ausdrucksmittel sind
immer, auch bei seinen nichtreligiösen
Bildern, von der gleichen schlichten
Herbheit. Und das darf man deutsch
nennen.
In einem Vorort Salzburgs 1869
geboren, kam Matthäus Schiestl in
früher Jugend mit den Eltern nach
Würzburg. Die Mutter war eine
Bauerntochter aus dem Unterinntal,
und auch der Vater, ein handwerklich
tüchtiger Bildschnitzer, stammte aus
dem Zillertal in Tirol. In der Werk¬
statt des Vaters lernte er früh, was
andere, die nur an Kunstschulen und
Akademien studiert haben, spät oder
nie erwerben, die Freude an hand¬
werklich sachlicher, redlicher Arbeit.
Und in dem stillen Würzburg gab es
außer Werken Tilmann Riemenschnei¬
ders im Neumünster und an anderen
Orten genug zu beschauen und darüber
nachzusinnen. Im väterlichen Hause
bot sich ihm Führichs Triumph Christi,
der bethlehemitische Weg und der
St.-Wendelin-Zyklus, Dürers Rand¬
zeichnungen zum Gebetbuch Mari-
milians 1. und die Skizzenbücher des
Zillertaler Malers Wechselberger. An
all diesen Blättern schulte er sich zu¬
nächst und zeichnete und malte, was