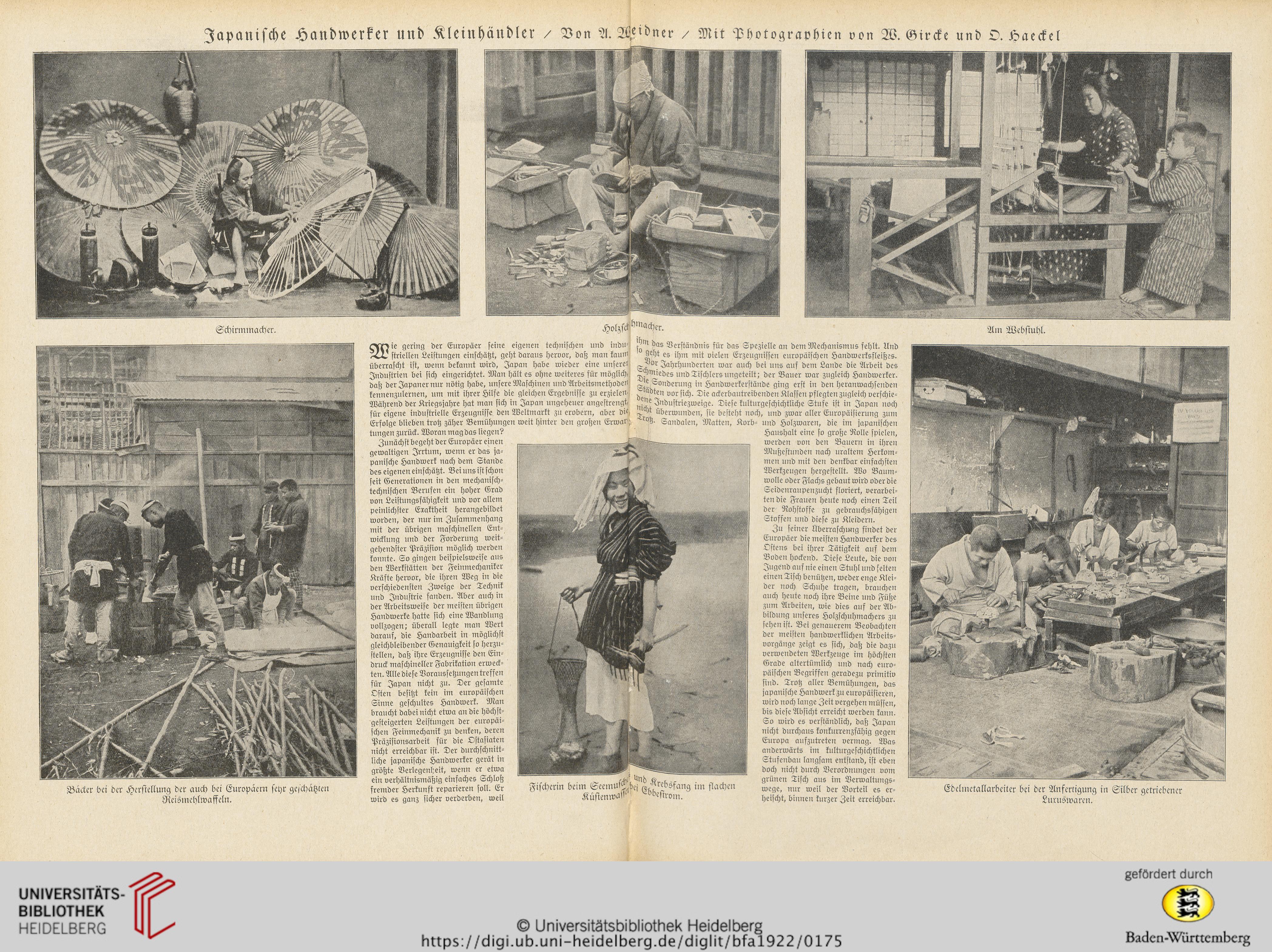Japanische Handwerker und Kleinhändler / Von A. Ä.eidner / Mit Photographien von W. Gircke und O. Haeckel
Schirmmacher.
Barter bei der Herstellung der auch bei Europäern seyr geschätzten
Reismehlwaffeln.
"«evvaunven, pe oegey: nv,
^otz. Sandalen, Matten, Korb
das Verständnis für das Spezielle an dem Mechanismus fehlt. Und
6cht es ihm mit vielen Erzeugnissen europäischen Handwerksfleißes.
Vox Jahrhunderten war auch bei uns auf dem Lande die Arbeit des
^.lwiedes und Tischlers ungeteilt; der Bauer war zugleich Handwerker.
Sonderung in Handwerkerstände ging erst in den Heranwachsenden
^ten vor sich. Die ackerbautreibenden Klassen pflegten zugleich verschie-
ni^ Industriezweige. Diese kulturgeschichtliche Stufe ist in Japan noch
u überwunden, sie besteht noch, und zwar aller Europäisierung zum
oh. Sandalen, Matten, Korb- und Holzwaren, die im japanischen
Haushalt eine so große Nolle spielen,
-—.__ werden von den Bauern in ihren
Mußestunden nach uraltem Herkom-
men und mit den denkbar einfachsten
Werkzeugen hergestellt. Wo Baum-
wolle oder Flachs gebaut wird oder die
Seidenraupenzucht floriert, verarbei-
ten die Frauen heute noch einen Teil
der Rohstoffe zu gebrauchsfähigen
Stoffen und diese zu Kleidern.
Zu seiner llberraschrmg findet der
Europäer die meisten Handwerker des
Ostens bei ihrer Tätigkeit auf dem
Holzsff^acher>.
^V^ie gering der Europäer seine eigenen technischen und indm
striellen Leistungen einschätzt, geht daraus hervor, daß man kaum
überrascht ist, wenn bekannt wird, Japan habe wieder eine unserer
Industrien bei sich eingerichtet. Man hält es ohne weiteres für möglich,
daß der Japaner nur nötig habe, unsere Maschinen und Arbeitsmethoden
kennenzulernen, um mit ihrer Hilfe die gleichen Ergebnisse zu erzielen.
Während der Kriegsjahre hat man sich in Japan ungeheuer angestrengt,
für eigene industrielle Erzeugnisse den Weltmarkt zu erobern, aber dih
Erfolge blieben trotz zäher Bemühungen weit hinter den großen ErwaH
tungen zurück. Woran mag das liegen?
Zunächst begeht der Europäer einen
gewaltigen Irrtum, wenn er das ja-
panische Handwerk nach dem Stande
des eigenen einschätzt. Bei uns ist schon
seit Generationen in den mechanisch-
technischen Berufen ein hoher Grad
von Leistungsfähigkeit und vor allem
peinlichster Exaktheit herangebildet
worden, der nur im Zusammenhang
mit der übrigen maschinellen Ent-
wicklung und der Forderung weit-
gehendster Präzision möglich werden
konnte. So gingen beispielsweise aus
den Werkstätten der Feinmechaniker
Kräfte hervor, die ihren Weg in die
verschiedensten Zweige der Technik
und Industrie fanden. Aber auch in
der Arbeitsweise der meisten übriger:
Handwerke hatte sich eine Wandlung
vollzogen; überall legte man Wert
darauf, die Handarbeit in möglichst
gleichbleibender Genauigkeit so herzu-
stellen, daß ihre Erzeugnisse den Ein-
druck maschineller Fabrikation erweck-
ten. Alle diese Voraussetzungen treffen
für Japan nicht zu. Der gesamte
Osten besitzt kein im europäischen
Sinne geschultes Handwerk. Man
braucht dabei nicht etwa an die höchst-
gesteigerten Leistungen der europäi-
schen Feinmechanik zu denken, deren
Präzisionsarbeit für die Ostasiaten
nicht erreichbar ist. Der durchschnitt-
liche japanische Handwerker gerät in
größte Verlegenheit, wenn er etwa
ein verhältnismäßig einfaches Schloß
fremder Herkunft reparieren soll. Er
wird es ganz sicher verderben, weil
Boden hockend. Diese Leute, die von
Jugend auf nie einen Stuhl und selten
einen Tisch benützen, weder enge Klei-
der noch Schnhe tragen, brauchen
anch heute noch ihre Beine und Füße
zum Arbeiten, wie dies auf der Ab-
bildung unseres Holzschuhmachers zu
sehen ist. Bei genauerem Beobachten
der meisten handwerklichen Arbeits-
vorgänge zeigt es sich, daß die dazu
verwendeten Werkzeuge im höchsten
Grade altertümlich und nach euro-
päischen Begriffen geradezu primitiv
sind. Trotz aller Bemühungen, das
japanische Handwerk zu europäisieren,
wird noch lange Zeit vergehen müssen,
bis diese Absicht erreicht werden kann.
So wird es verständlich, daß Japan
nicht durchaus konkurrenzfähig gegen
Europa auszutreten vermag. Was
anderwärts im kulturgeschichtlichen
Ctufenban langsam entstand, ist eben
doch nicht durch Verordnungen vom
grüner: Tisch aus im Verwaltungs-
wege, nur weil der Vorteil es er-
heischt, binnen kurzer Zeit erreichbar.
Fischerin beim Seeiuu^bej^ '^kebsfang im flachen
Küstenw^ ^bestrom.'
Ain Webstuhl.
Edelmetallarbeüer bei der Anfertigung in Silber getriebener
Luruswaren.
Schirmmacher.
Barter bei der Herstellung der auch bei Europäern seyr geschätzten
Reismehlwaffeln.
"«evvaunven, pe oegey: nv,
^otz. Sandalen, Matten, Korb
das Verständnis für das Spezielle an dem Mechanismus fehlt. Und
6cht es ihm mit vielen Erzeugnissen europäischen Handwerksfleißes.
Vox Jahrhunderten war auch bei uns auf dem Lande die Arbeit des
^.lwiedes und Tischlers ungeteilt; der Bauer war zugleich Handwerker.
Sonderung in Handwerkerstände ging erst in den Heranwachsenden
^ten vor sich. Die ackerbautreibenden Klassen pflegten zugleich verschie-
ni^ Industriezweige. Diese kulturgeschichtliche Stufe ist in Japan noch
u überwunden, sie besteht noch, und zwar aller Europäisierung zum
oh. Sandalen, Matten, Korb- und Holzwaren, die im japanischen
Haushalt eine so große Nolle spielen,
-—.__ werden von den Bauern in ihren
Mußestunden nach uraltem Herkom-
men und mit den denkbar einfachsten
Werkzeugen hergestellt. Wo Baum-
wolle oder Flachs gebaut wird oder die
Seidenraupenzucht floriert, verarbei-
ten die Frauen heute noch einen Teil
der Rohstoffe zu gebrauchsfähigen
Stoffen und diese zu Kleidern.
Zu seiner llberraschrmg findet der
Europäer die meisten Handwerker des
Ostens bei ihrer Tätigkeit auf dem
Holzsff^acher>.
^V^ie gering der Europäer seine eigenen technischen und indm
striellen Leistungen einschätzt, geht daraus hervor, daß man kaum
überrascht ist, wenn bekannt wird, Japan habe wieder eine unserer
Industrien bei sich eingerichtet. Man hält es ohne weiteres für möglich,
daß der Japaner nur nötig habe, unsere Maschinen und Arbeitsmethoden
kennenzulernen, um mit ihrer Hilfe die gleichen Ergebnisse zu erzielen.
Während der Kriegsjahre hat man sich in Japan ungeheuer angestrengt,
für eigene industrielle Erzeugnisse den Weltmarkt zu erobern, aber dih
Erfolge blieben trotz zäher Bemühungen weit hinter den großen ErwaH
tungen zurück. Woran mag das liegen?
Zunächst begeht der Europäer einen
gewaltigen Irrtum, wenn er das ja-
panische Handwerk nach dem Stande
des eigenen einschätzt. Bei uns ist schon
seit Generationen in den mechanisch-
technischen Berufen ein hoher Grad
von Leistungsfähigkeit und vor allem
peinlichster Exaktheit herangebildet
worden, der nur im Zusammenhang
mit der übrigen maschinellen Ent-
wicklung und der Forderung weit-
gehendster Präzision möglich werden
konnte. So gingen beispielsweise aus
den Werkstätten der Feinmechaniker
Kräfte hervor, die ihren Weg in die
verschiedensten Zweige der Technik
und Industrie fanden. Aber auch in
der Arbeitsweise der meisten übriger:
Handwerke hatte sich eine Wandlung
vollzogen; überall legte man Wert
darauf, die Handarbeit in möglichst
gleichbleibender Genauigkeit so herzu-
stellen, daß ihre Erzeugnisse den Ein-
druck maschineller Fabrikation erweck-
ten. Alle diese Voraussetzungen treffen
für Japan nicht zu. Der gesamte
Osten besitzt kein im europäischen
Sinne geschultes Handwerk. Man
braucht dabei nicht etwa an die höchst-
gesteigerten Leistungen der europäi-
schen Feinmechanik zu denken, deren
Präzisionsarbeit für die Ostasiaten
nicht erreichbar ist. Der durchschnitt-
liche japanische Handwerker gerät in
größte Verlegenheit, wenn er etwa
ein verhältnismäßig einfaches Schloß
fremder Herkunft reparieren soll. Er
wird es ganz sicher verderben, weil
Boden hockend. Diese Leute, die von
Jugend auf nie einen Stuhl und selten
einen Tisch benützen, weder enge Klei-
der noch Schnhe tragen, brauchen
anch heute noch ihre Beine und Füße
zum Arbeiten, wie dies auf der Ab-
bildung unseres Holzschuhmachers zu
sehen ist. Bei genauerem Beobachten
der meisten handwerklichen Arbeits-
vorgänge zeigt es sich, daß die dazu
verwendeten Werkzeuge im höchsten
Grade altertümlich und nach euro-
päischen Begriffen geradezu primitiv
sind. Trotz aller Bemühungen, das
japanische Handwerk zu europäisieren,
wird noch lange Zeit vergehen müssen,
bis diese Absicht erreicht werden kann.
So wird es verständlich, daß Japan
nicht durchaus konkurrenzfähig gegen
Europa auszutreten vermag. Was
anderwärts im kulturgeschichtlichen
Ctufenban langsam entstand, ist eben
doch nicht durch Verordnungen vom
grüner: Tisch aus im Verwaltungs-
wege, nur weil der Vorteil es er-
heischt, binnen kurzer Zeit erreichbar.
Fischerin beim Seeiuu^bej^ '^kebsfang im flachen
Küstenw^ ^bestrom.'
Ain Webstuhl.
Edelmetallarbeüer bei der Anfertigung in Silber getriebener
Luruswaren.