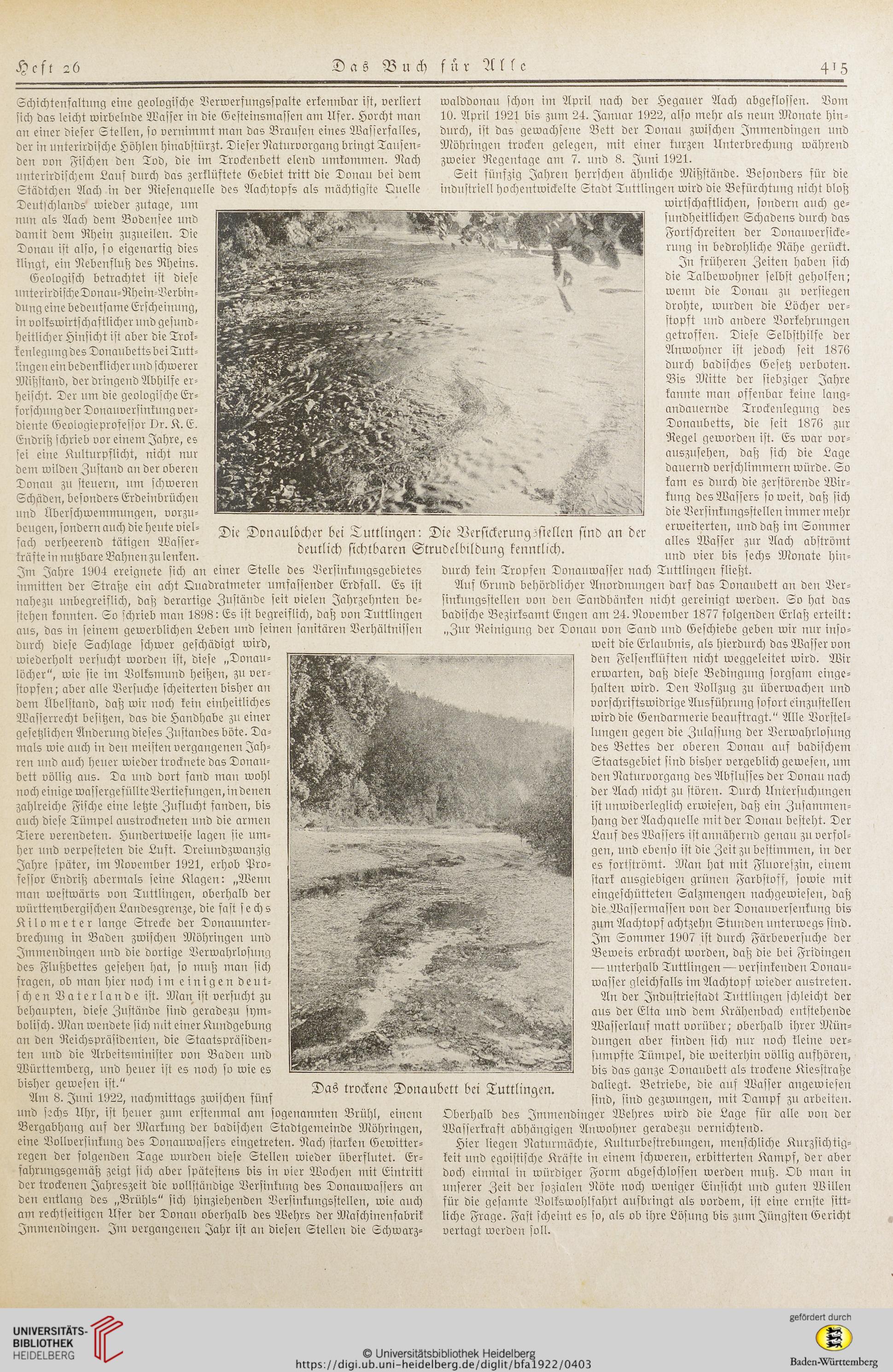Heft 2Ü
Das Buch für Alle
4'5
Schichtenfaltung eine geologische Verwerfungsspalte erkennbar ist, verliert
sich das leicht wirbelnde Wasser in die Eesteinsrnassen am Ufer. Horcht man
an einer dieser Stellen, so vernimmt man das Brausen eines Wasserfalles,
der in unterirdische Höhlen hinabstürzt. Dieser Naturvorgang bringt Tausen-
den von Fischen den Tod, die im Trockenbett elend umkommen. Nach
unterirdischem Lauf durch das zerklüftete Gebiet tritt die Donau bei dem
Städtchen Aach in der Riesenquelle des Aachtopfs als mächtigste Quelle
Deutschlands wieder zutage, um
nun als Aach dem Bodensee und
damit dem Rhein zuzueilen. Die
Donau ist also, so eigenartig dies
klingt, ein Nebenfluß des Rheins.
Geologisch betrachtet ist diese
unterirdischeDonau-Rhein-Verbin-
dung eine bedeutsame Erscheinung,
in volkswirtschaftlicher und gesund¬
heitlicher Hinsicht ist aber die Trok-
kenlegung des Donaubetts bei Tutt¬
lingen ein bedenklicher und schwerer
Mißstand, der dringend Abhilfe er¬
heischt. Der um die geologische Er -
forschuug der Douauversinkung ver¬
diente Eeologieprofessor Or. 5k. E.
Endriß schrieb vor einem Jahre, es
sei eine Kulturpflicht, nicht nur
dem wilden Zustand an der oberen
Donau zu steuern, um schweren
Schäden, besonders Erdeinbrüchen
und Überschwemmungen, vorzu¬
beugen, sondern auch die heute viel¬
fach verheerend tätigen Wasser¬
kräfte in nu hbare Bahuen zu lenken.
Im Jahre 1904 ereignete sich an einer Stelle des Versinkuugsgebietes
inmitten der Straße ein acht Quadratmeter umfassender Erdfall. Es ist
nahezu unbegreiflich, daß derartige Zustände seit vielen Jahrzehnten be-
stehen konnten. So schrieb man 1898: Es ist begreiflich, daß von Tuttlingen
aus, das in seinem gewerblichen Leben und seinen sanitären Verhältnissen
durch diese Sachlage schwer geschädigt wird,
wiederholt versucht worden ist, diese „Donau¬
löcher", wie sie im Volksmund heißen, zu ver¬
stopfen; aber alle Versuche scheiterten bisher an
dem Übelstand, daß wir noch kein einheitliches
Wasserrecht besitzen, das die Handhabe zu einer¬
gesetzlichen Änderung dieses Zustandes böte. Da¬
mals wie auch in den meisten vergangenen Jah¬
ren und auch Heuer wieder trocknete das Donau¬
bett völlig aus. Da und dort fand mau wohl
noch einige wassergefüllteVertiefungenZndenen
zahlreiche Fische eine letzte Zuflucht fanden, bis
auch diese Tümpel austrockneten und die armen
Tiere verendeten. Hundertweise lagen sie um¬
her und verpesteten die Luft. Dreiundzwauzig
Jahre später, im November 1921, erhob Pro¬
fessor Endriß abermals seine Klagen: „Wenn
man westwärts von Tuttlingen, oberhalb der
württembergischen Landesgrenze, die fast sechs
Kilometer lange Strecke der Donauunter¬
brechung in Baden Zwischen Möhringen und
Immendingen und die dortige Verwahrlosung
des Flußbettes gesehen hat, so muß man sich
fragen, ob man hier noch im einigen deut¬
schen Vater lande ist. Man ist versucht zu
behaupten, diese Zustände sind geradezu sym¬
bolisch. Man wendete sich mit einer Kundgebung
an den Reichspräsidenten, die Staatspräsiden¬
ten und die Arbeitsminister von Baden und
Württemberg, und Heuer ist es noch so wie es
bisher gewesen ist."
Am 8. Juni 1922, nachmittags zwischen fünf
und sechs Uhr, ist Heuer zum erstenmal am sogenannten Brühl, einem
Bergabhang auf der Markung der badischen Stadtgemeinde Möhringen,
eine Vollversinkung des Donauwassers eingetreten. Nach starken Gewitter-
regen der folgenden Tage wurden diese Stellen wieder überflutet. Er-
fahrungsgemäß zeigt sich aber spätestens bis in vier Wochen mit Eintritt
der trockenen Jahreszeit die vollständige Versinkung des Donauwassers an
den entlang des „Brühls" sich hinziehenden Versinkungsstellen, wie auch
am rechtseitigen Ufer der Donau oberhalb des Wehrs der Maschinenfabrik
Immendingen. Im vergangenen Jahr ist an diesen Stellen die Schwarz-
walddonau schon im April nach der Hegauer Aach abgeflossen. Vom
10. April 1921 bis zum 24. Januar 1922, also mehr als neun Monate hin-
durch, ist das gewachsene Bett der Donau zwischen Immendingen und
Möhringen trocken gelegen, mit einer kurzen Unterbrechung während
zweier Regentage am 7. und 8. Juni 1921.
Seit fünfzig Jahren herrschen ähnliche Mißstände. Besonders für die
industriell hochentwickelte Stadt Tuttlingen wird die Befürchtung nicht bloß
wirtschaftlichen, sondern auch ge-
sundheitlichen Schadens durch das
Fortschreiten der Donauversicke-
rung in bedrohliche Nähe gerückt.
In früheren Zeiten haben sich
die Talbewohner selbst geholfen;
wenn die Donau zu versiegen
drohte, wurden die Löcher ver-
stopft und andere Vorkehrungen
getroffen. Diese Selbsthilfe der
Anwohner ist jedoch seit 1876
durch badisches Gesetz verboten.
Bis Mitte der siebziger Jahre
kannte man offenbar keine lang-
andauernde Trockenlegung des
Donaubetts, die seit 1876 zur
Regel geworden ist. Es war vor-
auszusehen, daß sich die Lage
dauernd verschlimmern würde. So
kam es durch die zerstörende Wir-
kung des Wassers soweit, daß sich
die Versinkungsstellen immer mehr
erweiterten, und daß im Sommer
alles Wasser zur Aach abströmt
und vier bis sechs Monate hin-
durch kein Tropfen Donauwasser nach Tuttlingen fließt.
Auf Grund behördlicher Anordnungen darf das Donaubett an den Ver-
sinkungsstellen von den Sandbänken nicht gereinigt werden. So hat das
badische Bezirksamt Engen am 24. November 1877 folgenden Erlaß erteilt:
„Zur Reinigung der Donau von Sand und Geschiebe geben wir nur inso-
weit die Erlaubnis, als hierdurch das Wasser von
den Felsenklüften nicht weggeleitet wird. Wir
erwarten, daß diese Bedingung sorgsam einge-
halten wird. Den Vollzug zu überwachen und
vorschriftswidrige Ausführung sofort einzustellen
wird die Gendarmerie beauftragt." Alle Vorstel-
lungen gegen die Zulassung der Verwahrlosung
des Bettes der oberen Donau auf badischem
Staatsgebiet sind bisher vergeblich gewesen, um
den Naturvorgang des Abflusses der Donau nach
der Aach nicht zu stören. Durch Untersuchungen
ist unwiderleglich erwiesen, daß ein Zusammen-
hang der Aachquelle mit der Donau besteht. Der
Lauf des Wassers ist annähernd genau zu verfol-
gen, und ebenso ist die Zeit zu bestimmen, in der
es fortströmt. Man hat mit Fluoreszin, einem
stark ausgiebigen grünen Farbstoff, sowie mit
eingeschütteten Salzmengen nachgewiesen, daß
die Wassermassen von der Donauversenkung bis
zum Aachtopf achtzehn Stunden unterwegs sind.
Im Sommer 1907 ist durch Färbeversuche der
Beweis erbracht worden, daß die bei Fridingen
— unterhalb Tuttlingen — versinkenden Donau-
wasser gleichfalls im Aachtopf wieder austreten.
An der Industriestadt Tuttlingen schleicht der
aus der Elta und dem Krähenbach entstehende
Wasserlauf matt vorüber; oberhalb ihrer Mün-
dungen aber finden sich nur noch kleine ver-
sumpfte Tümpel, die weiterhin völlig aufhören,
bis das ganze Donaubett als trockene Kiesstraße
daliegt. Betriebe, die auf Wasser angewiesen
sind, sind gezwungen, mit Dampf zu arbeiten.
Oberhalb des Jmmendinger Wehres wird die Lage für alle von der
Wasserkraft abhängigen Anwohner geradezu vernichtend.
Hier liegen Naturmächte, Kulturbestrebungen, menschliche Kurzsichtig-
keit und egoistische Kräfte in einem schweren, erbitterten Kampf, der aber
doch einmal in würdiger Form abgeschlossen werden muß. Ob man in
unserer Zeit der sozialen Nöte noch weniger Einsicht und guten Willen
für die gefaulte Volkswohlfahrt ausbringt als vordem, ist eine ernste sitt-
liche Frage. Fast scheint es so, als ob ihre Lösung bis zum Jüngsten Gericht
vertagt werden soll.
Die Donaulöcher bei Tuttlingen: Die Versickerung rstellen sind an der
deutlich sichtbaren Strudelbildung kenntlich.
Das trockene Donaubett bei Tuttlingen.
Das Buch für Alle
4'5
Schichtenfaltung eine geologische Verwerfungsspalte erkennbar ist, verliert
sich das leicht wirbelnde Wasser in die Eesteinsrnassen am Ufer. Horcht man
an einer dieser Stellen, so vernimmt man das Brausen eines Wasserfalles,
der in unterirdische Höhlen hinabstürzt. Dieser Naturvorgang bringt Tausen-
den von Fischen den Tod, die im Trockenbett elend umkommen. Nach
unterirdischem Lauf durch das zerklüftete Gebiet tritt die Donau bei dem
Städtchen Aach in der Riesenquelle des Aachtopfs als mächtigste Quelle
Deutschlands wieder zutage, um
nun als Aach dem Bodensee und
damit dem Rhein zuzueilen. Die
Donau ist also, so eigenartig dies
klingt, ein Nebenfluß des Rheins.
Geologisch betrachtet ist diese
unterirdischeDonau-Rhein-Verbin-
dung eine bedeutsame Erscheinung,
in volkswirtschaftlicher und gesund¬
heitlicher Hinsicht ist aber die Trok-
kenlegung des Donaubetts bei Tutt¬
lingen ein bedenklicher und schwerer
Mißstand, der dringend Abhilfe er¬
heischt. Der um die geologische Er -
forschuug der Douauversinkung ver¬
diente Eeologieprofessor Or. 5k. E.
Endriß schrieb vor einem Jahre, es
sei eine Kulturpflicht, nicht nur
dem wilden Zustand an der oberen
Donau zu steuern, um schweren
Schäden, besonders Erdeinbrüchen
und Überschwemmungen, vorzu¬
beugen, sondern auch die heute viel¬
fach verheerend tätigen Wasser¬
kräfte in nu hbare Bahuen zu lenken.
Im Jahre 1904 ereignete sich an einer Stelle des Versinkuugsgebietes
inmitten der Straße ein acht Quadratmeter umfassender Erdfall. Es ist
nahezu unbegreiflich, daß derartige Zustände seit vielen Jahrzehnten be-
stehen konnten. So schrieb man 1898: Es ist begreiflich, daß von Tuttlingen
aus, das in seinem gewerblichen Leben und seinen sanitären Verhältnissen
durch diese Sachlage schwer geschädigt wird,
wiederholt versucht worden ist, diese „Donau¬
löcher", wie sie im Volksmund heißen, zu ver¬
stopfen; aber alle Versuche scheiterten bisher an
dem Übelstand, daß wir noch kein einheitliches
Wasserrecht besitzen, das die Handhabe zu einer¬
gesetzlichen Änderung dieses Zustandes böte. Da¬
mals wie auch in den meisten vergangenen Jah¬
ren und auch Heuer wieder trocknete das Donau¬
bett völlig aus. Da und dort fand mau wohl
noch einige wassergefüllteVertiefungenZndenen
zahlreiche Fische eine letzte Zuflucht fanden, bis
auch diese Tümpel austrockneten und die armen
Tiere verendeten. Hundertweise lagen sie um¬
her und verpesteten die Luft. Dreiundzwauzig
Jahre später, im November 1921, erhob Pro¬
fessor Endriß abermals seine Klagen: „Wenn
man westwärts von Tuttlingen, oberhalb der
württembergischen Landesgrenze, die fast sechs
Kilometer lange Strecke der Donauunter¬
brechung in Baden Zwischen Möhringen und
Immendingen und die dortige Verwahrlosung
des Flußbettes gesehen hat, so muß man sich
fragen, ob man hier noch im einigen deut¬
schen Vater lande ist. Man ist versucht zu
behaupten, diese Zustände sind geradezu sym¬
bolisch. Man wendete sich mit einer Kundgebung
an den Reichspräsidenten, die Staatspräsiden¬
ten und die Arbeitsminister von Baden und
Württemberg, und Heuer ist es noch so wie es
bisher gewesen ist."
Am 8. Juni 1922, nachmittags zwischen fünf
und sechs Uhr, ist Heuer zum erstenmal am sogenannten Brühl, einem
Bergabhang auf der Markung der badischen Stadtgemeinde Möhringen,
eine Vollversinkung des Donauwassers eingetreten. Nach starken Gewitter-
regen der folgenden Tage wurden diese Stellen wieder überflutet. Er-
fahrungsgemäß zeigt sich aber spätestens bis in vier Wochen mit Eintritt
der trockenen Jahreszeit die vollständige Versinkung des Donauwassers an
den entlang des „Brühls" sich hinziehenden Versinkungsstellen, wie auch
am rechtseitigen Ufer der Donau oberhalb des Wehrs der Maschinenfabrik
Immendingen. Im vergangenen Jahr ist an diesen Stellen die Schwarz-
walddonau schon im April nach der Hegauer Aach abgeflossen. Vom
10. April 1921 bis zum 24. Januar 1922, also mehr als neun Monate hin-
durch, ist das gewachsene Bett der Donau zwischen Immendingen und
Möhringen trocken gelegen, mit einer kurzen Unterbrechung während
zweier Regentage am 7. und 8. Juni 1921.
Seit fünfzig Jahren herrschen ähnliche Mißstände. Besonders für die
industriell hochentwickelte Stadt Tuttlingen wird die Befürchtung nicht bloß
wirtschaftlichen, sondern auch ge-
sundheitlichen Schadens durch das
Fortschreiten der Donauversicke-
rung in bedrohliche Nähe gerückt.
In früheren Zeiten haben sich
die Talbewohner selbst geholfen;
wenn die Donau zu versiegen
drohte, wurden die Löcher ver-
stopft und andere Vorkehrungen
getroffen. Diese Selbsthilfe der
Anwohner ist jedoch seit 1876
durch badisches Gesetz verboten.
Bis Mitte der siebziger Jahre
kannte man offenbar keine lang-
andauernde Trockenlegung des
Donaubetts, die seit 1876 zur
Regel geworden ist. Es war vor-
auszusehen, daß sich die Lage
dauernd verschlimmern würde. So
kam es durch die zerstörende Wir-
kung des Wassers soweit, daß sich
die Versinkungsstellen immer mehr
erweiterten, und daß im Sommer
alles Wasser zur Aach abströmt
und vier bis sechs Monate hin-
durch kein Tropfen Donauwasser nach Tuttlingen fließt.
Auf Grund behördlicher Anordnungen darf das Donaubett an den Ver-
sinkungsstellen von den Sandbänken nicht gereinigt werden. So hat das
badische Bezirksamt Engen am 24. November 1877 folgenden Erlaß erteilt:
„Zur Reinigung der Donau von Sand und Geschiebe geben wir nur inso-
weit die Erlaubnis, als hierdurch das Wasser von
den Felsenklüften nicht weggeleitet wird. Wir
erwarten, daß diese Bedingung sorgsam einge-
halten wird. Den Vollzug zu überwachen und
vorschriftswidrige Ausführung sofort einzustellen
wird die Gendarmerie beauftragt." Alle Vorstel-
lungen gegen die Zulassung der Verwahrlosung
des Bettes der oberen Donau auf badischem
Staatsgebiet sind bisher vergeblich gewesen, um
den Naturvorgang des Abflusses der Donau nach
der Aach nicht zu stören. Durch Untersuchungen
ist unwiderleglich erwiesen, daß ein Zusammen-
hang der Aachquelle mit der Donau besteht. Der
Lauf des Wassers ist annähernd genau zu verfol-
gen, und ebenso ist die Zeit zu bestimmen, in der
es fortströmt. Man hat mit Fluoreszin, einem
stark ausgiebigen grünen Farbstoff, sowie mit
eingeschütteten Salzmengen nachgewiesen, daß
die Wassermassen von der Donauversenkung bis
zum Aachtopf achtzehn Stunden unterwegs sind.
Im Sommer 1907 ist durch Färbeversuche der
Beweis erbracht worden, daß die bei Fridingen
— unterhalb Tuttlingen — versinkenden Donau-
wasser gleichfalls im Aachtopf wieder austreten.
An der Industriestadt Tuttlingen schleicht der
aus der Elta und dem Krähenbach entstehende
Wasserlauf matt vorüber; oberhalb ihrer Mün-
dungen aber finden sich nur noch kleine ver-
sumpfte Tümpel, die weiterhin völlig aufhören,
bis das ganze Donaubett als trockene Kiesstraße
daliegt. Betriebe, die auf Wasser angewiesen
sind, sind gezwungen, mit Dampf zu arbeiten.
Oberhalb des Jmmendinger Wehres wird die Lage für alle von der
Wasserkraft abhängigen Anwohner geradezu vernichtend.
Hier liegen Naturmächte, Kulturbestrebungen, menschliche Kurzsichtig-
keit und egoistische Kräfte in einem schweren, erbitterten Kampf, der aber
doch einmal in würdiger Form abgeschlossen werden muß. Ob man in
unserer Zeit der sozialen Nöte noch weniger Einsicht und guten Willen
für die gefaulte Volkswohlfahrt ausbringt als vordem, ist eine ernste sitt-
liche Frage. Fast scheint es so, als ob ihre Lösung bis zum Jüngsten Gericht
vertagt werden soll.
Die Donaulöcher bei Tuttlingen: Die Versickerung rstellen sind an der
deutlich sichtbaren Strudelbildung kenntlich.
Das trockene Donaubett bei Tuttlingen.