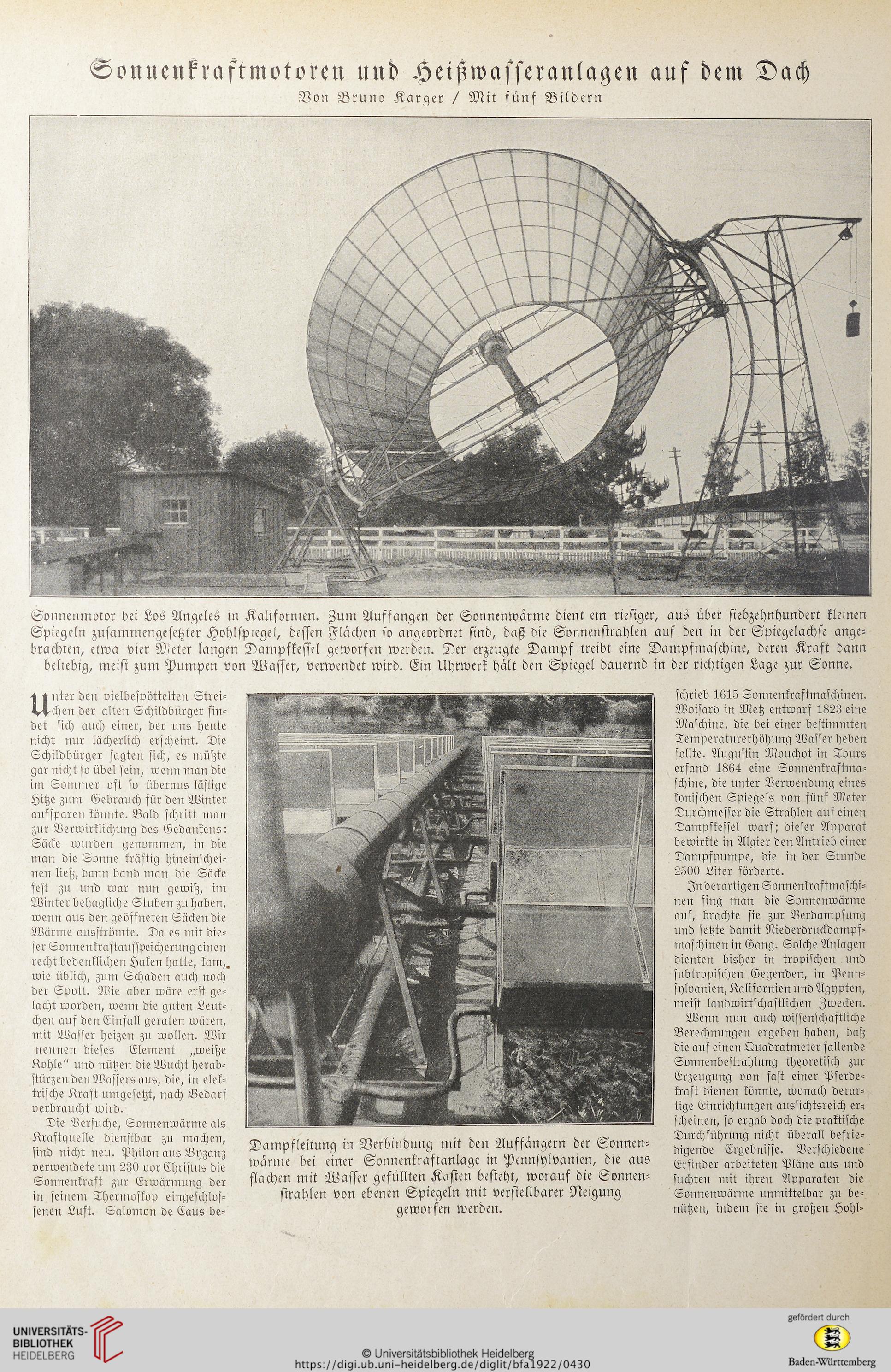Sonnenkraftmotoren und Heißwasseranlagen auf dem Dach
Von Bruno Karger / Mil fünf Bildern
Sonnenrnotor bei Los Angeles in Kalifornien. Anin Auffangen der Sonnenwärme dient ein riesiger, aus über siebzehnhundert kleinen
Spiegeln zusammengesetzter Hohlspiegel, dessen Flächen so angeordnet sind, daß die Sonnenstrahlen auf den in der Spiegelachse ange-
brachten, etwa vier Nieter langen Dampfkessel geworfen werden. Der erzeugte Dampf treibt eine Dampfmaschine, deren Kraft dann
beliebig, meist zum Pumpen von Wasser, verwendet wird. Ein Uhrwerk hält den Spiegel dauernd in der richtigen Lage zur Sonne.
4 4 nter den vielbespöttelten Strei-
4^chen der alten Schildbürger fin-
det sich auch einer, der uns heute
nicht nur lächerlich erscheint. Die
Schildbürger sagten sich, es müßte
gar nicht so übel sein, wenn man die
im Sommer oft so überaus lästige
Hitze zum Gebrauch für den Winter
aufsparen könnte. Bald schritt man
zur Verwirklichung des Gedankens:
Säcke wurden genommen, in die
man die Sonne kräftig hineinschei-
nen ließ, dann band man die Säcke
fest zu und war nun gewiß, im
Winter behagliche Stuben zu haben,
wenn aus den geöffneten Säcken die
Wärme ausströmte. Da es mit die-
ser Sonnenkraftaufspeicherung einen
recht bedenklichen Haken hatte, kam,,
wie üblich, zum Schaden auch noch
der Spott. Wie aber wäre erst ge-
lacht worden, wenn die guten Leut-
chen auf den Einfall geraten wären,
mit Wasser Heizen zu wollen. Wir
nennen dieses Element „weiße
Kohle" und nützen die Wucht herab-
stürzen den Wassers aus, die, in elek-
trische Kraft umgesetzt, nach Bedarf
verbraucht wird.
Die Versuche, Sonnenwärme als
Kraftquelle dienstbar zu machen,
sind nicht neu. Philon aus Byzanz
verwendete um 230 vor Christus die
Sonnenkraft zur Erwärmung der
in seinem Thermoskop eingeschlos-
senen Luft. Salomon de Cans be-
Dampfleitung in Verbindung mit den Auffängern der Sonnen-
wärme bei einer Sonnenkraftanlage in Pennfylvanien, die aus
flachen mit Wasser gefüllten Kasten besieht, worauf die Sonnen-
strahlen von ebenen Spiegeln mit verstellbarer Neigung
geworfen werden.
schrieb 1615 Sonueukraftmaschinen.
Woisard iu Metz entwarf 1823 eine
Maschine, die bei einer bestimmten
Temperaturerhöhung Wasser heben
sollte. Augustin Mouchot in Tours
erfand 1864 eine Sonnenkraftma-
schine, die unter Verwendung eines
konischen Spiegels von fünf Meter
Durchmesser die Strahlen auf einen
Dampfkessel warf,- dieser Apparat
bewirkte in Algier den Antrieb einer
Dampfpumpe, die in der Stunde
2500 Liter förderte.
In derartigen Sonnenkraftmaschi-
nen fing man die Sonnenwärme
auf, brachte sie zur Verdampfung
und setzte damit Niederdruckdampf-
maschinen in Gang. Solche Anlagen
dienten bisher in tropischen und
subtropischen Gegenden, in Penn-
sylvanien, Kalifornien und Ägypten,
meist landwirtschaftlichen Zwecken.
Wenn nun auch wissenschaftliche
Berechnungen ergeben haben, daß
die auf einen Quadratmeter fallende
Sonnenbestrahlung theoretisch zur
Erzeugung von fast einer Pferde-
kraft dienen könnte, wonach derar-
tige Einrichtungen aussichtsreich er;
scheinen, so ergab doch die praktische
Durchführung nicht überall befrie-
digende Ergebnisse. Verschiedene
Erfinder arbeiteten Pläne aus und
suchten mit ihren Apparaten die
Sonnenwürme unmittelbar zu be-
nützen, indem sie in großen Hohl-
Von Bruno Karger / Mil fünf Bildern
Sonnenrnotor bei Los Angeles in Kalifornien. Anin Auffangen der Sonnenwärme dient ein riesiger, aus über siebzehnhundert kleinen
Spiegeln zusammengesetzter Hohlspiegel, dessen Flächen so angeordnet sind, daß die Sonnenstrahlen auf den in der Spiegelachse ange-
brachten, etwa vier Nieter langen Dampfkessel geworfen werden. Der erzeugte Dampf treibt eine Dampfmaschine, deren Kraft dann
beliebig, meist zum Pumpen von Wasser, verwendet wird. Ein Uhrwerk hält den Spiegel dauernd in der richtigen Lage zur Sonne.
4 4 nter den vielbespöttelten Strei-
4^chen der alten Schildbürger fin-
det sich auch einer, der uns heute
nicht nur lächerlich erscheint. Die
Schildbürger sagten sich, es müßte
gar nicht so übel sein, wenn man die
im Sommer oft so überaus lästige
Hitze zum Gebrauch für den Winter
aufsparen könnte. Bald schritt man
zur Verwirklichung des Gedankens:
Säcke wurden genommen, in die
man die Sonne kräftig hineinschei-
nen ließ, dann band man die Säcke
fest zu und war nun gewiß, im
Winter behagliche Stuben zu haben,
wenn aus den geöffneten Säcken die
Wärme ausströmte. Da es mit die-
ser Sonnenkraftaufspeicherung einen
recht bedenklichen Haken hatte, kam,,
wie üblich, zum Schaden auch noch
der Spott. Wie aber wäre erst ge-
lacht worden, wenn die guten Leut-
chen auf den Einfall geraten wären,
mit Wasser Heizen zu wollen. Wir
nennen dieses Element „weiße
Kohle" und nützen die Wucht herab-
stürzen den Wassers aus, die, in elek-
trische Kraft umgesetzt, nach Bedarf
verbraucht wird.
Die Versuche, Sonnenwärme als
Kraftquelle dienstbar zu machen,
sind nicht neu. Philon aus Byzanz
verwendete um 230 vor Christus die
Sonnenkraft zur Erwärmung der
in seinem Thermoskop eingeschlos-
senen Luft. Salomon de Cans be-
Dampfleitung in Verbindung mit den Auffängern der Sonnen-
wärme bei einer Sonnenkraftanlage in Pennfylvanien, die aus
flachen mit Wasser gefüllten Kasten besieht, worauf die Sonnen-
strahlen von ebenen Spiegeln mit verstellbarer Neigung
geworfen werden.
schrieb 1615 Sonueukraftmaschinen.
Woisard iu Metz entwarf 1823 eine
Maschine, die bei einer bestimmten
Temperaturerhöhung Wasser heben
sollte. Augustin Mouchot in Tours
erfand 1864 eine Sonnenkraftma-
schine, die unter Verwendung eines
konischen Spiegels von fünf Meter
Durchmesser die Strahlen auf einen
Dampfkessel warf,- dieser Apparat
bewirkte in Algier den Antrieb einer
Dampfpumpe, die in der Stunde
2500 Liter förderte.
In derartigen Sonnenkraftmaschi-
nen fing man die Sonnenwärme
auf, brachte sie zur Verdampfung
und setzte damit Niederdruckdampf-
maschinen in Gang. Solche Anlagen
dienten bisher in tropischen und
subtropischen Gegenden, in Penn-
sylvanien, Kalifornien und Ägypten,
meist landwirtschaftlichen Zwecken.
Wenn nun auch wissenschaftliche
Berechnungen ergeben haben, daß
die auf einen Quadratmeter fallende
Sonnenbestrahlung theoretisch zur
Erzeugung von fast einer Pferde-
kraft dienen könnte, wonach derar-
tige Einrichtungen aussichtsreich er;
scheinen, so ergab doch die praktische
Durchführung nicht überall befrie-
digende Ergebnisse. Verschiedene
Erfinder arbeiteten Pläne aus und
suchten mit ihren Apparaten die
Sonnenwürme unmittelbar zu be-
nützen, indem sie in großen Hohl-