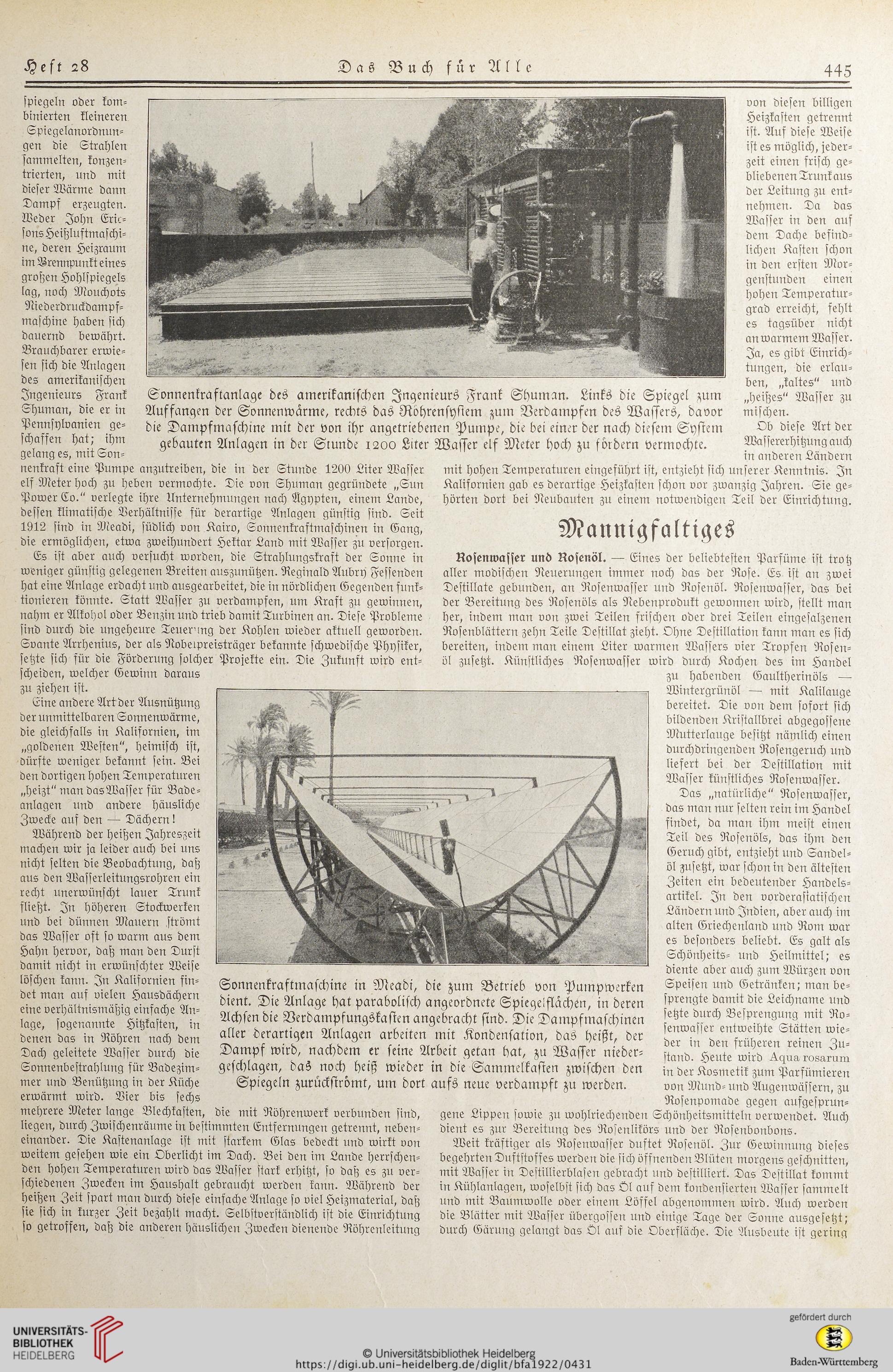Heft 28
Das Buch für Alle
44Z
spiegeln oder kom¬
binierten kleineren
Spiegelanordnun¬
gen die Strahlen
sammelten, konzen¬
trierten, und mit
dieser Wärme dann
Dampf erzeugten.
Weder John Ern-
sonsHeißluftmaschi-
ne, deren Heizraum
im Brennpunkt eines
großen Hohlspiegels
lag, noch Mouchots
Niederdruckdampf¬
maschine haben sich
dauernd bewährt.
Brauchbarer erwie¬
sen sich die Anlagen
des amerikanischen
Ingenieurs Frank
Shuman, die er in
Pennsylvanien ge¬
schaffen hat; ihm
gelang es, mit Son¬
nenkraft eine Pumpe anzutreiben, die in der Stunde 1200 Liter Wasser
elf Meterhoch zu heben vermochte. Die von Shuman gegründete „Sun
Power Co." verlegte ihre Unternehmungen nach Ägypten, einem Lande,
dessen klimatische Verhältnisse für derartige Anlagen günstig sind. Seit
1912 sind in Meadi, südlich von Kairo, Sonnenkraftmaschinen in Gang,
die ermöglichen, etwa zweihundert Hektar Land mit Wasser zu versorgen.
Es ist aber auch versucht worden, die Strahlungskraft der Sonne in
weniger günstig gelegenen Breiten auszunützen. Reginald Aubry Messenden
hat eine Anlage erdacht und ausgearbeitet, die in nördlichen Gegenden funk-
tionieren könnte. Statt Wasser zu verdampfen, um Kraft zu gewinnen,
nahm er Alkohol oder Benzin und trieb damit Turbinen an. Diese Probleme
sind durch die ungeheure Teuerung der Kohlen wieder aktuell geworden.
Svante Arrhenius, der als Nobelpreisträger bekannte schwedische Physiker,
setzte sich für die Förderung solcher Projekte ein. Die Zukunft wird ent-
scheiden, welcher Gewinn daraus
zu ziehen ist.
Eine andere Arider Ausnützung
der unmittelbaren Sonnenwärme,
die gleichfalls in Kalifornien, im
„goldenen Westen", heimisch ist,
dürfte weniger bekannt sein. Bei
den dortigen hohen Temperaturen
„heizt" man das Wasser für Bade ¬
anlagen und andere häusliche
Zwecke auf den — Dächern!
Während der heißen Jahreszeit
machen wir ja leider auch bei uns
nicht selten die Beobachtung, daß
aus den Wasserleitungsrohren ein
recht unerwünscht lauer Trunk
flieht. In höheren Stockwerken
und bei dünnen Mauern strömt
das Wasser oft so warm aus dem
Hahn hervor, daß man den Durst
damit nicht in erwünschter Weise
löschen kann. In Kalifornien fin¬
det man auf vielen Hausdächern
eine verhältnismäßig einfache An¬
lage, sogenannte Hitzkasten, in
denen das in Röhren nach dem
Dach geleitete Wasser durch die
Sonnenbestrahlung für Badezim¬
mer und Benützung in der Küche
erwärmt wird. Vier bis sechs
mehrere Meter lange Blechkasten, die mit Röhrenwerk verbunden sind,
liegen, durch Zwischenräume in bestimmten Entfernungen getrennt, neben-
einander. Die Kastenanlage ist mit starkem Glas bedeckt und wirkt von
weitem gesehen wie ein Oberlicht im Dach. Bei den im Lande herrschen-
den hohen Temperaturen wird das Wasser stark erhitzt, so daß es zu ver-
schiedenen Zwecken im Haushalt gebraucht werden kann. Während der
heißen Zeit spart man durch diese einfache Anlage so viel Heizmaterial, daß
sie sich in kurzer Zeit bezahlt macht. Selbstverständlich ist die Einrichtung
so getroffen, daß dis anderen häuslichen Zwecken dienende Röhrenleitung
von diesen billigen
Heizkasten getrennt
ist. Auf diese Weise
ist es möglich, jeder-
zeit einen frisch ge-
bliebenen Trunk aus
der Leitung zu ent-
nehmen. Da das
Wasser in den auf
dem Dache befind-
lichen Kasten schon
in den ersten Mor-
genstunden einen
hohen Temperatur-
grad erreicht, fehlt
es tagsüber nicht
an warmem Wasser.
Ja, es gibt Einrich-
tungen, die erlau-
ben, „kaltes" und
„heißes" Wasser zu
mischen.
Ob diese Art der
Wassererhitzung auch
in anderen Ländern
mit hohen Temperaturen eingeführt ist, entzieht sich unserer Kenntnis. In
Kalifornien gab es derartige Heizkasten schon vor zwanzig Jahren. Sie ge-
hörten dort bei Neubauten zu einem notwendigen Teil der Einrichtung.
Mannigfaltiges
Rosenwasser und Rosenöl. — Eines der beliebtesten Parfüme ist trotz
aller modischen Neuerungen immer noch das der Rose. Es ist an zwei
Destillate gebunden, an Rosenwasser und Rosenöl. Rosenwasser, das bei
der Bereitung des Rosenöls als Nebenprodukt gewonnen wird, stellt man
her, indem man von zwei Teilen frischen oder drei Teilen eingesalzenen
Rosenblättern zehn Teile Destillat zieht. Ohne Destillation kann man es sich
bereiten, indem man einem Liter warmen Wassers vier Tropfen Rosen-
öl zusetzt. Künstliches Rosenwasser wird durch Kochen des im Handel
zu habenden Gaultherinöls —
Wintergrünöl — mit Kalilauge
bereitet. Die von dem sofort sich
bildenden Kristallbrei abgegossene
Mutterlauge besitzt nämlich einen
durchdringenden Rosengeruch und
liefert bei der Destillation mit
Wasser künstliches Rosenwasser.
Das „natürliche" Rosenwasser,
das man nur selten rein im Handel
findet, da man ihm meist einen
Teil des Rosenöls, das ihm den
Geruch gibt, entzieht und Sandel-
öl zusetzt, war schon in den ältesten
Zeiten ein bedeutender Handels-
artikel. In den vorderasiatischen
Ländern und Indien, aber auch im
alten Griechenland und Rom war
es besonders beliebt. Es galt als
Schönheits- und Heilmittel; es
diente aber auch zum Würzen von
Speisen und Getränken; man be-
sprengte damit die Leichname und
setzte durch Besprengung mit Ro-
senwasser entweihte Stätten wie-
der in den früheren reinen Zu-
stand. Heute wird ^.gna rosarnm
in der Kosmetik zum Parfümieren
von Mund-und Augenwässern, zu
Rosenpomade gegen aufgesprun-
gene Lippen sowie zu wohlriechenden Schönheitsmitteln verwendet. Auch
dient es zur Bereitung des Rosenlikörs und der Nosenbonbons.
Weit kräftiger als Rosenwasser duftet Rosenöl. Zur Gewinnung dieses
begehrten Duftstoffes werden die sich öffnenden Blüten morgens geschnitten,
mit Wasser in Destillierblasen gebracht und destilliert. Das Destillat kommt
in Kühlanlagen, woselbst sich das Öl auf dem kondensierten Wasser sammelt
und mit Baumwolle oder einem Löffel abgenommen wird. Anch werden
die Blätter mit Wasser übergossen und einige Tage der Sonne ausgesetzt;
durch Gärung gelangt das Öl auf die Oberfläche. Die Ausbeute ist gering
Sonnenkraftanlage des amerikanischen Ingenieurs Frank Shuman. Links die Spiegel zum
Auffangen der Sonnenwärme, rechts das Rohrensysiem zum Verdampfen des Wassers, davor
die Dampfmaschine mit der von ihr angetriebenen Pumpe, die bei einer der nach diesem System
gebauten Anlagen in der Stunde 1200 Ltter Wasser elf Meter hoch zu fördern vermochte.
Sonnenkraftmaschine in Meadi, die zum Betrieb von Pumpwerken
dient. Die Anlage hat parabolisch angeordnete Spiegeiflächen, in deren
Achsen die Verdampfungskasten angebracht sind. Die Dampfmaschinen
aller derartigen Anlagen arbeiten mit Kondensation, das heißt, der
Dampf wird, nachdem er seine Arbeit getan hat, zu Wasser nieder-
geschlagen, das noch heiß wieder in die Sammelkassen zwischen den
Spiegeln zurückströmt, um dort aufs neue verdampft zu werden.
Das Buch für Alle
44Z
spiegeln oder kom¬
binierten kleineren
Spiegelanordnun¬
gen die Strahlen
sammelten, konzen¬
trierten, und mit
dieser Wärme dann
Dampf erzeugten.
Weder John Ern-
sonsHeißluftmaschi-
ne, deren Heizraum
im Brennpunkt eines
großen Hohlspiegels
lag, noch Mouchots
Niederdruckdampf¬
maschine haben sich
dauernd bewährt.
Brauchbarer erwie¬
sen sich die Anlagen
des amerikanischen
Ingenieurs Frank
Shuman, die er in
Pennsylvanien ge¬
schaffen hat; ihm
gelang es, mit Son¬
nenkraft eine Pumpe anzutreiben, die in der Stunde 1200 Liter Wasser
elf Meterhoch zu heben vermochte. Die von Shuman gegründete „Sun
Power Co." verlegte ihre Unternehmungen nach Ägypten, einem Lande,
dessen klimatische Verhältnisse für derartige Anlagen günstig sind. Seit
1912 sind in Meadi, südlich von Kairo, Sonnenkraftmaschinen in Gang,
die ermöglichen, etwa zweihundert Hektar Land mit Wasser zu versorgen.
Es ist aber auch versucht worden, die Strahlungskraft der Sonne in
weniger günstig gelegenen Breiten auszunützen. Reginald Aubry Messenden
hat eine Anlage erdacht und ausgearbeitet, die in nördlichen Gegenden funk-
tionieren könnte. Statt Wasser zu verdampfen, um Kraft zu gewinnen,
nahm er Alkohol oder Benzin und trieb damit Turbinen an. Diese Probleme
sind durch die ungeheure Teuerung der Kohlen wieder aktuell geworden.
Svante Arrhenius, der als Nobelpreisträger bekannte schwedische Physiker,
setzte sich für die Förderung solcher Projekte ein. Die Zukunft wird ent-
scheiden, welcher Gewinn daraus
zu ziehen ist.
Eine andere Arider Ausnützung
der unmittelbaren Sonnenwärme,
die gleichfalls in Kalifornien, im
„goldenen Westen", heimisch ist,
dürfte weniger bekannt sein. Bei
den dortigen hohen Temperaturen
„heizt" man das Wasser für Bade ¬
anlagen und andere häusliche
Zwecke auf den — Dächern!
Während der heißen Jahreszeit
machen wir ja leider auch bei uns
nicht selten die Beobachtung, daß
aus den Wasserleitungsrohren ein
recht unerwünscht lauer Trunk
flieht. In höheren Stockwerken
und bei dünnen Mauern strömt
das Wasser oft so warm aus dem
Hahn hervor, daß man den Durst
damit nicht in erwünschter Weise
löschen kann. In Kalifornien fin¬
det man auf vielen Hausdächern
eine verhältnismäßig einfache An¬
lage, sogenannte Hitzkasten, in
denen das in Röhren nach dem
Dach geleitete Wasser durch die
Sonnenbestrahlung für Badezim¬
mer und Benützung in der Küche
erwärmt wird. Vier bis sechs
mehrere Meter lange Blechkasten, die mit Röhrenwerk verbunden sind,
liegen, durch Zwischenräume in bestimmten Entfernungen getrennt, neben-
einander. Die Kastenanlage ist mit starkem Glas bedeckt und wirkt von
weitem gesehen wie ein Oberlicht im Dach. Bei den im Lande herrschen-
den hohen Temperaturen wird das Wasser stark erhitzt, so daß es zu ver-
schiedenen Zwecken im Haushalt gebraucht werden kann. Während der
heißen Zeit spart man durch diese einfache Anlage so viel Heizmaterial, daß
sie sich in kurzer Zeit bezahlt macht. Selbstverständlich ist die Einrichtung
so getroffen, daß dis anderen häuslichen Zwecken dienende Röhrenleitung
von diesen billigen
Heizkasten getrennt
ist. Auf diese Weise
ist es möglich, jeder-
zeit einen frisch ge-
bliebenen Trunk aus
der Leitung zu ent-
nehmen. Da das
Wasser in den auf
dem Dache befind-
lichen Kasten schon
in den ersten Mor-
genstunden einen
hohen Temperatur-
grad erreicht, fehlt
es tagsüber nicht
an warmem Wasser.
Ja, es gibt Einrich-
tungen, die erlau-
ben, „kaltes" und
„heißes" Wasser zu
mischen.
Ob diese Art der
Wassererhitzung auch
in anderen Ländern
mit hohen Temperaturen eingeführt ist, entzieht sich unserer Kenntnis. In
Kalifornien gab es derartige Heizkasten schon vor zwanzig Jahren. Sie ge-
hörten dort bei Neubauten zu einem notwendigen Teil der Einrichtung.
Mannigfaltiges
Rosenwasser und Rosenöl. — Eines der beliebtesten Parfüme ist trotz
aller modischen Neuerungen immer noch das der Rose. Es ist an zwei
Destillate gebunden, an Rosenwasser und Rosenöl. Rosenwasser, das bei
der Bereitung des Rosenöls als Nebenprodukt gewonnen wird, stellt man
her, indem man von zwei Teilen frischen oder drei Teilen eingesalzenen
Rosenblättern zehn Teile Destillat zieht. Ohne Destillation kann man es sich
bereiten, indem man einem Liter warmen Wassers vier Tropfen Rosen-
öl zusetzt. Künstliches Rosenwasser wird durch Kochen des im Handel
zu habenden Gaultherinöls —
Wintergrünöl — mit Kalilauge
bereitet. Die von dem sofort sich
bildenden Kristallbrei abgegossene
Mutterlauge besitzt nämlich einen
durchdringenden Rosengeruch und
liefert bei der Destillation mit
Wasser künstliches Rosenwasser.
Das „natürliche" Rosenwasser,
das man nur selten rein im Handel
findet, da man ihm meist einen
Teil des Rosenöls, das ihm den
Geruch gibt, entzieht und Sandel-
öl zusetzt, war schon in den ältesten
Zeiten ein bedeutender Handels-
artikel. In den vorderasiatischen
Ländern und Indien, aber auch im
alten Griechenland und Rom war
es besonders beliebt. Es galt als
Schönheits- und Heilmittel; es
diente aber auch zum Würzen von
Speisen und Getränken; man be-
sprengte damit die Leichname und
setzte durch Besprengung mit Ro-
senwasser entweihte Stätten wie-
der in den früheren reinen Zu-
stand. Heute wird ^.gna rosarnm
in der Kosmetik zum Parfümieren
von Mund-und Augenwässern, zu
Rosenpomade gegen aufgesprun-
gene Lippen sowie zu wohlriechenden Schönheitsmitteln verwendet. Auch
dient es zur Bereitung des Rosenlikörs und der Nosenbonbons.
Weit kräftiger als Rosenwasser duftet Rosenöl. Zur Gewinnung dieses
begehrten Duftstoffes werden die sich öffnenden Blüten morgens geschnitten,
mit Wasser in Destillierblasen gebracht und destilliert. Das Destillat kommt
in Kühlanlagen, woselbst sich das Öl auf dem kondensierten Wasser sammelt
und mit Baumwolle oder einem Löffel abgenommen wird. Anch werden
die Blätter mit Wasser übergossen und einige Tage der Sonne ausgesetzt;
durch Gärung gelangt das Öl auf die Oberfläche. Die Ausbeute ist gering
Sonnenkraftanlage des amerikanischen Ingenieurs Frank Shuman. Links die Spiegel zum
Auffangen der Sonnenwärme, rechts das Rohrensysiem zum Verdampfen des Wassers, davor
die Dampfmaschine mit der von ihr angetriebenen Pumpe, die bei einer der nach diesem System
gebauten Anlagen in der Stunde 1200 Ltter Wasser elf Meter hoch zu fördern vermochte.
Sonnenkraftmaschine in Meadi, die zum Betrieb von Pumpwerken
dient. Die Anlage hat parabolisch angeordnete Spiegeiflächen, in deren
Achsen die Verdampfungskasten angebracht sind. Die Dampfmaschinen
aller derartigen Anlagen arbeiten mit Kondensation, das heißt, der
Dampf wird, nachdem er seine Arbeit getan hat, zu Wasser nieder-
geschlagen, das noch heiß wieder in die Sammelkassen zwischen den
Spiegeln zurückströmt, um dort aufs neue verdampft zu werden.