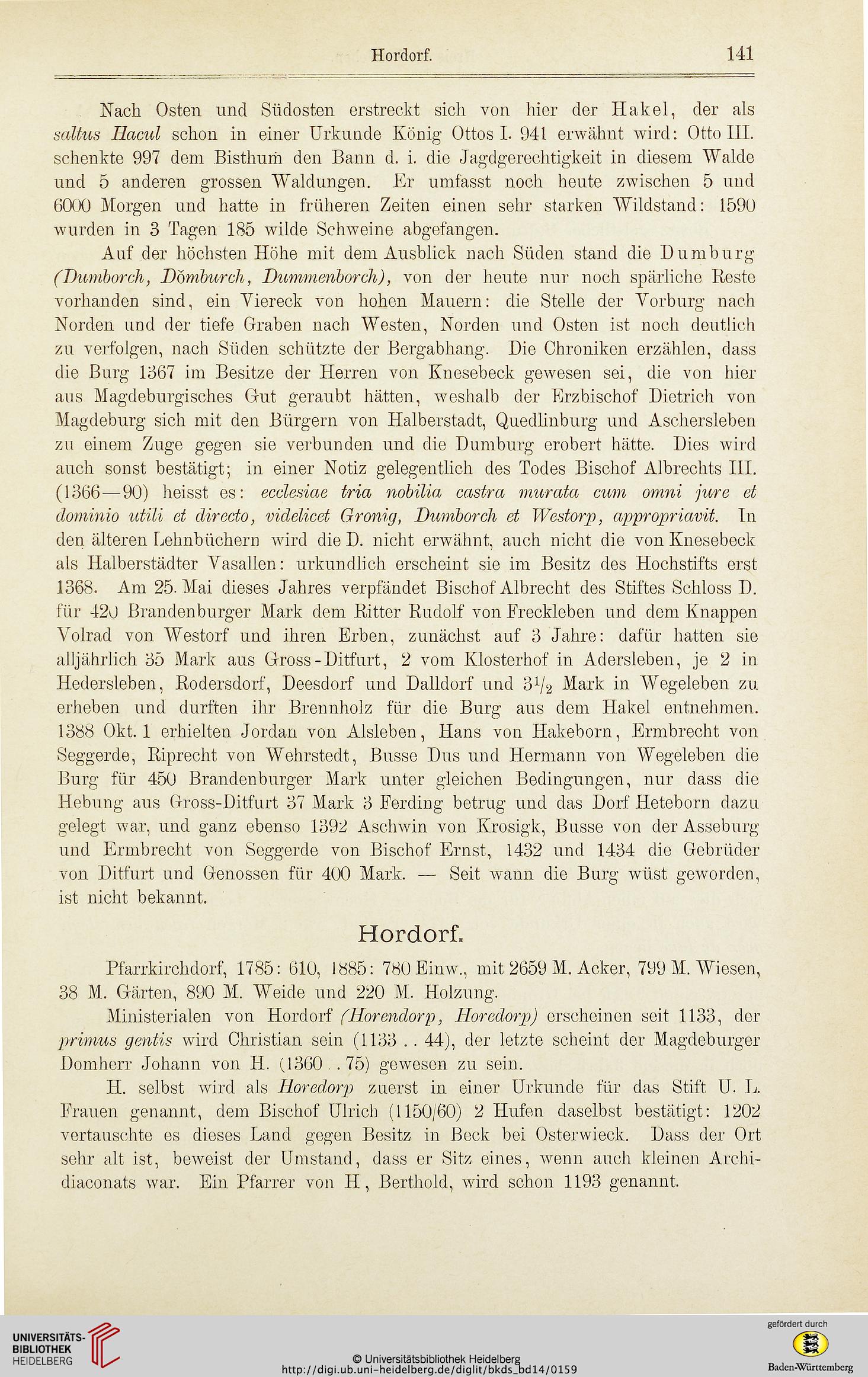Hordorf.
141
Nach Osten und Südosten erstreckt sich von hier der Hakel, der als
saltus Iiacid schon in einer Urkunde König Ottos I. 941 erwähnt wird: Otto III.
schenkte 997 dem Bisthum den Bann d. i. die Jagdgerechtigkeit in diesem Walde
und 5 anderen grossen Waldungen. Er umfasst noch heute zwischen 5 und
6000 Morgen und hatte in früheren Zeiten einen sehr starken Wildstand: 1590
wurden in 3 Tagen 185 wilde Schweine abgefangen.
Auf der höchsten Höhe mit dem Ausblick nach Süden stand die D umburg
(Dumborch, Domburch, Dummenborch), von der heute nur noch spärliche Reste
vorhanden sind, ein Viereck von hohen Mauern: die Stelle der Vorburg nach
Norden und der tiefe Graben nach Westen, Norden und Osten ist noch deutlich
zu verfolgen, nach Süden schützte der Bergabhang. Die Chroniken erzählen, dass
die Burg 1367 im Besitze der Herren von Knesebeck gewesen sei, die von hier
aus Magdeburgisches Gut geraubt hätten, weshalb der Erzbischof Dietrich von
Magdeburg sich mit den Bürgern von Halberstadt, Quedlinburg und Aschersleben
zu einem Zuge gegen sie verbunden und die Duniburg erobert hätte. Dies wird
auch sonst bestätigt; in einer Notiz gelegentlich des Todes Bischof Albrechts III.
(1366—90) heisst es: ecclesiae tria nobilia castra murata cum omni jure et
dominio utili et directo, videlicet Gronig, Dumborch et Westorp, appropriavit. In
den älteren Lehnbüchern wird die D. nicht erwähnt, auch nicht die von Knesebeck
als Halberstädter Vasallen: urkundlich erscheint sie im Besitz des Hochstifts erst
1368. Am 25. Mai dieses Jahres verpfändet Bischof Albrecht des Stiftes Schloss D.
für 420 Brandenburger Mark dem Ritter Rudolf von Freckleben und dem Knappen
Volrad von Westorf und ihren Erben, zunächst auf 3 Jahre: dafür hatten sie
alljährlich 35 Mark aus Gross -Ditfurt, 2 vom Klosterhof in Adersleben, je 2 in
Hedersleben, Rodersdorf, Deesdorf und Dalldorf und 3V2 Mark in Wegeleben zu
erheben und durften ihr Brennholz für die Burg aus dem Hakel entnehmen.
1388 Okt. 1 erhielten Jordan von Aisleben, Hans von Hakeborn, Ermbrecht von
Seggerde, Riprecht von Wehrstedt, Busse Dus und Hermann von Wegeleben die
Burg für 450 Brandenburger Mark unter gleichen Bedingungen, nur dass die
Hebung aus Gross-Ditfurt 37 Mark 3 Ferding betrug und das Dorf Heteborn dazu
gelegt war, und ganz ebenso 1392 Aschwin von Krosigk, Busse von der Asseburg
und Ermbrecht von Seggerde von Bischof Ernst, 1432 und 1434 die Gebrüder
von Ditfurt und Genossen für 400 Mark. — Seit wann die Burg wüst geworden,
ist nicht bekannt.
Hordorf.
Pfarrkirchdorf, 1785: 610, 1885: 780 Einw., mit 2659 M. Acker, 799 M. Wiesen,
38 M. Gärten, 890 M. Weide und 220 M. Holzung.
Ministerialen von Hordorf (Horendorp, Horedorp) erscheinen seit 1133, der
primus gentis wird Christian sein (1133 . . 44), der letzte scheint der Magdeburger
Domherr Johann von H. (1360 . . 75) gewesen zu sein.
H. selbst wird als Horedorp zuerst in einer Urkunde für das Stift U. L.
Frauen genannt, dem Bischof Ulrich (1150/60) 2 Hufen daselbst bestätigt: 1202
vertauschte es dieses Land gegen Besitz in Beck bei Osterwieck. Dass der Ort
sehr alt ist, beweist der Umstand, dass er Sitz eines, wenn auch kleinen Archi-
diaconats war. Ein Pfarrer von H, Berthold, wird schon 1193 genannt.
141
Nach Osten und Südosten erstreckt sich von hier der Hakel, der als
saltus Iiacid schon in einer Urkunde König Ottos I. 941 erwähnt wird: Otto III.
schenkte 997 dem Bisthum den Bann d. i. die Jagdgerechtigkeit in diesem Walde
und 5 anderen grossen Waldungen. Er umfasst noch heute zwischen 5 und
6000 Morgen und hatte in früheren Zeiten einen sehr starken Wildstand: 1590
wurden in 3 Tagen 185 wilde Schweine abgefangen.
Auf der höchsten Höhe mit dem Ausblick nach Süden stand die D umburg
(Dumborch, Domburch, Dummenborch), von der heute nur noch spärliche Reste
vorhanden sind, ein Viereck von hohen Mauern: die Stelle der Vorburg nach
Norden und der tiefe Graben nach Westen, Norden und Osten ist noch deutlich
zu verfolgen, nach Süden schützte der Bergabhang. Die Chroniken erzählen, dass
die Burg 1367 im Besitze der Herren von Knesebeck gewesen sei, die von hier
aus Magdeburgisches Gut geraubt hätten, weshalb der Erzbischof Dietrich von
Magdeburg sich mit den Bürgern von Halberstadt, Quedlinburg und Aschersleben
zu einem Zuge gegen sie verbunden und die Duniburg erobert hätte. Dies wird
auch sonst bestätigt; in einer Notiz gelegentlich des Todes Bischof Albrechts III.
(1366—90) heisst es: ecclesiae tria nobilia castra murata cum omni jure et
dominio utili et directo, videlicet Gronig, Dumborch et Westorp, appropriavit. In
den älteren Lehnbüchern wird die D. nicht erwähnt, auch nicht die von Knesebeck
als Halberstädter Vasallen: urkundlich erscheint sie im Besitz des Hochstifts erst
1368. Am 25. Mai dieses Jahres verpfändet Bischof Albrecht des Stiftes Schloss D.
für 420 Brandenburger Mark dem Ritter Rudolf von Freckleben und dem Knappen
Volrad von Westorf und ihren Erben, zunächst auf 3 Jahre: dafür hatten sie
alljährlich 35 Mark aus Gross -Ditfurt, 2 vom Klosterhof in Adersleben, je 2 in
Hedersleben, Rodersdorf, Deesdorf und Dalldorf und 3V2 Mark in Wegeleben zu
erheben und durften ihr Brennholz für die Burg aus dem Hakel entnehmen.
1388 Okt. 1 erhielten Jordan von Aisleben, Hans von Hakeborn, Ermbrecht von
Seggerde, Riprecht von Wehrstedt, Busse Dus und Hermann von Wegeleben die
Burg für 450 Brandenburger Mark unter gleichen Bedingungen, nur dass die
Hebung aus Gross-Ditfurt 37 Mark 3 Ferding betrug und das Dorf Heteborn dazu
gelegt war, und ganz ebenso 1392 Aschwin von Krosigk, Busse von der Asseburg
und Ermbrecht von Seggerde von Bischof Ernst, 1432 und 1434 die Gebrüder
von Ditfurt und Genossen für 400 Mark. — Seit wann die Burg wüst geworden,
ist nicht bekannt.
Hordorf.
Pfarrkirchdorf, 1785: 610, 1885: 780 Einw., mit 2659 M. Acker, 799 M. Wiesen,
38 M. Gärten, 890 M. Weide und 220 M. Holzung.
Ministerialen von Hordorf (Horendorp, Horedorp) erscheinen seit 1133, der
primus gentis wird Christian sein (1133 . . 44), der letzte scheint der Magdeburger
Domherr Johann von H. (1360 . . 75) gewesen zu sein.
H. selbst wird als Horedorp zuerst in einer Urkunde für das Stift U. L.
Frauen genannt, dem Bischof Ulrich (1150/60) 2 Hufen daselbst bestätigt: 1202
vertauschte es dieses Land gegen Besitz in Beck bei Osterwieck. Dass der Ort
sehr alt ist, beweist der Umstand, dass er Sitz eines, wenn auch kleinen Archi-
diaconats war. Ein Pfarrer von H, Berthold, wird schon 1193 genannt.