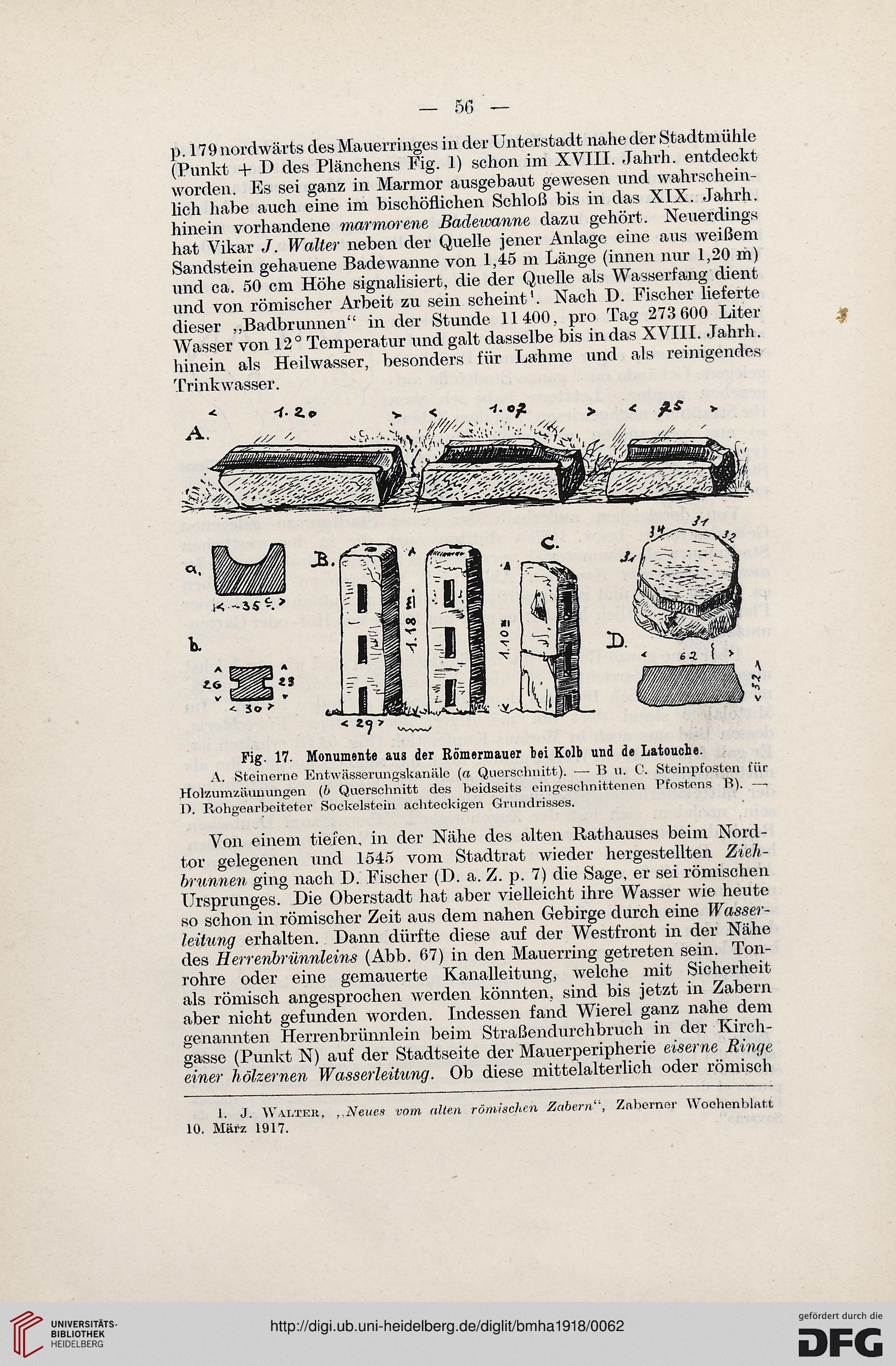p. 179 nord wârts desMauerringes in der Unterstadt nahe der Stadtmühle
(Punkt + D des Planchens Fig. 1) schon im XVIII. Jahrli. entdeckt
worden. Es sei ganz in Marmor ausgebaut gewesen nnd wahrschein-
lich habe anch eine im bischôflichen SchloB bis in das XIX. Jahrh.
hinein vorhandene marmorene Badewanne dazu gehôrt. Neuerdings
hat Vikar J. Walter neben der Quelle jener Anlage eine ans weiBern
Sandstein gehauene Badewanne von 1,45 ni Lange (innen nur 1,20 m)
nnd ca. 50 cm Hôhe signalisiert, die der Quelle als Wasserfang dient
und von rômischer Arbeit zu sein scheint1. Nacli I). Fischer lieferte
dieser ,,Badbrunnen“ in der Stunde 11400, pro Tag 273 600 Liter f
Wasser von 12° Temperatur und galt dasselbe bis in das XVIII. Jahrh .
hinein als Heilwasser, besonders fiir Lahme und als reinigendes
Trinkwasser.
< >
Fig. 17. Monumente aus der Rômermauer bei Kolb und de Latouehe.
A. Steinerne Entwasserungskanale (a Querschnitt). — B u. C. Steinpfoston fiir
Hol’/.umziiiumngen (6 Querschnitt des beidseits eingeschnittenen Pfostons B). —.
1>. Ivohgearbeiteter Sockelstein achteekigen Grundtisses.
Von einem tieîen, in der Nahe des alten Rathauses beim Nord-
tor gelegenen und 1545 vom Stadtrat wieder hergestellten Zieh-
brunnen ging naeh D. Fischer (D. a. Z. p. 7) die Sage, er sei rômischen
Ursprunges. Die Oberstadt hat aber vielleicht ihre Wasser wie heute
so schon in rômischer Zeit aus dem nahen Gebirge durch eine Wasser-
leitung erhalten. Dann dürfte diese auf der Westfront in der Nahe
des Herrenbrünnleins (Abb. 67) in den Mauerring getreten sein. Ton-
rohre oder eine gemauerte Kanalleitung, welche mit Sicherheit
als rômisch angesproclien werden kônnten, sind bis jetzt in Zabern
aber nicht gefunden worden. Indessen fand Wierel ganz nahe dem
genannten Herrenbriinnlein beim StraBendurchbruch in der Kirch-
gasse (Punkt N) auf der Stadtseite der Mauerperipherie eiserne Ringe
einer hôlzernen Wasserleitimg. Ob diese mittelalterlich oder rômisch
1. J. Walter, ,,Neues vom alten rômischen Zabern*', Zabern or Wochenblatt
10. Mârz 1917.
(Punkt + D des Planchens Fig. 1) schon im XVIII. Jahrli. entdeckt
worden. Es sei ganz in Marmor ausgebaut gewesen nnd wahrschein-
lich habe anch eine im bischôflichen SchloB bis in das XIX. Jahrh.
hinein vorhandene marmorene Badewanne dazu gehôrt. Neuerdings
hat Vikar J. Walter neben der Quelle jener Anlage eine ans weiBern
Sandstein gehauene Badewanne von 1,45 ni Lange (innen nur 1,20 m)
nnd ca. 50 cm Hôhe signalisiert, die der Quelle als Wasserfang dient
und von rômischer Arbeit zu sein scheint1. Nacli I). Fischer lieferte
dieser ,,Badbrunnen“ in der Stunde 11400, pro Tag 273 600 Liter f
Wasser von 12° Temperatur und galt dasselbe bis in das XVIII. Jahrh .
hinein als Heilwasser, besonders fiir Lahme und als reinigendes
Trinkwasser.
< >
Fig. 17. Monumente aus der Rômermauer bei Kolb und de Latouehe.
A. Steinerne Entwasserungskanale (a Querschnitt). — B u. C. Steinpfoston fiir
Hol’/.umziiiumngen (6 Querschnitt des beidseits eingeschnittenen Pfostons B). —.
1>. Ivohgearbeiteter Sockelstein achteekigen Grundtisses.
Von einem tieîen, in der Nahe des alten Rathauses beim Nord-
tor gelegenen und 1545 vom Stadtrat wieder hergestellten Zieh-
brunnen ging naeh D. Fischer (D. a. Z. p. 7) die Sage, er sei rômischen
Ursprunges. Die Oberstadt hat aber vielleicht ihre Wasser wie heute
so schon in rômischer Zeit aus dem nahen Gebirge durch eine Wasser-
leitung erhalten. Dann dürfte diese auf der Westfront in der Nahe
des Herrenbrünnleins (Abb. 67) in den Mauerring getreten sein. Ton-
rohre oder eine gemauerte Kanalleitung, welche mit Sicherheit
als rômisch angesproclien werden kônnten, sind bis jetzt in Zabern
aber nicht gefunden worden. Indessen fand Wierel ganz nahe dem
genannten Herrenbriinnlein beim StraBendurchbruch in der Kirch-
gasse (Punkt N) auf der Stadtseite der Mauerperipherie eiserne Ringe
einer hôlzernen Wasserleitimg. Ob diese mittelalterlich oder rômisch
1. J. Walter, ,,Neues vom alten rômischen Zabern*', Zabern or Wochenblatt
10. Mârz 1917.