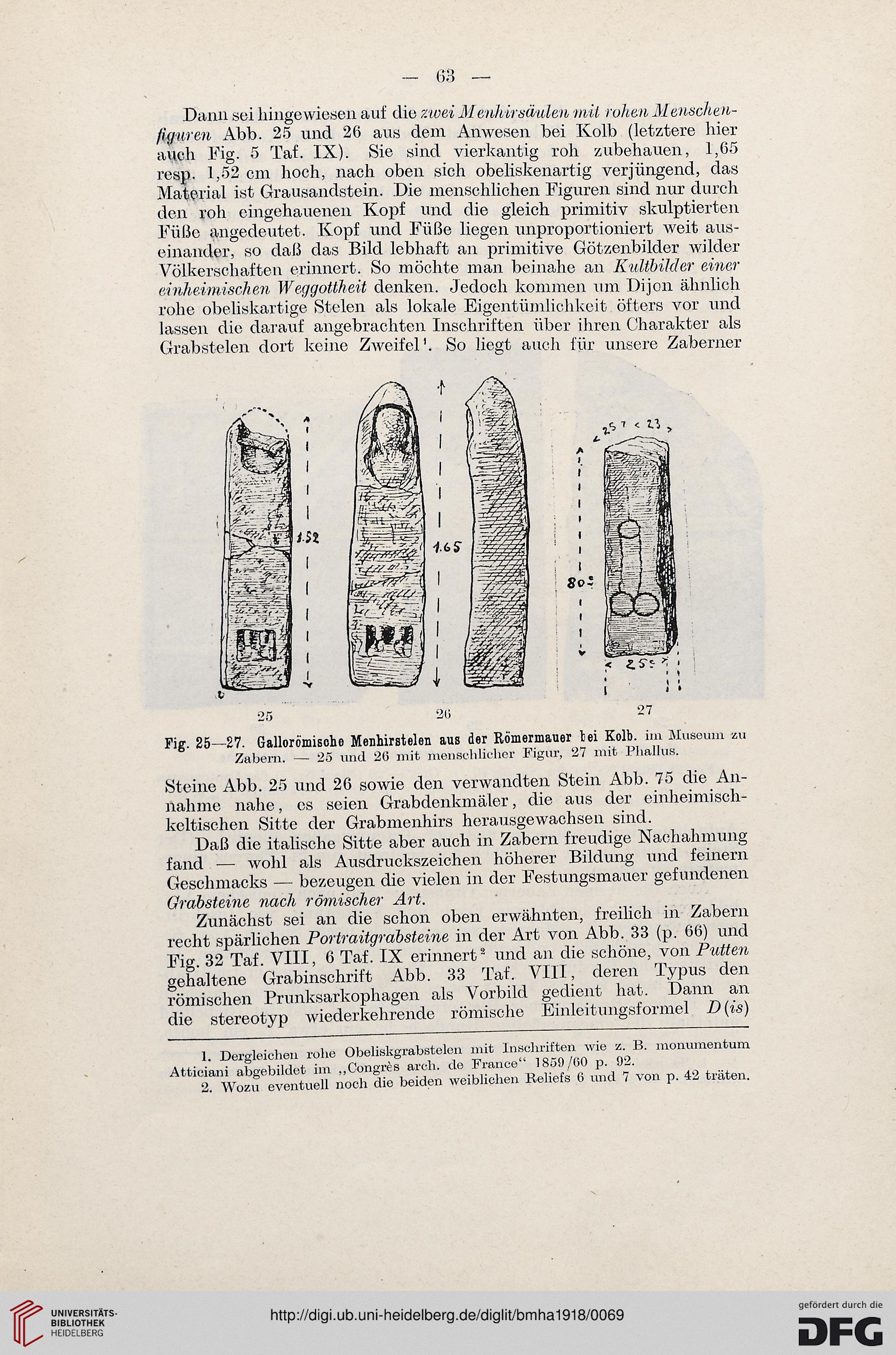Dann sei hingewiesen auf die zweiMenhirsàulen mit lohenMeusc/ieu-
figuren Abb. 25 und 26 ans dem Anwesen bei Kolb (letztere hier
auch Fig. 5 Taf. IX). Sie sind vierkantig roh zubehauen, 1,65
resp. 1,52 cm hoch, nach oben sich obeliskenartig verjüngend, das
Matçnial ist Grausandstein. Die menschlichen Figuren sind nur durch
den roh eingehauenen Kopf und die gleicli primitiv skulptierten
FüBc angedeutet. Kopf und FüBe liegen unproportioniert weit aus-
einander, so daB das Bild lebhaft an primitive Gôtzenbilder wilder
Vôlkerschaften erinnert. So môchte man beinahe an Kultbilder eincr
einheimischen Weggottheit denken. Jedoch konnnen um Dijon âlinlich
rohe obeliskartige Stelen als lokale Eigentümlichkeit ôfters vor und
lassen die darauf angebrachten Inschriften iiber ihren Charakter als
Grabstelen dort keine Zweifel1. So liegt aucli fiir unsere Zaberner
Fig. 25—27. Galloromisohe Menhirstelen aus der Rômermauer tei Kolb. im Muséum au
Zabem. — 25 und 20 mit menschliclier Figur, 27 mit Phallus.
Steine Abb. 25 und 26 sowie den verwandten Stein Abb. 75 die An-
nahme nahe, es seien Grabdenkmàler, die aus der einheimisch-
keltischen Sitte der Grabmenhirs herausgewachsen sind.
DaB die italische Sitte aber auch in Zabern freudige Nacdiahmung
fand — wolil als Ausdruckszeichen hôherer Bildung und feinern
Geschmacks — bezeugen die vielen in der Festungsmauer gefundenen
Grabsteine nach rômischer Art.
Zunachst sei an die schon oben erwâhnten, freilich in Zabern
redit spârlichen Portraitgrabsteine. in der Art von Abb. 33 (p. 66) und
Fig. 32 Taf. VIII, 6 Taf. IX erinnert1 2 und an die scliône, von Putten
gehaltene Grabinschrift Abb. 33 Taf. VIII, deren Typus den
romischen Prunksarkophagen als Vorbild gedient hat. Dann an
die stereotyp wiederkehrencle rômische Einleitungsformel D (ts)
1. Dergleiehen rohe Obeliskgrabstelen mit Inschriften wie z. B. monumentum
Atticiani abgebildet im ,,Congrès arcli. de France 1859/00 p. 92.
2. Wozu eventuell noch dio beiden weiblichen Reliefs 0 und 7 von p. 42 traten.
figuren Abb. 25 und 26 ans dem Anwesen bei Kolb (letztere hier
auch Fig. 5 Taf. IX). Sie sind vierkantig roh zubehauen, 1,65
resp. 1,52 cm hoch, nach oben sich obeliskenartig verjüngend, das
Matçnial ist Grausandstein. Die menschlichen Figuren sind nur durch
den roh eingehauenen Kopf und die gleicli primitiv skulptierten
FüBc angedeutet. Kopf und FüBe liegen unproportioniert weit aus-
einander, so daB das Bild lebhaft an primitive Gôtzenbilder wilder
Vôlkerschaften erinnert. So môchte man beinahe an Kultbilder eincr
einheimischen Weggottheit denken. Jedoch konnnen um Dijon âlinlich
rohe obeliskartige Stelen als lokale Eigentümlichkeit ôfters vor und
lassen die darauf angebrachten Inschriften iiber ihren Charakter als
Grabstelen dort keine Zweifel1. So liegt aucli fiir unsere Zaberner
Fig. 25—27. Galloromisohe Menhirstelen aus der Rômermauer tei Kolb. im Muséum au
Zabem. — 25 und 20 mit menschliclier Figur, 27 mit Phallus.
Steine Abb. 25 und 26 sowie den verwandten Stein Abb. 75 die An-
nahme nahe, es seien Grabdenkmàler, die aus der einheimisch-
keltischen Sitte der Grabmenhirs herausgewachsen sind.
DaB die italische Sitte aber auch in Zabern freudige Nacdiahmung
fand — wolil als Ausdruckszeichen hôherer Bildung und feinern
Geschmacks — bezeugen die vielen in der Festungsmauer gefundenen
Grabsteine nach rômischer Art.
Zunachst sei an die schon oben erwâhnten, freilich in Zabern
redit spârlichen Portraitgrabsteine. in der Art von Abb. 33 (p. 66) und
Fig. 32 Taf. VIII, 6 Taf. IX erinnert1 2 und an die scliône, von Putten
gehaltene Grabinschrift Abb. 33 Taf. VIII, deren Typus den
romischen Prunksarkophagen als Vorbild gedient hat. Dann an
die stereotyp wiederkehrencle rômische Einleitungsformel D (ts)
1. Dergleiehen rohe Obeliskgrabstelen mit Inschriften wie z. B. monumentum
Atticiani abgebildet im ,,Congrès arcli. de France 1859/00 p. 92.
2. Wozu eventuell noch dio beiden weiblichen Reliefs 0 und 7 von p. 42 traten.