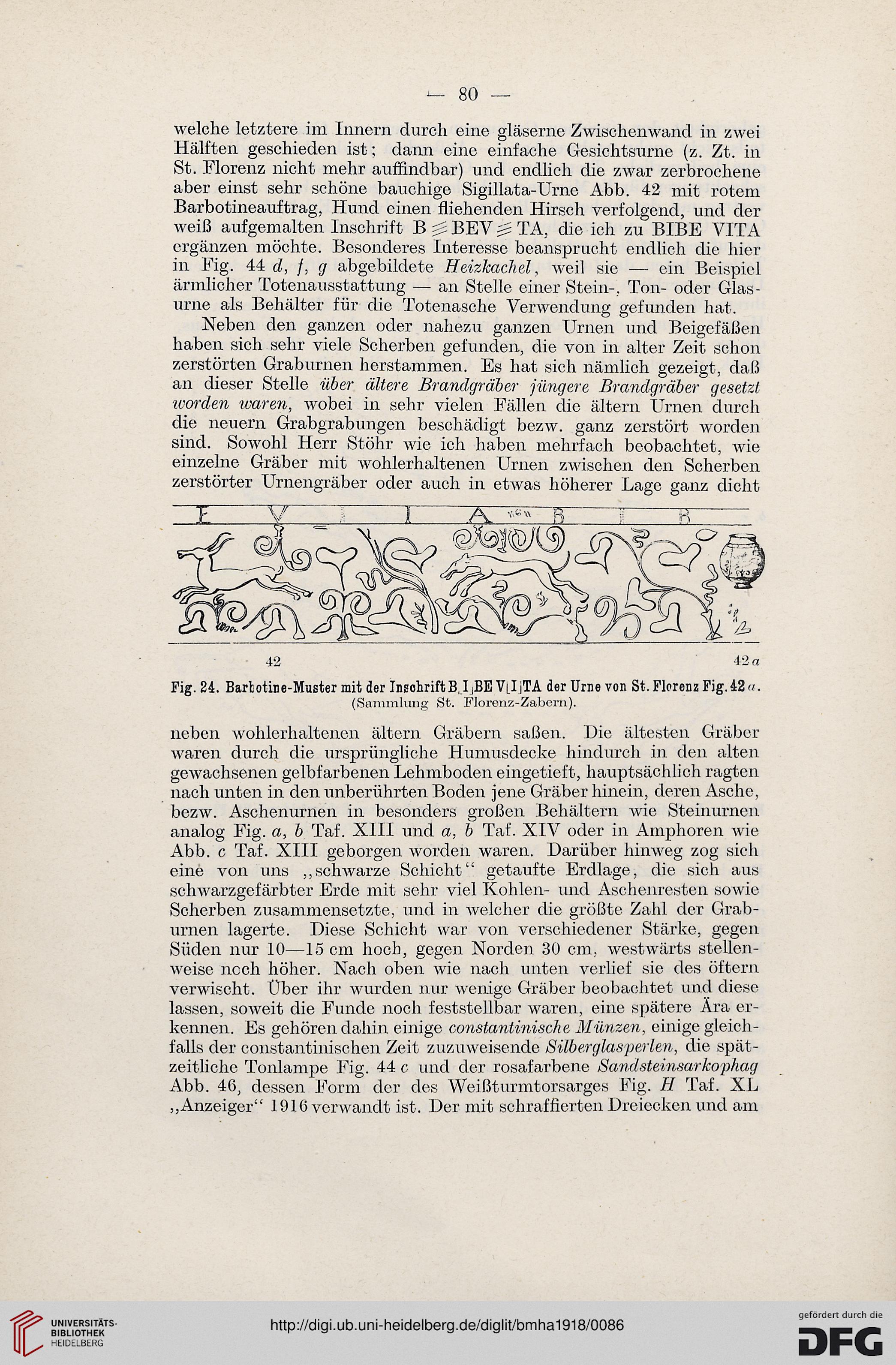80
welche letztere im Innern durch eine glâserne Zwischenwand in zwei
Hàlften geschieden ist ; dann eine einfache Gesichtsurne (z. Zt. in
St. Florenz nicht mehr auffindbar) und endlich die zwar zerbrochene
aber einst sehr schône bauchige Sigillata-Urne Abb. 42 mit rotem
Barbotineauftrag, Hund einen fliehenden Hirsch verfolgend, und der
weiB aufgemalten Inschrift B ^ BEV TA, die ich zu BIBE VIÏA
erganzen môchte. Besonderes Intéressé beansprucht endlich die hier
in Fig. 44 d, /, g abgebildete Heizkachel, weil sie — ein Beispiel
armlicher Totenausstattung - an Stelle einer Stein-, Ton- oder Glas-
urne als Behâlter für die Totenasche Verwendung gefunden hat.
Neben den ganzen oder nahezu ganzen Urnen und BeigefâBen
haben sich sehr viele Scherben gefunden, die von in alter Zeit schon
zerstorten Graburnen herstammen. Es hat sich nàmlich gezeigt, daB
an dieser Stelle über altéré Brandgrâber jüngere Brandgrâber gesetzt
tvorden waren, wobei in sehr vielen Fâllen die âltern Urnen durch
die neuern Grabgrabungen beschàdigt bezw. ganz zerstôrt worden
sind. Sowohl Herr Stôhr wie ich haben mehrfach beobachtet, wie
einzelne Grâber mit wohlerhaltenen Urnen zwischen den Scherben
zerstôrter Urnengraber oder auch in etwas hôherer Lage ganz clicht
Fig. 24. Barlotine-Muster mit der Insolirift B._I jBE V[IjTA der Urne von St. Florenz Fig.42«.
(Sammlung St. Fiorenz-Zabern).
neben wohlerhaltenen âltern Grâbern saBen. Die âltesten Grâber
waren durch die ursprüngliche Humusdecke hindurch in den alten
gewachsenen gelbfarbenen Lehmboden eingetieft, hauptsâchlich ragten
nach unten in den unberührten Boden jene Grâber hinein, deren Asche,
bezw. Aschenurnen in besonders groBen Behâltern wie Steinurnen
analog Fig. a, b Taf. XIII und a, b Taf. XIV oder in Amphoren wie
Abb. c Taf. XIII geborgen worden waren. Darüber liinweg zog sich
eine von uns ,,schwarze Schicht“ getaufte Erdlage, die sich aus
schwarzgefârbter Erde mit sehr viel Kohlen- und Asehenresten sowie
Scherben zusammensetzte, und in welcher die grôBte Zabi der Grab-
urnen lagerte. I)iese Schicht war von verschiedener Stârke, gegen
Siiden nur 10—15 cm hoch, gegen Norden 30 cm, westwârts stellen-
weise nccli hôher. Nach oben wie nach unten verlief sie des ôftern
verwischt. Über ihr wurden nur wenige Grâber beobachtet und diese
lassen, soweit die Funde noch feststellbar waren, eine spâtere Ara er-
kennen. Es gehôren dahin einige constantinische Münzen, einige gleich-
falls der constantinischen Zeit zuzuweisende Silberglasperlen, die spât-
zeitliche Tonlampe Fig. 44 c und der rosafarbene Sandsteinsarkophag
Abb. 46, dessen Form der des WeiBturmtorsarges Fig. H Taf. XL
,,Anzeiger“ 1916 verwandt ist. Der mit schraffierten Dreiecken und am
welche letztere im Innern durch eine glâserne Zwischenwand in zwei
Hàlften geschieden ist ; dann eine einfache Gesichtsurne (z. Zt. in
St. Florenz nicht mehr auffindbar) und endlich die zwar zerbrochene
aber einst sehr schône bauchige Sigillata-Urne Abb. 42 mit rotem
Barbotineauftrag, Hund einen fliehenden Hirsch verfolgend, und der
weiB aufgemalten Inschrift B ^ BEV TA, die ich zu BIBE VIÏA
erganzen môchte. Besonderes Intéressé beansprucht endlich die hier
in Fig. 44 d, /, g abgebildete Heizkachel, weil sie — ein Beispiel
armlicher Totenausstattung - an Stelle einer Stein-, Ton- oder Glas-
urne als Behâlter für die Totenasche Verwendung gefunden hat.
Neben den ganzen oder nahezu ganzen Urnen und BeigefâBen
haben sich sehr viele Scherben gefunden, die von in alter Zeit schon
zerstorten Graburnen herstammen. Es hat sich nàmlich gezeigt, daB
an dieser Stelle über altéré Brandgrâber jüngere Brandgrâber gesetzt
tvorden waren, wobei in sehr vielen Fâllen die âltern Urnen durch
die neuern Grabgrabungen beschàdigt bezw. ganz zerstôrt worden
sind. Sowohl Herr Stôhr wie ich haben mehrfach beobachtet, wie
einzelne Grâber mit wohlerhaltenen Urnen zwischen den Scherben
zerstôrter Urnengraber oder auch in etwas hôherer Lage ganz clicht
Fig. 24. Barlotine-Muster mit der Insolirift B._I jBE V[IjTA der Urne von St. Florenz Fig.42«.
(Sammlung St. Fiorenz-Zabern).
neben wohlerhaltenen âltern Grâbern saBen. Die âltesten Grâber
waren durch die ursprüngliche Humusdecke hindurch in den alten
gewachsenen gelbfarbenen Lehmboden eingetieft, hauptsâchlich ragten
nach unten in den unberührten Boden jene Grâber hinein, deren Asche,
bezw. Aschenurnen in besonders groBen Behâltern wie Steinurnen
analog Fig. a, b Taf. XIII und a, b Taf. XIV oder in Amphoren wie
Abb. c Taf. XIII geborgen worden waren. Darüber liinweg zog sich
eine von uns ,,schwarze Schicht“ getaufte Erdlage, die sich aus
schwarzgefârbter Erde mit sehr viel Kohlen- und Asehenresten sowie
Scherben zusammensetzte, und in welcher die grôBte Zabi der Grab-
urnen lagerte. I)iese Schicht war von verschiedener Stârke, gegen
Siiden nur 10—15 cm hoch, gegen Norden 30 cm, westwârts stellen-
weise nccli hôher. Nach oben wie nach unten verlief sie des ôftern
verwischt. Über ihr wurden nur wenige Grâber beobachtet und diese
lassen, soweit die Funde noch feststellbar waren, eine spâtere Ara er-
kennen. Es gehôren dahin einige constantinische Münzen, einige gleich-
falls der constantinischen Zeit zuzuweisende Silberglasperlen, die spât-
zeitliche Tonlampe Fig. 44 c und der rosafarbene Sandsteinsarkophag
Abb. 46, dessen Form der des WeiBturmtorsarges Fig. H Taf. XL
,,Anzeiger“ 1916 verwandt ist. Der mit schraffierten Dreiecken und am