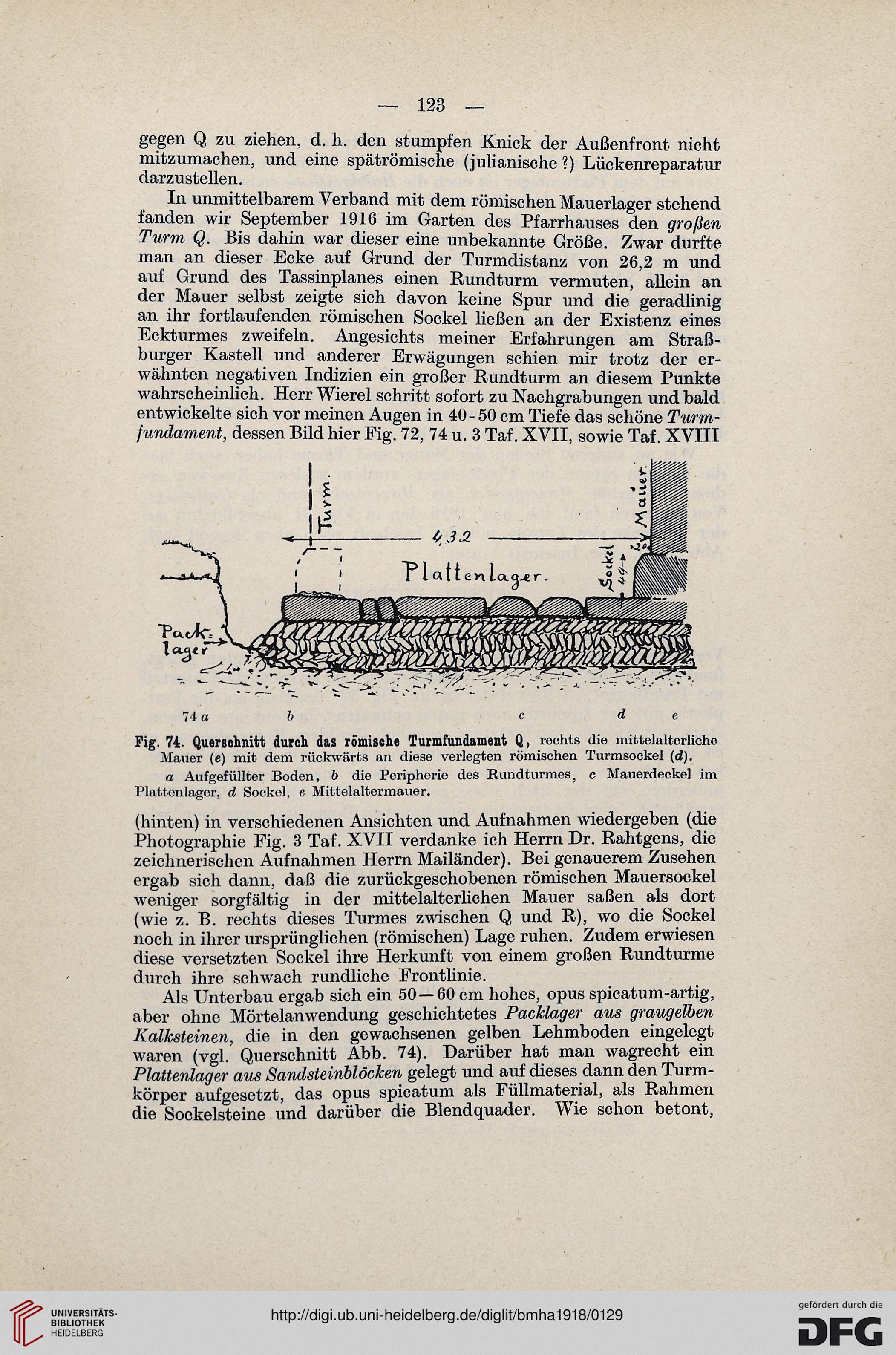123
gegen Q zu ziehen, d. h. den stumpfen Knick der AuBenfront nicht
mitzumachen, und eine spatrômische (julianische ?) Lückenreparatur
darzustellen.
In unmittelbarem Verband mit dem rômischen Mauerlager stehend
fanden wir September 1916 im Garten des Pfarrhauses den grofien
Turm Q. Bis dahin war dieser eine unbekannte GrôBe. Zwar durfte
man an dieser Ecke auf Grund der Turmdistanz von 26,2 m und
auf Grund des Tassinplanes einen Rundturm vermuten, allein an
der Mauer selbst zeigte sich davon keine Spur und die geradlinig
an ihr fortlaufenden rômischen Sockel lieBen an der Existenz eines
Eckturmes zweifeln. Angesichts meiner Erfahrungen am StraB-
burger Kastell und anderer Erwàgungen schien mir trotz der er-
wâhnten negativen Indizien ein groBer Rundturm an diesem Punkte
wahrscheinlich. Herr Wierel schritt sofort zu Nachgrabungen undbald
entwickelte sich vor meinen Augen in 40-50 cm Tiefe das schône Turm-
fimdament, dessen Bild hier Fig. 72, 74 u. 3 Taf. XVII, sowie Taf. XVIII
74 a 6 c de
Fig. 74. Querschnitt durch das rômische Turmfundament Q, rechts die mittelalterliche
Mauer (e) mit dem riickwarts an diese verlegten rômischen Turmsoekel (d).
a Aufgefüllter Boden, b die Peripherie des Rundturmes, c Mauerdeekel im
Plattenlager, d Sockel, e Mittelaltermauer.
(hinten) in verschiedenen Ansichten und Aufnahmen wiedergeben (die
Photographie Fig. 3 Taf. XVII verdanke ich Herrn Dr. Rahtgens, die
zeichnerischen Aufnahmen Herrn Mailânder). Bei genauerem Zusehen
ergab sich dann, daB die zurückgeschobenen rômischen Mauersockel
weniger sorgfâltig in der mittelalterlichen Mauer saBen als dort
(wie z. B. rechts dieses Turmes zwischen Q und R), wo die Sockel
noch in ihrer ursprünglichen (rômischen) Lage ruhen. Zudem erwiesen
diese versetzten Sockel ihre Herkunft von einem groBen Rundturme
durch ihre schwach rundliche Frontlinie.
Als Unterbau ergab sich ein 50—60 cm hohes, opus spicatum-artig,
aber ohne Môrtelanwendung geschichtetes Packlager aus graugelben
Kalksteinen, die in den gewachsenen gelben Lehmboden eingelegt
waren (vgl. Querschnitt Abb. 74). Darüber hat man wagrecht ein
Plattenlager aus Sandsteinblôcken gelegt und auf dieses dann den Turm-
kôrper aufgesetzt, das opus spicatum als Fiillmaterial, als Rahmen
die Sockelsteine und darüber die Blendquader. Wie schon betont,
gegen Q zu ziehen, d. h. den stumpfen Knick der AuBenfront nicht
mitzumachen, und eine spatrômische (julianische ?) Lückenreparatur
darzustellen.
In unmittelbarem Verband mit dem rômischen Mauerlager stehend
fanden wir September 1916 im Garten des Pfarrhauses den grofien
Turm Q. Bis dahin war dieser eine unbekannte GrôBe. Zwar durfte
man an dieser Ecke auf Grund der Turmdistanz von 26,2 m und
auf Grund des Tassinplanes einen Rundturm vermuten, allein an
der Mauer selbst zeigte sich davon keine Spur und die geradlinig
an ihr fortlaufenden rômischen Sockel lieBen an der Existenz eines
Eckturmes zweifeln. Angesichts meiner Erfahrungen am StraB-
burger Kastell und anderer Erwàgungen schien mir trotz der er-
wâhnten negativen Indizien ein groBer Rundturm an diesem Punkte
wahrscheinlich. Herr Wierel schritt sofort zu Nachgrabungen undbald
entwickelte sich vor meinen Augen in 40-50 cm Tiefe das schône Turm-
fimdament, dessen Bild hier Fig. 72, 74 u. 3 Taf. XVII, sowie Taf. XVIII
74 a 6 c de
Fig. 74. Querschnitt durch das rômische Turmfundament Q, rechts die mittelalterliche
Mauer (e) mit dem riickwarts an diese verlegten rômischen Turmsoekel (d).
a Aufgefüllter Boden, b die Peripherie des Rundturmes, c Mauerdeekel im
Plattenlager, d Sockel, e Mittelaltermauer.
(hinten) in verschiedenen Ansichten und Aufnahmen wiedergeben (die
Photographie Fig. 3 Taf. XVII verdanke ich Herrn Dr. Rahtgens, die
zeichnerischen Aufnahmen Herrn Mailânder). Bei genauerem Zusehen
ergab sich dann, daB die zurückgeschobenen rômischen Mauersockel
weniger sorgfâltig in der mittelalterlichen Mauer saBen als dort
(wie z. B. rechts dieses Turmes zwischen Q und R), wo die Sockel
noch in ihrer ursprünglichen (rômischen) Lage ruhen. Zudem erwiesen
diese versetzten Sockel ihre Herkunft von einem groBen Rundturme
durch ihre schwach rundliche Frontlinie.
Als Unterbau ergab sich ein 50—60 cm hohes, opus spicatum-artig,
aber ohne Môrtelanwendung geschichtetes Packlager aus graugelben
Kalksteinen, die in den gewachsenen gelben Lehmboden eingelegt
waren (vgl. Querschnitt Abb. 74). Darüber hat man wagrecht ein
Plattenlager aus Sandsteinblôcken gelegt und auf dieses dann den Turm-
kôrper aufgesetzt, das opus spicatum als Fiillmaterial, als Rahmen
die Sockelsteine und darüber die Blendquader. Wie schon betont,