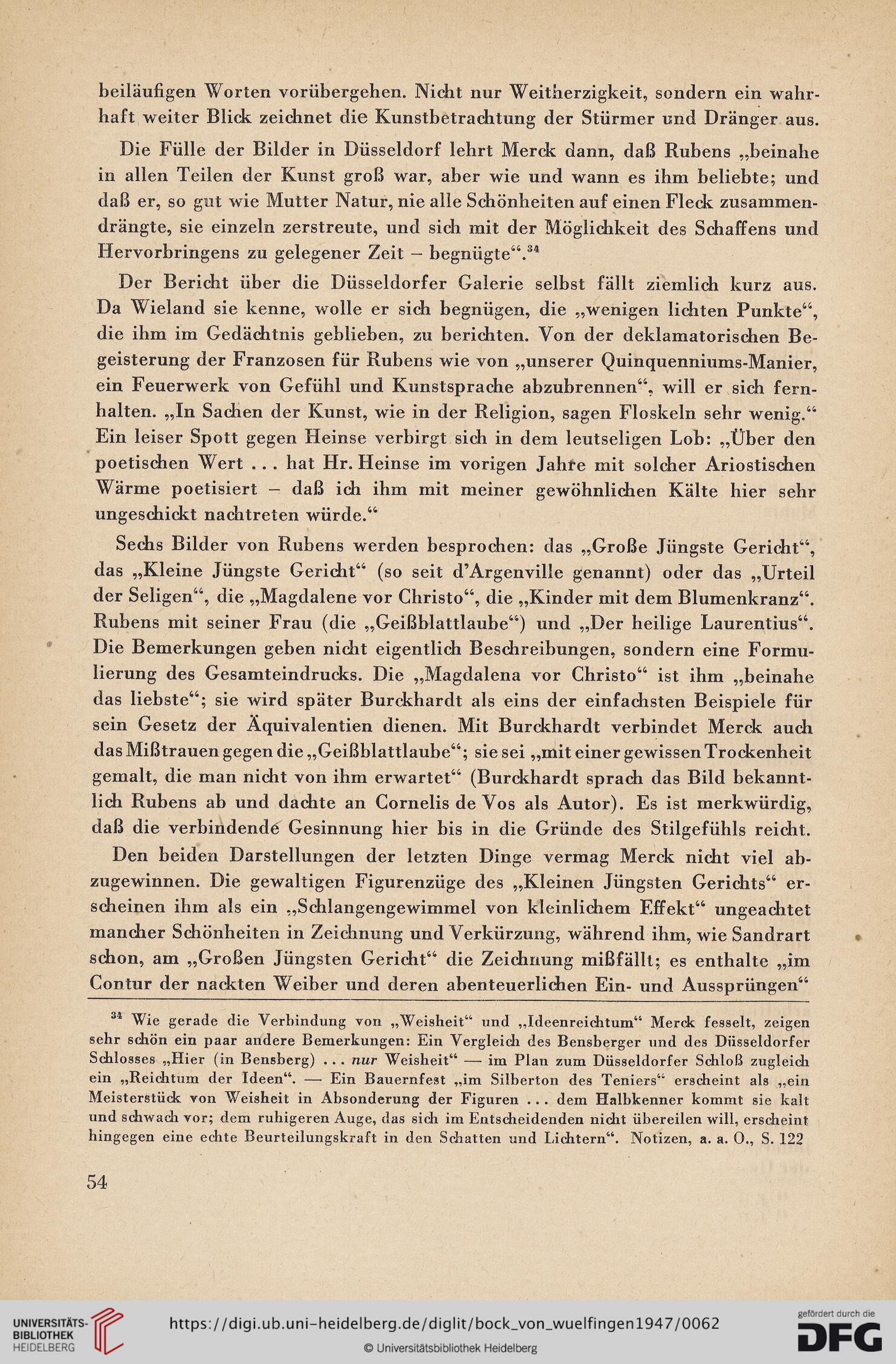beiläufigen Worten vorübergehen. Nicht nur Weitherzigkeit, sondern ein wahr-
haft weiter Blick zeichnet die Kunstbetrachtung der Stürmer und Dränger aus.
Die Fülle der Bilder in Düsseldorf lehrt Merck dann, daß Rubens „beinahe
in allen Teilen der Kunst groß war, aber wie und wann es ihm beliebte; und
daß er, so gut wie Mutter Natur, nie alle Schönheiten auf einen Fleck zusammen-
drängte, sie einzeln zerstreute, und sich mit der Möglichkeit des Schaffens und
Hervorbringens zu gelegener Zeit — begnügte“.34
Der Bericht über die Düsseldorfer Galerie selbst fällt ziemlich kurz aus.
Da Wieland sie kenne, wolle er sich begnügen, die „wenigen lichten Punkte“,
die ihm im Gedächtnis geblieben, zu berichten. Von der deklamatorischen Be-
geisterung der Franzosen für Rubens wie von „unserer Quinquenniums-Manier,
ein Feuerwerk von Gefühl und Kunstsprache abzubrennen“, will er sich fern-
halten. „In Sachen der Kunst, wie in der Religion, sagen Floskeln sehr wenig.“
Ein leiser Spott gegen Heinse verbirgt sich in dem leutseligen Lob: „Über den
poetischen Wert . . . hat Hr. Heinse im vorigen Jahre mit solcher Ariostischen
Wärme poetisiert — daß ich ihm mit meiner gewöhnlichen Kälte hier sehr
ungeschickt nachtreten würde.“
Sechs Bilder von Rubens werden besprochen: das „Große Jüngste Gericht“,
das „Kleine Jüngste Gericht“ (so seit d’Argenville genannt) oder das „Urteil
der Seligen“, die „Magdalene vor Christo“, die „Kinder mit dem Blumenkranz“.
Rubens mit seiner Frau (die „Geißblattlaube“) und „Der heilige Laurentius“.
Die Bemerkungen geben nicht eigentlich Beschreibungen, sondern eine Formu-
lierung des Gesamteindrucks. Die „Magdalena vor Christo“ ist ihm „beinahe
das liebste“; sie wird später Burckhardt als eins der einfachsten Beispiele für
sein Gesetz der Äquivalentien dienen. Mit Burckhardt verbindet Merck auch
das Mißtrauen gegen die „Geißblattlaube“; sie sei „mit einer gewissen Trockenheit
gemalt, die man nicht von ihm erwartet“ (Burckhardt sprach das Bild bekannt-
lich Rubens ab und dachte an Cornelis de Vos als Autor). Es ist merkwürdig,
daß die verbindende Gesinnung hier bis in die Gründe des Stilgefühls reicht.
Den beiden Darstellungen der letzten Dinge vermag Merck nicht viel ab-
zugewinnen. Die gewaltigen Figurenzüge des „Kleinen Jüngsten Gerichts“ er-
scheinen ihm als ein „Schlangengewimmel von kleinlichem Effekt“ ungeachtet
mancher Schönheiten in Zeichnung und Verkürzung, während ihm, wie Sandrart
schon, am „Großen Jüngsten Gericht“ die Zeichnung mißfällt; es enthalte „im
Contur der nackten Weiber und deren abenteuerlichen Ein- und Aussprüngen“
34 Wie gerade die Verbindung von „Weisheit“ und „Ideenreichtum“ Merck fesselt, zeigen
sehr schön ein paar andere Bemerkungen: Ein Vergleich des Bensberger und des Düsseldorfer
Schlosses „Hier (in Bensberg) .. . nur Weisheit“ — im Plan zum Düsseldorfer Schloß zugleich
ein „Reichtum der Ideen“. — Ein Bauernfest „im Silberton des Teniers“ erscheint als „ein
Meisterstück von Weisheit in Absonderung der Figuren .. . dem Halbkenner kommt sie kalt
und schwach vor; dem ruhigeren Auge, das sich im Entscheidenden nicht übereilen will, erscheint
hingegen eine echte Beurteilungskraft in den Schatten und Lichtern“. Notizen, a. a. 0., S. 122
54
haft weiter Blick zeichnet die Kunstbetrachtung der Stürmer und Dränger aus.
Die Fülle der Bilder in Düsseldorf lehrt Merck dann, daß Rubens „beinahe
in allen Teilen der Kunst groß war, aber wie und wann es ihm beliebte; und
daß er, so gut wie Mutter Natur, nie alle Schönheiten auf einen Fleck zusammen-
drängte, sie einzeln zerstreute, und sich mit der Möglichkeit des Schaffens und
Hervorbringens zu gelegener Zeit — begnügte“.34
Der Bericht über die Düsseldorfer Galerie selbst fällt ziemlich kurz aus.
Da Wieland sie kenne, wolle er sich begnügen, die „wenigen lichten Punkte“,
die ihm im Gedächtnis geblieben, zu berichten. Von der deklamatorischen Be-
geisterung der Franzosen für Rubens wie von „unserer Quinquenniums-Manier,
ein Feuerwerk von Gefühl und Kunstsprache abzubrennen“, will er sich fern-
halten. „In Sachen der Kunst, wie in der Religion, sagen Floskeln sehr wenig.“
Ein leiser Spott gegen Heinse verbirgt sich in dem leutseligen Lob: „Über den
poetischen Wert . . . hat Hr. Heinse im vorigen Jahre mit solcher Ariostischen
Wärme poetisiert — daß ich ihm mit meiner gewöhnlichen Kälte hier sehr
ungeschickt nachtreten würde.“
Sechs Bilder von Rubens werden besprochen: das „Große Jüngste Gericht“,
das „Kleine Jüngste Gericht“ (so seit d’Argenville genannt) oder das „Urteil
der Seligen“, die „Magdalene vor Christo“, die „Kinder mit dem Blumenkranz“.
Rubens mit seiner Frau (die „Geißblattlaube“) und „Der heilige Laurentius“.
Die Bemerkungen geben nicht eigentlich Beschreibungen, sondern eine Formu-
lierung des Gesamteindrucks. Die „Magdalena vor Christo“ ist ihm „beinahe
das liebste“; sie wird später Burckhardt als eins der einfachsten Beispiele für
sein Gesetz der Äquivalentien dienen. Mit Burckhardt verbindet Merck auch
das Mißtrauen gegen die „Geißblattlaube“; sie sei „mit einer gewissen Trockenheit
gemalt, die man nicht von ihm erwartet“ (Burckhardt sprach das Bild bekannt-
lich Rubens ab und dachte an Cornelis de Vos als Autor). Es ist merkwürdig,
daß die verbindende Gesinnung hier bis in die Gründe des Stilgefühls reicht.
Den beiden Darstellungen der letzten Dinge vermag Merck nicht viel ab-
zugewinnen. Die gewaltigen Figurenzüge des „Kleinen Jüngsten Gerichts“ er-
scheinen ihm als ein „Schlangengewimmel von kleinlichem Effekt“ ungeachtet
mancher Schönheiten in Zeichnung und Verkürzung, während ihm, wie Sandrart
schon, am „Großen Jüngsten Gericht“ die Zeichnung mißfällt; es enthalte „im
Contur der nackten Weiber und deren abenteuerlichen Ein- und Aussprüngen“
34 Wie gerade die Verbindung von „Weisheit“ und „Ideenreichtum“ Merck fesselt, zeigen
sehr schön ein paar andere Bemerkungen: Ein Vergleich des Bensberger und des Düsseldorfer
Schlosses „Hier (in Bensberg) .. . nur Weisheit“ — im Plan zum Düsseldorfer Schloß zugleich
ein „Reichtum der Ideen“. — Ein Bauernfest „im Silberton des Teniers“ erscheint als „ein
Meisterstück von Weisheit in Absonderung der Figuren .. . dem Halbkenner kommt sie kalt
und schwach vor; dem ruhigeren Auge, das sich im Entscheidenden nicht übereilen will, erscheint
hingegen eine echte Beurteilungskraft in den Schatten und Lichtern“. Notizen, a. a. 0., S. 122
54