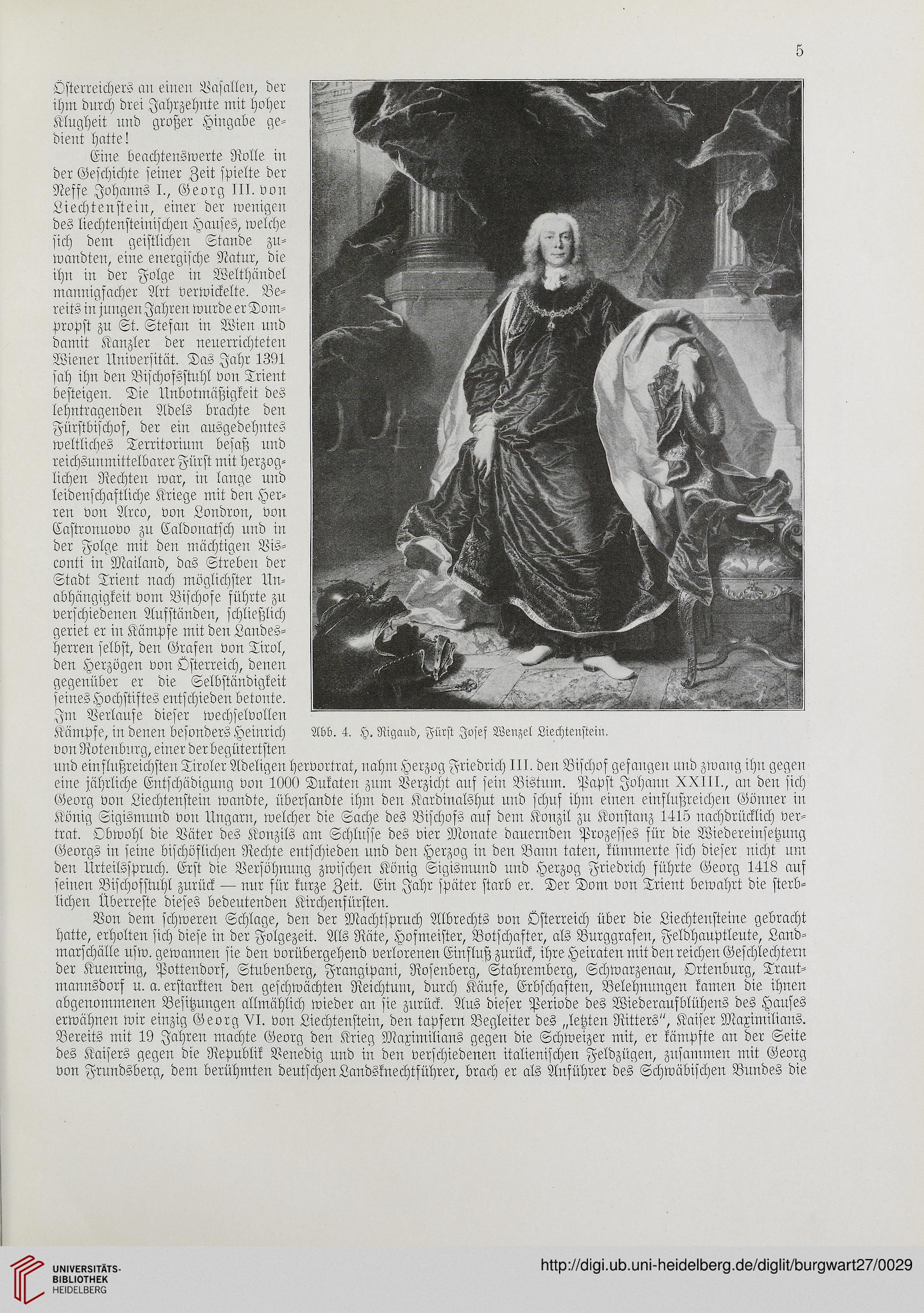5
Österreichers an eineil Basalten, der
ihm durch drei Jahrzehnte mit hoher
Klugheit Mid großer Hingabe ge-
dient hatte!
Eine beachtenswerte Rolle in
der Geschichte seiner Zeit spielte der
Neffe Johanns I., Georg III. von
Liechtenstein, einer der wenigen
des liechtensteinischen Hauses, welche
sich dem geistlichen Stande zu-
wandten, eine energische Natur, die
ihn in der Folge in Welthandel
mannigfacher Art verwickelte. Be-
reits in jungen Jahren wurde er Dom-
propst zu St. Stefan in Wien und
damit Kanzler der neuerrichteten
Wiener Universität. Das Jahr 1391
sah ihn den Bischofsstnhl von Trient
besteigen. Die Unbotmäßigkeit des
lehntragenden Adels brachte den
Fürstbischof, der ein ausgedehntes
weltliches Territorium besaß und
reichsunmittelbarer Fürst mit herzog-
lichen Rechten war, in lange und
leidenschaftliche Kriege mit den Her-
ren von Arco, von Londron, von
Castronuovo zu Caldonatsch und in
der Folge mit den mächtigen Vis-
conti in Mailand, das Streben der
Stadt Trient nach möglichster Un-
abhängigkeit vom Bischöfe führte zu
verschiedenen Aufständen, schließlich
geriet er in Kämpfe mit den Landes-
herren selbst, den Grafen von Tirol,
den Herzögen von Österreich, denen
gegenüber er die Selbständigkeit
seines Hochstiftes entschieden betonte.
Im Verlaufe dieser wechselvollen
Kämpfe, in denen besonders Heinrich Abb. 4. H. Rigaud, Fürst Josef Wenzel Liechtenstein,
von Rotenburg, einer der begütertsten
und einflußreichsten Tiroler Adeligen hervortrat, nahm Herzog Friedrich III. den Bischof gefangen und zwang ihn gegen
eine jährliche Entschädigung von 1000 Dukaten zum Verzicht auf sein Bistum. Papst Johann XXIII., an den sich
Georg von Liechtenstein wandte, übersandte ihm den Kardinälshut und schuf ihm einen einflußreichen Gönner in
König Sigismund Volt Ungarn, welcher die Sache des Bischofs auf dem Konzil zu Konstanz 1415 nachdrücklich ver-
trat. Obwohl die Väter des Konzils am Schlüsse des vier Monate dauernden Prozesses für die Wiedereinsetzung
Georgs in seine bischöflichen Rechte entschieden und den Herzog in den Bann taten, kümmerte sich dieser nicht um
den Urteilsspruch. Erst die Versöhnung zwischen König Sigismund und Herzog Friedrich führte Georg 1418 auf
seinen Bischofstuhl zurück — nur für kurze Zeit. Ein Jahr später starb er. Der Dom von Trient bewahrt die sterb-
lichen Überreste dieses bedeutenden Kirchenfürsten.
Von dem schweren Schlage, den der Machtspruch Albrechts von Österreich über die Liechtensteine gebracht
hatte, erholten sich diese in der Folgezeit. Als Räte, Hofmeister, Botschafter, als Burggrafen, Feldhanptleute, Land-
marschälle usw. gewannen sie den vorübergehend verlorenen Einfluß zurück, ihre Heiraten mit den reichen Geschlechtern
der Kuenring, Pottendorf, Stnbenberg, Frangipani, Rosenberg, Stahremberg, Schwarzenau, Ortenburg, Traut-
mannsdorf u. a. erstarkten den geschwächten Reichtum, durch Käufe, Erbschaften, Belehnungen kamen die ihnen
abgenommenen Besitzungen allmählich wieder an sie zurück. Ans dieser Periode des Wiederaufblühens des Hauses
erwähnen wir einzig Georg VI. von Liechtenstein, den tapfern Begleiter des „letzten Ritters", Kaiser Maximilians.
Bereits mit 19 Jahren machte Georg den Krieg Maximilians gegen die Schweizer mit, er kämpfte an der Seite
des Kaisers gegen die Republik Venedig und in den verschiedenen italienischen Feldzügen, zusammen mit Georg
von Frundsberg, dem berühmten deutschen Landsknechtführer, brach er als Anführer des Schwäbischen Bundes die
Österreichers an eineil Basalten, der
ihm durch drei Jahrzehnte mit hoher
Klugheit Mid großer Hingabe ge-
dient hatte!
Eine beachtenswerte Rolle in
der Geschichte seiner Zeit spielte der
Neffe Johanns I., Georg III. von
Liechtenstein, einer der wenigen
des liechtensteinischen Hauses, welche
sich dem geistlichen Stande zu-
wandten, eine energische Natur, die
ihn in der Folge in Welthandel
mannigfacher Art verwickelte. Be-
reits in jungen Jahren wurde er Dom-
propst zu St. Stefan in Wien und
damit Kanzler der neuerrichteten
Wiener Universität. Das Jahr 1391
sah ihn den Bischofsstnhl von Trient
besteigen. Die Unbotmäßigkeit des
lehntragenden Adels brachte den
Fürstbischof, der ein ausgedehntes
weltliches Territorium besaß und
reichsunmittelbarer Fürst mit herzog-
lichen Rechten war, in lange und
leidenschaftliche Kriege mit den Her-
ren von Arco, von Londron, von
Castronuovo zu Caldonatsch und in
der Folge mit den mächtigen Vis-
conti in Mailand, das Streben der
Stadt Trient nach möglichster Un-
abhängigkeit vom Bischöfe führte zu
verschiedenen Aufständen, schließlich
geriet er in Kämpfe mit den Landes-
herren selbst, den Grafen von Tirol,
den Herzögen von Österreich, denen
gegenüber er die Selbständigkeit
seines Hochstiftes entschieden betonte.
Im Verlaufe dieser wechselvollen
Kämpfe, in denen besonders Heinrich Abb. 4. H. Rigaud, Fürst Josef Wenzel Liechtenstein,
von Rotenburg, einer der begütertsten
und einflußreichsten Tiroler Adeligen hervortrat, nahm Herzog Friedrich III. den Bischof gefangen und zwang ihn gegen
eine jährliche Entschädigung von 1000 Dukaten zum Verzicht auf sein Bistum. Papst Johann XXIII., an den sich
Georg von Liechtenstein wandte, übersandte ihm den Kardinälshut und schuf ihm einen einflußreichen Gönner in
König Sigismund Volt Ungarn, welcher die Sache des Bischofs auf dem Konzil zu Konstanz 1415 nachdrücklich ver-
trat. Obwohl die Väter des Konzils am Schlüsse des vier Monate dauernden Prozesses für die Wiedereinsetzung
Georgs in seine bischöflichen Rechte entschieden und den Herzog in den Bann taten, kümmerte sich dieser nicht um
den Urteilsspruch. Erst die Versöhnung zwischen König Sigismund und Herzog Friedrich führte Georg 1418 auf
seinen Bischofstuhl zurück — nur für kurze Zeit. Ein Jahr später starb er. Der Dom von Trient bewahrt die sterb-
lichen Überreste dieses bedeutenden Kirchenfürsten.
Von dem schweren Schlage, den der Machtspruch Albrechts von Österreich über die Liechtensteine gebracht
hatte, erholten sich diese in der Folgezeit. Als Räte, Hofmeister, Botschafter, als Burggrafen, Feldhanptleute, Land-
marschälle usw. gewannen sie den vorübergehend verlorenen Einfluß zurück, ihre Heiraten mit den reichen Geschlechtern
der Kuenring, Pottendorf, Stnbenberg, Frangipani, Rosenberg, Stahremberg, Schwarzenau, Ortenburg, Traut-
mannsdorf u. a. erstarkten den geschwächten Reichtum, durch Käufe, Erbschaften, Belehnungen kamen die ihnen
abgenommenen Besitzungen allmählich wieder an sie zurück. Ans dieser Periode des Wiederaufblühens des Hauses
erwähnen wir einzig Georg VI. von Liechtenstein, den tapfern Begleiter des „letzten Ritters", Kaiser Maximilians.
Bereits mit 19 Jahren machte Georg den Krieg Maximilians gegen die Schweizer mit, er kämpfte an der Seite
des Kaisers gegen die Republik Venedig und in den verschiedenen italienischen Feldzügen, zusammen mit Georg
von Frundsberg, dem berühmten deutschen Landsknechtführer, brach er als Anführer des Schwäbischen Bundes die