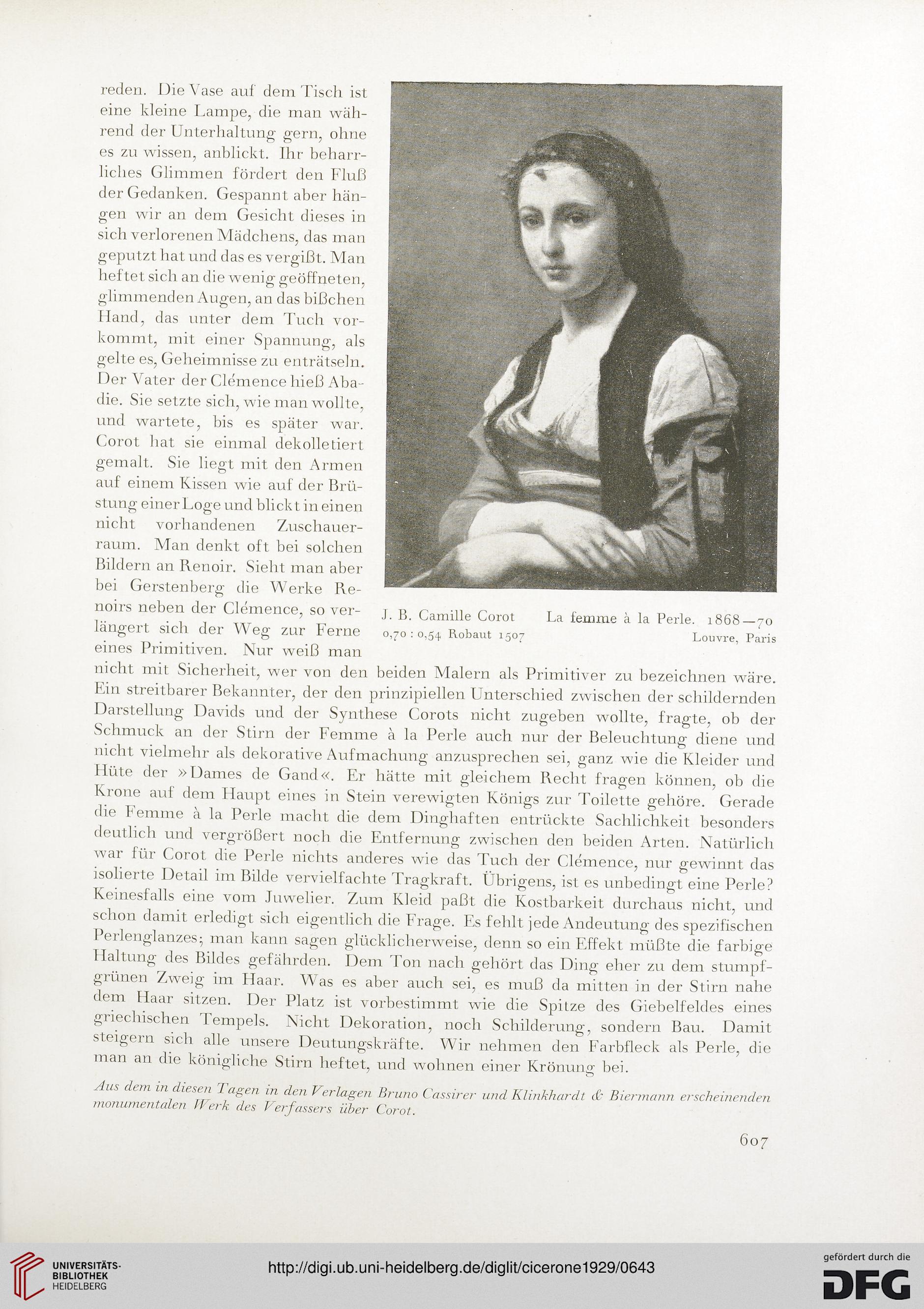Der Cicerone: Halbmonatsschrift für die Interessen des Kunstforschers & Sammlers — 21.1929
Zitieren dieser Seite
Bitte zitieren Sie diese Seite, indem Sie folgende Adresse (URL)/folgende DOI benutzen:
https://doi.org/10.11588/diglit.41323#0643
DOI Heft:
Heft 21
DOI Artikel:Meier-Graefe, Julius: Der Figurenmaler Corot
DOI Seite / Zitierlink:https://doi.org/10.11588/diglit.41323#0643
reden. Die Vase auf dem Tisch ist
eine kleine Lampe, die man wäh-
rend der Unterhaltung gern, ohne
es zu wissen, anblickt. Ihr beharr-
liches Glimmen fördert den Fluß
der Gedanken. Gespannt aber hän-
gen wir an dem Gesicht dieses in
sich verlorenen Mädchens, das man
geputzt hat und das es vergißt. Man
heftet sich an die wenig geöffneten,
glimmenden Augen, an das bißchen
Hand, das unter dem Tuch vor-
kommt, mit einer Spannung, als
gelte es, Geheimnisse zu enträtseln.
Der Vater der Clemence hieß Aba-
die. Sie setzte sich, wie man wollte,
und wartete, bis es später war.
Corot hat sie einmal dekolletiert
gemalt. Sie liegt mit den Armen
auf einem Kissen wie auf der Brü-
stung einer Loge und blickt in einen
nicht vorhandenen Zuschauer-
raum. Man denkt oft bei solchen
Bildern an Renoir. Sieht man aber
bei Gerstenberg die Werke Re-
non s neben der Clemence, so ver- j. p Camille Corot La femme ä la Perle. 1868—70
längert sich der Weg ZUr Ferne 0,70:0,54 Robaut 1507 Louvre, Paris
eines Primitiven. Nur weiß man
nicht mit Sicherheit, wer von den beiden Malern als Primitiver zu bezeichnen wäre.
Ein streitbarer Bekannter, der den prinzipiellen Unterschied zwischen der schildernden
Darstellung Davids und der Synthese Corots nicht zugeben wollte, fragte, ob der
Schmuck an der Stirn der Femme ä la Perle auch nur der Beleuchtung diene und
nicht vielmehr als dekorative Aufmachung anzusprechen sei, ganz wie die Kleider und
Hüte der »Harnes de Gand«. Er hätte mit gleichem Recht fragen können, ob die
Krone auf dem Haupt eines in Stein verewigten Königs zur Toilette gehöre. Gerade
die Femme ä la Perle macht die dem Dinghaften entrückte Sachlichkeit besonders
deutlich und vergrößert noch die Entfernung zwischen den beiden Arten. Natürlich
war für Corot die Perle nichts anderes wie das Tuch der Clemence, nur gewinnt das
isolierte Detail im Bilde vervielfachte Tragkraft. Übrigens, ist es unbedingt eine Perle?
Keinesfalls eine vom Juwelier. Zum Kleid paßt die Kostbarkeit durchaus nicht, und
schon damit erledigt sich eigentlich die Frage. Es fehlt jede Andeutung des spezifischen
Perlenglanzes■ man kann sagen glücklicherweise, denn so ein Effekt müßte die farbige
Haltung des Bildes gefährden. Dem Ton nach gehört das Ding eher zu dem stumpf-
grünen Zweig im Haar. Was es aber auch sei, es muß da mitten in der Stirn nahe
dem Haar sitzen. Der Platz ist vorbestimmt wie die Spitze des Giebelfeldes eines
griechischen Tempels. Nicht Dekoration, noch Schilderung, sondern Bau. Damit
steigern sich alle unsere Deutungskräfte. Wir nehmen den Farbfleck als Perle, die
man an die königliche Stirn heftet, und wohnen einer Krönung bei.
Aus dem in diesen Tagen in den Verlagen Bruno Cassirer und Klinkhardt & Biermann erscheinenden
monumentalen Werk des Verfassers über Corot.
607
eine kleine Lampe, die man wäh-
rend der Unterhaltung gern, ohne
es zu wissen, anblickt. Ihr beharr-
liches Glimmen fördert den Fluß
der Gedanken. Gespannt aber hän-
gen wir an dem Gesicht dieses in
sich verlorenen Mädchens, das man
geputzt hat und das es vergißt. Man
heftet sich an die wenig geöffneten,
glimmenden Augen, an das bißchen
Hand, das unter dem Tuch vor-
kommt, mit einer Spannung, als
gelte es, Geheimnisse zu enträtseln.
Der Vater der Clemence hieß Aba-
die. Sie setzte sich, wie man wollte,
und wartete, bis es später war.
Corot hat sie einmal dekolletiert
gemalt. Sie liegt mit den Armen
auf einem Kissen wie auf der Brü-
stung einer Loge und blickt in einen
nicht vorhandenen Zuschauer-
raum. Man denkt oft bei solchen
Bildern an Renoir. Sieht man aber
bei Gerstenberg die Werke Re-
non s neben der Clemence, so ver- j. p Camille Corot La femme ä la Perle. 1868—70
längert sich der Weg ZUr Ferne 0,70:0,54 Robaut 1507 Louvre, Paris
eines Primitiven. Nur weiß man
nicht mit Sicherheit, wer von den beiden Malern als Primitiver zu bezeichnen wäre.
Ein streitbarer Bekannter, der den prinzipiellen Unterschied zwischen der schildernden
Darstellung Davids und der Synthese Corots nicht zugeben wollte, fragte, ob der
Schmuck an der Stirn der Femme ä la Perle auch nur der Beleuchtung diene und
nicht vielmehr als dekorative Aufmachung anzusprechen sei, ganz wie die Kleider und
Hüte der »Harnes de Gand«. Er hätte mit gleichem Recht fragen können, ob die
Krone auf dem Haupt eines in Stein verewigten Königs zur Toilette gehöre. Gerade
die Femme ä la Perle macht die dem Dinghaften entrückte Sachlichkeit besonders
deutlich und vergrößert noch die Entfernung zwischen den beiden Arten. Natürlich
war für Corot die Perle nichts anderes wie das Tuch der Clemence, nur gewinnt das
isolierte Detail im Bilde vervielfachte Tragkraft. Übrigens, ist es unbedingt eine Perle?
Keinesfalls eine vom Juwelier. Zum Kleid paßt die Kostbarkeit durchaus nicht, und
schon damit erledigt sich eigentlich die Frage. Es fehlt jede Andeutung des spezifischen
Perlenglanzes■ man kann sagen glücklicherweise, denn so ein Effekt müßte die farbige
Haltung des Bildes gefährden. Dem Ton nach gehört das Ding eher zu dem stumpf-
grünen Zweig im Haar. Was es aber auch sei, es muß da mitten in der Stirn nahe
dem Haar sitzen. Der Platz ist vorbestimmt wie die Spitze des Giebelfeldes eines
griechischen Tempels. Nicht Dekoration, noch Schilderung, sondern Bau. Damit
steigern sich alle unsere Deutungskräfte. Wir nehmen den Farbfleck als Perle, die
man an die königliche Stirn heftet, und wohnen einer Krönung bei.
Aus dem in diesen Tagen in den Verlagen Bruno Cassirer und Klinkhardt & Biermann erscheinenden
monumentalen Werk des Verfassers über Corot.
607