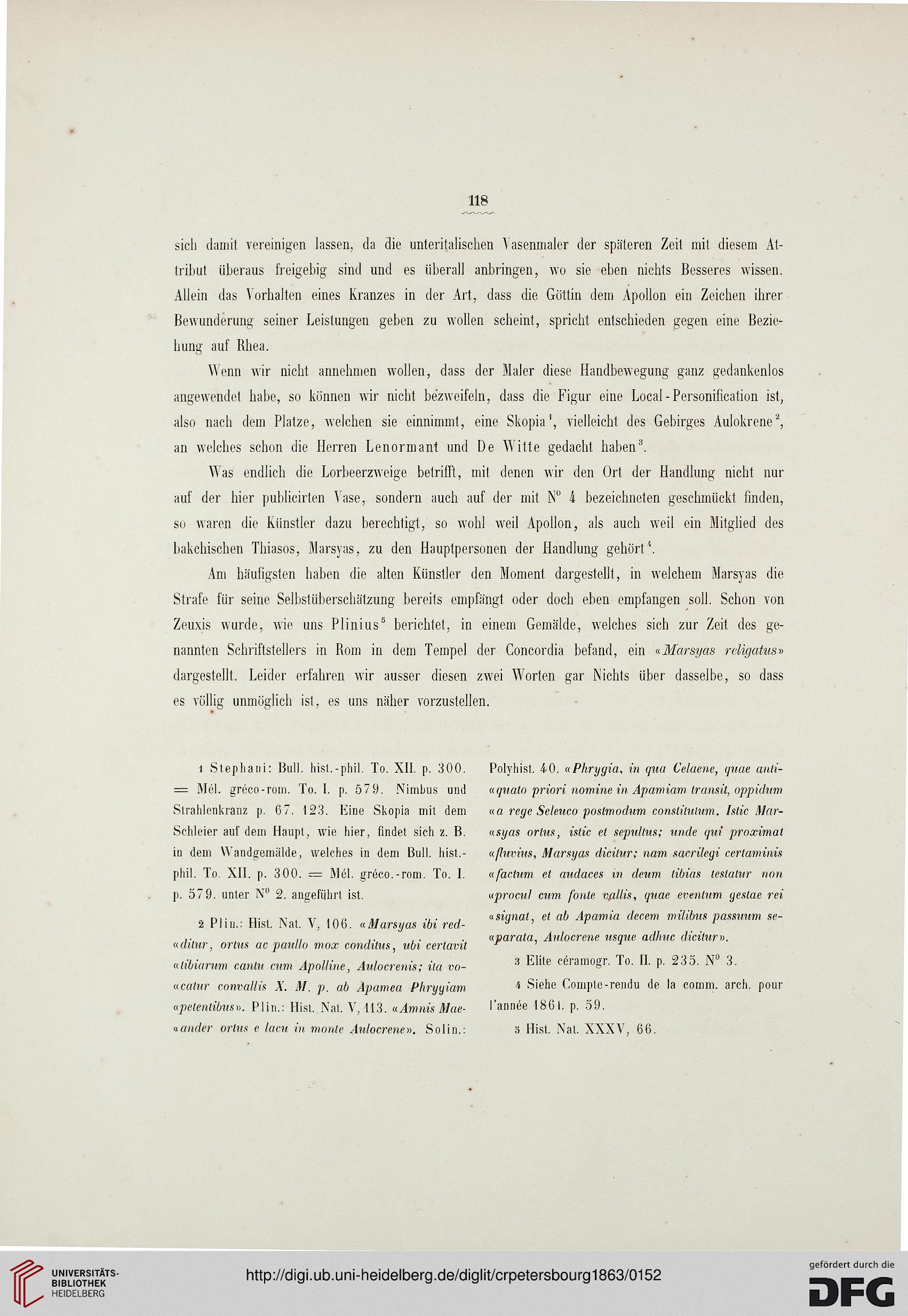118
sicli damit vereinigen lassen, da die unteritalischen Yasenmaler der spà'teren Zeit mit diesem At-
tribut iiberaus freigebig sind und es iiberall anbringen, wo sie eben nichts Besseres wissen.
Allein das \orhalten eines Kranzes in der Art, dass die Gottin dem Apollon ein Zeichen ilirer
Bewunderung seiner Leistungen geben zu wollen scheint, spricht entschieden gegen eine Bezic-
huDg auf Rhea.
Wenn wir oicht annehmen wollen, dass der Maler dièse Handbewegung ganz gedankenlos
angewendet habe, so konnen wir nicbt bézweifeln, dass die Figur eine Local - Personification ist,
also nacb dem Platze, welcben sie einnimmt, eine Skopia vielleicbt des Gebirges Àulokrene2,
an welches schon die Herren Lenorniant und De Witte gedacbt haben3.
Was endlicb die Lorbeerzweige betrifft, mit denen wir den Ort der Handlung nicht nur
auf der hier publicirlen Vase, sondern auch auf der mit N° 4 bezeichneten geschmiickt finden,
so waren die ktinstler dazu berechtigt, so wohl weil Apollon, als auch weil ein Mitgiied des
bakchischen Thiasos, Marsyas, zu den Hauptpcrsonen der Handlung gehort''.
Am haufigsten haben die alten Ktinstler den Moment dargestellt, in welchem Marsyas die
Strafe fur seine Selbstuberschà'tzung bereits empfà'ngt oder doch eben empfangen soll. Schon von
Zeuxis wurde, wie uns Plinius5 berichtet. in einem Gemà'lde, welches sich zur Zeit des ge-
nannten Schriftstellers in Rom in dem Tempe! der Concordia befand, ein «Marsyas religatus»
dargestellt. Leider erfabren wir ausser diesen zwei Worten gar Nichts iiber dasseibe, so dass
es vollig unmoglich ist, es uns nà'her vorzustellen.
1 Slephani: Bull, hist.-phil. To. XII. p. 300.
= Mél. gréco-rom. To. I. p. 579. Nimbus und
Slrahlenkranz p. 6 7. 123. Eine Skopia mit dem
Schleier auf dem Haupt, wie hier, findet sich z. B.
in dem Wandgemà'lde, welches in dem Bull, hist.-
phil. To XII. p. 300. = Mél. gréco.-rom. To. I.
p. 57 9. unter Nu 2. angefiihrl ist.
2 PI in.: Hist. Nat. V, 106. «Marsyas ibi red-
«dilur, ortus ac paullo mox conduits, ubi certavit
«libiarum canlv cum Apolline, Aulocrenis; ila vo-
aeatur convallis X. M. p. ab Apamea Phryyiam
«pelenlibns». PI in.: Hist. Nat. V, 113. «Amnis Mae-
«.ander ortus e lacu in moule Anlocrene». Solin.:
Polyhist. 40. «Phrygia, in qua Celaene, quae anli-
«ipiato priori nomine in Apamiam transit, oppidum
«a rege Seletico postmodum constilulum. Istic Mar-
«.syas ortus, istic et sepullus; unde qui proximat
«fluvius, Marsyas diciltir; nam sacrilegi certaminis
«factum et audaces in deum tibias testatur non
uprocul cum, fonte vjiUis, quae eventum gestae rei
«signal, et ab Apamia decem milibus passuum se-
«parala, Anlocrene usque adhuc dicilur».
3 Elite céramogr. To. II. p. 235. N° 3.
4 Siehe Compte-rendu de la comm. arch. pour
l'année 1861. p. 59.
s Hist. Nat. XXXV,. 66.
sicli damit vereinigen lassen, da die unteritalischen Yasenmaler der spà'teren Zeit mit diesem At-
tribut iiberaus freigebig sind und es iiberall anbringen, wo sie eben nichts Besseres wissen.
Allein das \orhalten eines Kranzes in der Art, dass die Gottin dem Apollon ein Zeichen ilirer
Bewunderung seiner Leistungen geben zu wollen scheint, spricht entschieden gegen eine Bezic-
huDg auf Rhea.
Wenn wir oicht annehmen wollen, dass der Maler dièse Handbewegung ganz gedankenlos
angewendet habe, so konnen wir nicbt bézweifeln, dass die Figur eine Local - Personification ist,
also nacb dem Platze, welcben sie einnimmt, eine Skopia vielleicbt des Gebirges Àulokrene2,
an welches schon die Herren Lenorniant und De Witte gedacbt haben3.
Was endlicb die Lorbeerzweige betrifft, mit denen wir den Ort der Handlung nicht nur
auf der hier publicirlen Vase, sondern auch auf der mit N° 4 bezeichneten geschmiickt finden,
so waren die ktinstler dazu berechtigt, so wohl weil Apollon, als auch weil ein Mitgiied des
bakchischen Thiasos, Marsyas, zu den Hauptpcrsonen der Handlung gehort''.
Am haufigsten haben die alten Ktinstler den Moment dargestellt, in welchem Marsyas die
Strafe fur seine Selbstuberschà'tzung bereits empfà'ngt oder doch eben empfangen soll. Schon von
Zeuxis wurde, wie uns Plinius5 berichtet. in einem Gemà'lde, welches sich zur Zeit des ge-
nannten Schriftstellers in Rom in dem Tempe! der Concordia befand, ein «Marsyas religatus»
dargestellt. Leider erfabren wir ausser diesen zwei Worten gar Nichts iiber dasseibe, so dass
es vollig unmoglich ist, es uns nà'her vorzustellen.
1 Slephani: Bull, hist.-phil. To. XII. p. 300.
= Mél. gréco-rom. To. I. p. 579. Nimbus und
Slrahlenkranz p. 6 7. 123. Eine Skopia mit dem
Schleier auf dem Haupt, wie hier, findet sich z. B.
in dem Wandgemà'lde, welches in dem Bull, hist.-
phil. To XII. p. 300. = Mél. gréco.-rom. To. I.
p. 57 9. unter Nu 2. angefiihrl ist.
2 PI in.: Hist. Nat. V, 106. «Marsyas ibi red-
«dilur, ortus ac paullo mox conduits, ubi certavit
«libiarum canlv cum Apolline, Aulocrenis; ila vo-
aeatur convallis X. M. p. ab Apamea Phryyiam
«pelenlibns». PI in.: Hist. Nat. V, 113. «Amnis Mae-
«.ander ortus e lacu in moule Anlocrene». Solin.:
Polyhist. 40. «Phrygia, in qua Celaene, quae anli-
«ipiato priori nomine in Apamiam transit, oppidum
«a rege Seletico postmodum constilulum. Istic Mar-
«.syas ortus, istic et sepullus; unde qui proximat
«fluvius, Marsyas diciltir; nam sacrilegi certaminis
«factum et audaces in deum tibias testatur non
uprocul cum, fonte vjiUis, quae eventum gestae rei
«signal, et ab Apamia decem milibus passuum se-
«parala, Anlocrene usque adhuc dicilur».
3 Elite céramogr. To. II. p. 235. N° 3.
4 Siehe Compte-rendu de la comm. arch. pour
l'année 1861. p. 59.
s Hist. Nat. XXXV,. 66.