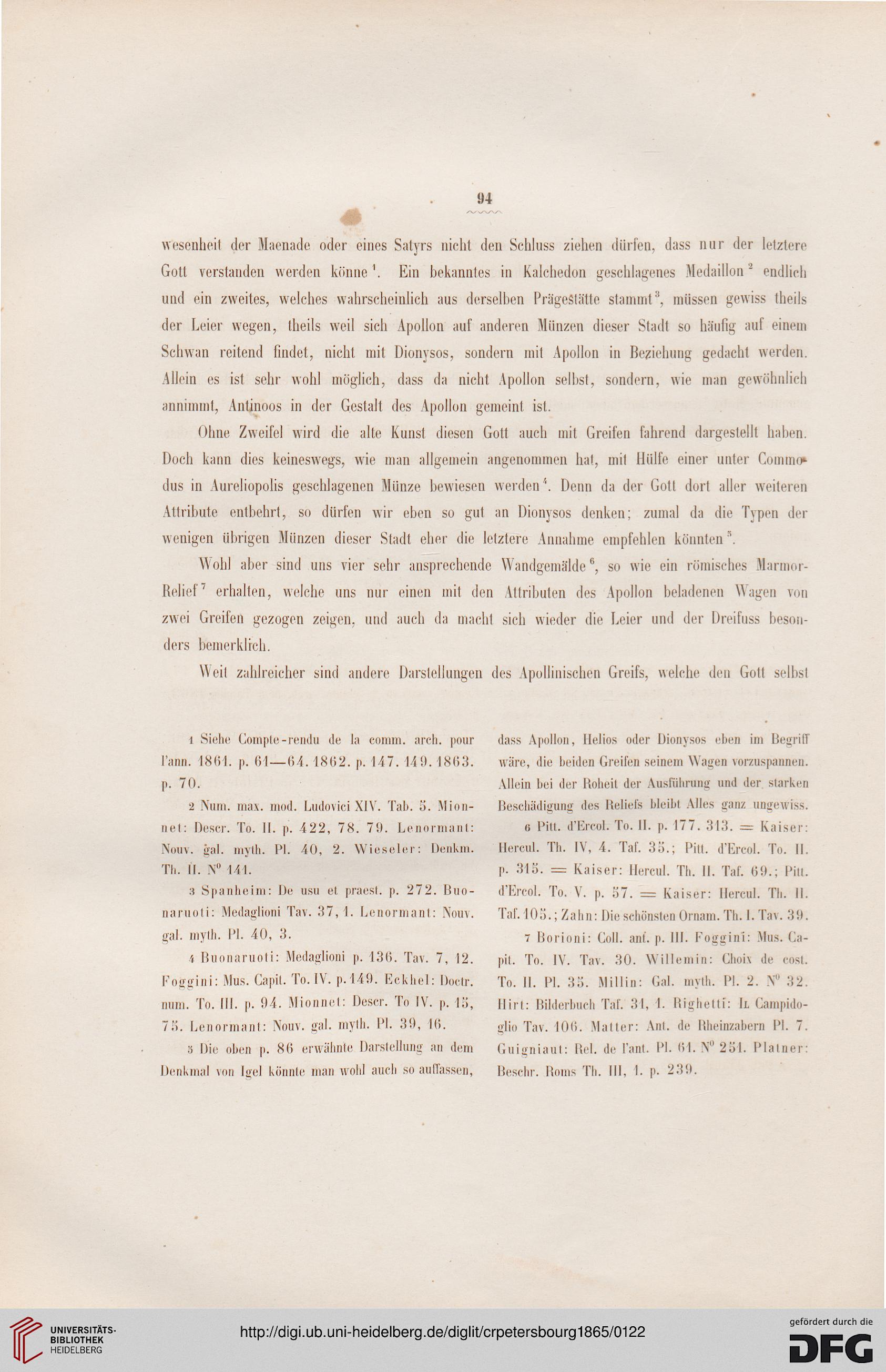»4
Wesenheil der Haenade oder eines Satyrs nicht den Schluss ziehen dürfen, dass nur der letztere
Gott verstanden werden könne1. Ein bekanntes in Kalchedon geschlagenes Medaillon 2 endlich
und ein zweites, welches wahrscheinlich aus derselben Prägestätte stammt*, müssen gewiss theils
der Leier wegen, theils weil sich Apollon auf anderen Münzen dieser Stadl so häufig' auf einem
Schwan reitend findet, nicht mit Dionysos, sondern mit Apollon in Beziehung gedacht werden.
Allein es ist sehr wohl möglich, dass da nicht Apollon seihst, sondern, wie man gewöhnlich
annimmt, Antjnoos in der Gestalt des Apollon gemein! ist.
Ohne Zweifel wird die alte Kunst diesen Gott auch mit Greifen fahrend dargestellt haben.
Doch kann dies keineswegs, wie man allgemein angenommen hat, mit Hülfe einer unter Commo*
dus in Aureliopolis geschlagenen Münze bewiesen werden''. Denn da der (loti dort aller weiteren
Attribute entbehrt, so dürfen wir eben so gut an Dionysos denken; zumal da die Typen der
wenigen übrigen Münzen dieser Stadt eher die letztere Annahme empfehlen könnten "'.
Wohl aber sind uns vier sehr ansprechende Wandgemälde*, so wie ein römisches Marmor-
Relief1 erhalten, welche uns nur einen mit den Attributen des Apollon beladenen Wagen von
zwei Greifen gezogen zeigen, und auch da machl sich wieder die Leier und der Dreiftiss beson-
ders bemerklich.
Weil zahlreicher sind andere Darstellungen des Apollinischen Greifs, welche den Gott selbst
i Siehe Compte-rendu de la eomm. arch. pour
l'ami. 1861 p. 61—64. 1862. p. 147. 149. 1863.
p. To.
•2 [Vilm. max. mod. Ludovici XIV. Tal», .'i. Mion-
net: Descr. To. II. p. 422, 78. 79. Lenormant:
Nouv. gal. myth. PI. 40, 2. Wieseler: Denkm.
Th. II. N" MI.
a Spanheim: De usu et praest. p. 272. Buo-
naruoti: Medaglioni Tav. :S7, I. Lenormant: Nouv.
gal. myth. IM. 40, .'i.
\ Buonaruoti: Medaglioni p. 136. Tav. 7, 12.
Foggini: Mus. Capit. To. IV. p. 149. Eckhel: Doctr.
num. Te. III. p. 94. Mionnet: Descr. To IV. p. I.'i,
7.';. Lenormant: Nouv. gal. myth. IM. 39, IC».
:» Die oben p. 86 erwähnte Darstellung an dem
Denkmal von Igel könnte man wohl auch so auflassen,
dass Apollon, Helios oder Dionysos eben im Begriff
wäre, die beiden Greifen seinem Wagen vorzuspannen.
Allein bei der Hoheit der Ausführung und der starken
Beschädigung des Reliefe bleibt Alles mm/ ungewiss.
<>• Diu. d'Ercol. To. II. p. 177. 313. —- Kaiser:
Bereal. Th. IV, 4. Tal'. Hö.; Diu. d'Ercol. To. II.
p. IJlö. = Kaiser: Hercul. Th. II. Tal. 69.; Diu.
d'Ercol. To. V. p. ö7. = Kaiser: Hercul. Tb. II.
Tal'. l05.;Zahn: Die schönsten Ornam. Th. I.Tav. 39.
7 Borioni: Gell. anf. p. III. Foggini: Mus. Ca-
pit. To. IV. Tav. .'tO. WiHemfn: Choix de eist
To. II. IM. Miliin: Gal. myth. IM. 2. V 32.
Hirt: Bilderbuch Tal. 31, I. Bighetti: Ii. Campido-
glio Tav. 106. .Malier: Am. de Rheinzabern DI. 7.
Guigniaut: D.d. de l'ant. DI. 61. V 251. Platner:
Heseln-. Borns Th. III, 1. p. 239.
Wesenheil der Haenade oder eines Satyrs nicht den Schluss ziehen dürfen, dass nur der letztere
Gott verstanden werden könne1. Ein bekanntes in Kalchedon geschlagenes Medaillon 2 endlich
und ein zweites, welches wahrscheinlich aus derselben Prägestätte stammt*, müssen gewiss theils
der Leier wegen, theils weil sich Apollon auf anderen Münzen dieser Stadl so häufig' auf einem
Schwan reitend findet, nicht mit Dionysos, sondern mit Apollon in Beziehung gedacht werden.
Allein es ist sehr wohl möglich, dass da nicht Apollon seihst, sondern, wie man gewöhnlich
annimmt, Antjnoos in der Gestalt des Apollon gemein! ist.
Ohne Zweifel wird die alte Kunst diesen Gott auch mit Greifen fahrend dargestellt haben.
Doch kann dies keineswegs, wie man allgemein angenommen hat, mit Hülfe einer unter Commo*
dus in Aureliopolis geschlagenen Münze bewiesen werden''. Denn da der (loti dort aller weiteren
Attribute entbehrt, so dürfen wir eben so gut an Dionysos denken; zumal da die Typen der
wenigen übrigen Münzen dieser Stadt eher die letztere Annahme empfehlen könnten "'.
Wohl aber sind uns vier sehr ansprechende Wandgemälde*, so wie ein römisches Marmor-
Relief1 erhalten, welche uns nur einen mit den Attributen des Apollon beladenen Wagen von
zwei Greifen gezogen zeigen, und auch da machl sich wieder die Leier und der Dreiftiss beson-
ders bemerklich.
Weil zahlreicher sind andere Darstellungen des Apollinischen Greifs, welche den Gott selbst
i Siehe Compte-rendu de la eomm. arch. pour
l'ami. 1861 p. 61—64. 1862. p. 147. 149. 1863.
p. To.
•2 [Vilm. max. mod. Ludovici XIV. Tal», .'i. Mion-
net: Descr. To. II. p. 422, 78. 79. Lenormant:
Nouv. gal. myth. PI. 40, 2. Wieseler: Denkm.
Th. II. N" MI.
a Spanheim: De usu et praest. p. 272. Buo-
naruoti: Medaglioni Tav. :S7, I. Lenormant: Nouv.
gal. myth. IM. 40, .'i.
\ Buonaruoti: Medaglioni p. 136. Tav. 7, 12.
Foggini: Mus. Capit. To. IV. p. 149. Eckhel: Doctr.
num. Te. III. p. 94. Mionnet: Descr. To IV. p. I.'i,
7.';. Lenormant: Nouv. gal. myth. IM. 39, IC».
:» Die oben p. 86 erwähnte Darstellung an dem
Denkmal von Igel könnte man wohl auch so auflassen,
dass Apollon, Helios oder Dionysos eben im Begriff
wäre, die beiden Greifen seinem Wagen vorzuspannen.
Allein bei der Hoheit der Ausführung und der starken
Beschädigung des Reliefe bleibt Alles mm/ ungewiss.
<>• Diu. d'Ercol. To. II. p. 177. 313. —- Kaiser:
Bereal. Th. IV, 4. Tal'. Hö.; Diu. d'Ercol. To. II.
p. IJlö. = Kaiser: Hercul. Th. II. Tal. 69.; Diu.
d'Ercol. To. V. p. ö7. = Kaiser: Hercul. Tb. II.
Tal'. l05.;Zahn: Die schönsten Ornam. Th. I.Tav. 39.
7 Borioni: Gell. anf. p. III. Foggini: Mus. Ca-
pit. To. IV. Tav. .'tO. WiHemfn: Choix de eist
To. II. IM. Miliin: Gal. myth. IM. 2. V 32.
Hirt: Bilderbuch Tal. 31, I. Bighetti: Ii. Campido-
glio Tav. 106. .Malier: Am. de Rheinzabern DI. 7.
Guigniaut: D.d. de l'ant. DI. 61. V 251. Platner:
Heseln-. Borns Th. III, 1. p. 239.