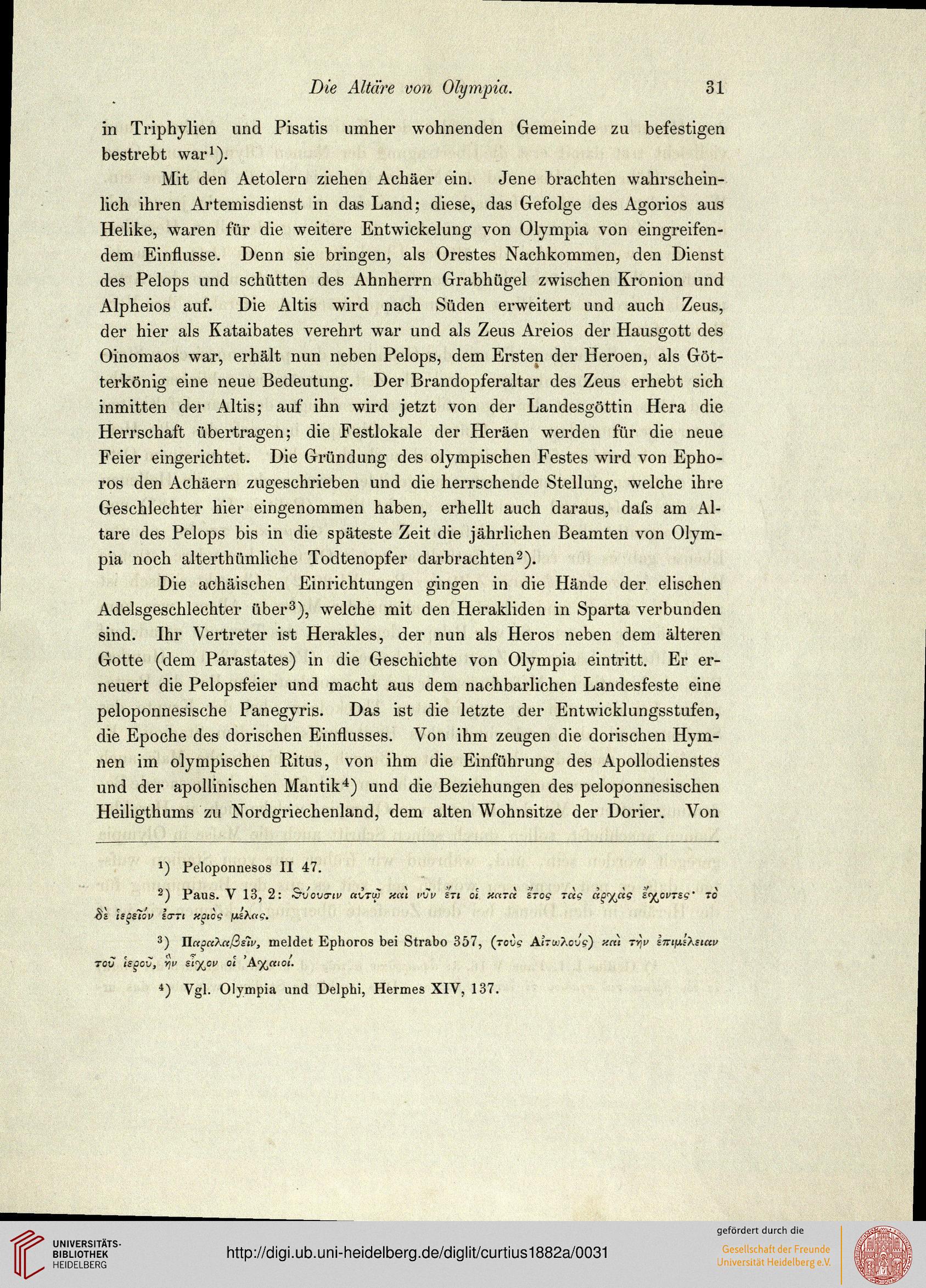Die Altäre von Olympia. 31
in Triphylien und Pisatis umher wohnenden Gemeinde zu befestigen
bestrebt war1).
Mit den Aetolern ziehen Achäer ein. Jene brachten wahrschein-
lich ihren Artemisdienst in das Land; diese, das Gefolge des Agorios aus
Helike, waren für die weitere Entwickelung von Olympia von eingreifen-
dem Einflüsse. Denn sie bringen, als Orestes Nachkommen, den Dienst
des Pelops und schütten des Ahnherrn Grabhügel zwischen Kronion und
Alpheios auf. Die Altis wird nach Süden erweitert und auch Zeus,
der hier als Kataibates verehrt war und als Zeus Areios der Hausgott des
Oinomaos war, erhält nun neben Pelops, dem Ersten der Heroen, als Göt-
terkönig eine neue Bedeutung. Der Brandopferaltar des Zeus erhebt sich
inmitten der Altis; auf ihn wird jetzt von der Landesgöttin Hera die
Herrschaft übertragen; die Festlokale der Heräen werden für die neue
Feier eingerichtet. Die Gründung des olympischen Festes wird von Epho-
ros den Achäern zugeschrieben und die herrschende Stellung, welche ihre
Geschlechter hier eingenommen haben, erhellt auch daraus, dafs am Al-
tare des Pelops bis in die späteste Zeit die jährlichen Beamten von Olym-
pia noch alterthümliche Todtenopfer darbrachten2).
Die achäischen Einrichtungen gingen in die Hände der elischen
Adelsgeschlechter über3), welche mit den Herakliden in Sparta verbunden
sind. Ihr Vertreter ist Herakles, der nun als Heros neben dem älteren
Gotte (dem Parastates) in die Geschichte von Olympia eintritt. Er er-
neuert die Pelopsfeier und macht aus dem nachbarlichen Landesfeste eine
peloponnesische Panegyris. Das ist die letzte der Entwicklungsstufen,
die Epoche des dorischen Einflusses. Von ihm zeugen die dorischen Hym-
nen im olympischen Ritus, von ihm die Einführung des Apollodienstes
und der apollinischen Mantik4) und die Beziehungen des peloponnesischen
Heiligthums zu Nordgriechenland, dem alten Wohnsitze der Dorier. Von
*) Peloponnesos II 47.
2) Paus. V 13, 2: 3>vov<riv «vtuj xai vdv sti o< y.a-ce srog rag «£%«? s%ovreg' ro
•§£ ligetov itTTt xgtog fxs'Kag.
3) n«^«A«/Ssic, meldet Ephoros bei Strabo 357, (rovg Ahwkovs) xcii «jp InifXiXuav
tcu isgov, r\v siyjiv ot A%aioi.
4) Vgl. Olympia und Delphi, Hermes XIV, 137.
in Triphylien und Pisatis umher wohnenden Gemeinde zu befestigen
bestrebt war1).
Mit den Aetolern ziehen Achäer ein. Jene brachten wahrschein-
lich ihren Artemisdienst in das Land; diese, das Gefolge des Agorios aus
Helike, waren für die weitere Entwickelung von Olympia von eingreifen-
dem Einflüsse. Denn sie bringen, als Orestes Nachkommen, den Dienst
des Pelops und schütten des Ahnherrn Grabhügel zwischen Kronion und
Alpheios auf. Die Altis wird nach Süden erweitert und auch Zeus,
der hier als Kataibates verehrt war und als Zeus Areios der Hausgott des
Oinomaos war, erhält nun neben Pelops, dem Ersten der Heroen, als Göt-
terkönig eine neue Bedeutung. Der Brandopferaltar des Zeus erhebt sich
inmitten der Altis; auf ihn wird jetzt von der Landesgöttin Hera die
Herrschaft übertragen; die Festlokale der Heräen werden für die neue
Feier eingerichtet. Die Gründung des olympischen Festes wird von Epho-
ros den Achäern zugeschrieben und die herrschende Stellung, welche ihre
Geschlechter hier eingenommen haben, erhellt auch daraus, dafs am Al-
tare des Pelops bis in die späteste Zeit die jährlichen Beamten von Olym-
pia noch alterthümliche Todtenopfer darbrachten2).
Die achäischen Einrichtungen gingen in die Hände der elischen
Adelsgeschlechter über3), welche mit den Herakliden in Sparta verbunden
sind. Ihr Vertreter ist Herakles, der nun als Heros neben dem älteren
Gotte (dem Parastates) in die Geschichte von Olympia eintritt. Er er-
neuert die Pelopsfeier und macht aus dem nachbarlichen Landesfeste eine
peloponnesische Panegyris. Das ist die letzte der Entwicklungsstufen,
die Epoche des dorischen Einflusses. Von ihm zeugen die dorischen Hym-
nen im olympischen Ritus, von ihm die Einführung des Apollodienstes
und der apollinischen Mantik4) und die Beziehungen des peloponnesischen
Heiligthums zu Nordgriechenland, dem alten Wohnsitze der Dorier. Von
*) Peloponnesos II 47.
2) Paus. V 13, 2: 3>vov<riv «vtuj xai vdv sti o< y.a-ce srog rag «£%«? s%ovreg' ro
•§£ ligetov itTTt xgtog fxs'Kag.
3) n«^«A«/Ssic, meldet Ephoros bei Strabo 357, (rovg Ahwkovs) xcii «jp InifXiXuav
tcu isgov, r\v siyjiv ot A%aioi.
4) Vgl. Olympia und Delphi, Hermes XIV, 137.