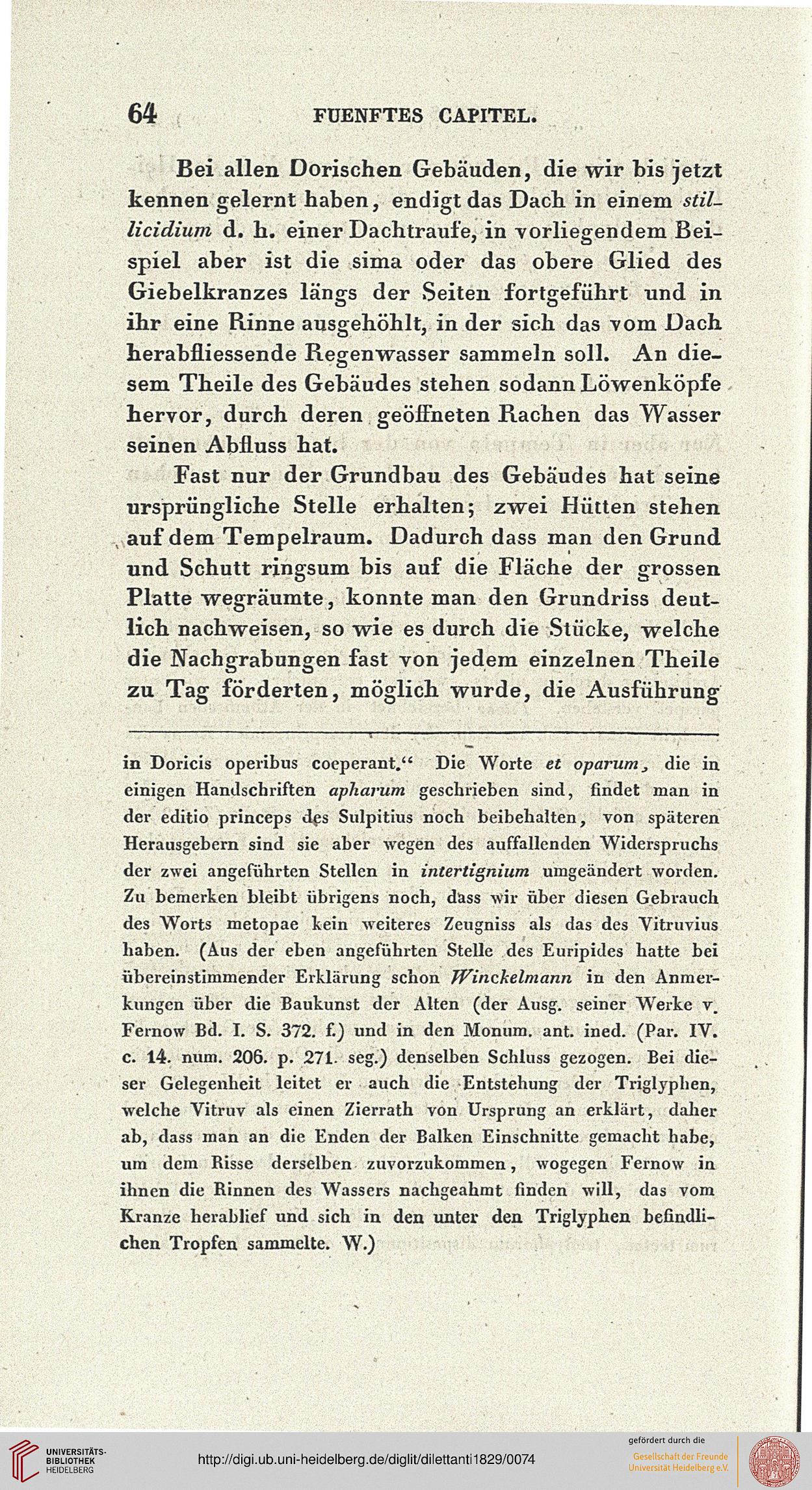64 FÜENFTES CAPITEL.
Bei allen Dorischen Gebäuden, die wir bis jetzt
kennen gelernt haben, endigt das Dach in einem stil-
licidium d. h. einer Dachtraufe, in -vorliegendem Bei-
spiel aber ist die sima oder das obere Glied des
Giebelkranzes längs der Seiten fortgeführt und in
ihr eine Rinne ausgehöhlt, in der sich das vom Dach
herabfliessende Regenwasser sammeln soll. An die-
sem Theile des Gebäudes stehen sodann Löwenköpfe
hervor, durch deren geöffneten Rachen das Wasser
seinen Abfluss hat.
Fast nur der Grundbau des Gebäudes hat seine
ursprüngliche Stelle erhalten; zwei Hütten stehen
; auf dem Tempelraum. Dadurch dass man den Grund
und Schutt ringsum bis auf die Fläche der grossen
Platte wegräumte, konnte man den Grundriss deut-
lich nachweisen, so wie es durch die Stücke, welche
die Nachgrabungen fast von jedem einzelnen Theile
zu Tag förderten, möglich wurde, die Ausführung
in Doricis operibus coeperant." Die Worte et oparum, die in
einigen Handschriften apharum geschrieben sind, findet man in
der editio princeps des Sulpitius noch beibehalten, von späteren
Herausgebern sind sie aber wegen des auffallenden Widerspruchs
der zwei angeführten Stellen in inlertignium umgeändert worden.
Zu bemerken bleibt übrigens noch, dass wir über diesen Gebrauch
des "Worts metopae kein weiteres Zeugniss als das des Vitruvius
haben. (Aus der eben angeführten Stelle des Euripides hatte bei
übereinstimmender Erklärung schon JVirickelmann in den Anmer-
kungen über die Baukunst der Alten (der Ausg. seiner Werke v.
Fernow Bd. I. S. 372. f.) und in den Monum. ant. ined. (Par. IV.
c. 14. num. 206. p. 271. seg.) denselben Schluss gezogen. Bei die-
ser Gelegenheit leitet er auch die Entstehung der Triglyphen,
welche Vitruv als einen Zierrath von Ursprung an erklärt, dalier
ab, dass man an die Enden der Balken Einschnitte gemacht habe,
um dem Risse derselben zuvorzukommen, wogegen Fernow in
ihnen die Rinnen des Wassers nachgeahmt finden will, das vom
Kranze herablief und sich in den unter den Triglyphen befindli-
chen Tropfen sammelte. W.)
Bei allen Dorischen Gebäuden, die wir bis jetzt
kennen gelernt haben, endigt das Dach in einem stil-
licidium d. h. einer Dachtraufe, in -vorliegendem Bei-
spiel aber ist die sima oder das obere Glied des
Giebelkranzes längs der Seiten fortgeführt und in
ihr eine Rinne ausgehöhlt, in der sich das vom Dach
herabfliessende Regenwasser sammeln soll. An die-
sem Theile des Gebäudes stehen sodann Löwenköpfe
hervor, durch deren geöffneten Rachen das Wasser
seinen Abfluss hat.
Fast nur der Grundbau des Gebäudes hat seine
ursprüngliche Stelle erhalten; zwei Hütten stehen
; auf dem Tempelraum. Dadurch dass man den Grund
und Schutt ringsum bis auf die Fläche der grossen
Platte wegräumte, konnte man den Grundriss deut-
lich nachweisen, so wie es durch die Stücke, welche
die Nachgrabungen fast von jedem einzelnen Theile
zu Tag förderten, möglich wurde, die Ausführung
in Doricis operibus coeperant." Die Worte et oparum, die in
einigen Handschriften apharum geschrieben sind, findet man in
der editio princeps des Sulpitius noch beibehalten, von späteren
Herausgebern sind sie aber wegen des auffallenden Widerspruchs
der zwei angeführten Stellen in inlertignium umgeändert worden.
Zu bemerken bleibt übrigens noch, dass wir über diesen Gebrauch
des "Worts metopae kein weiteres Zeugniss als das des Vitruvius
haben. (Aus der eben angeführten Stelle des Euripides hatte bei
übereinstimmender Erklärung schon JVirickelmann in den Anmer-
kungen über die Baukunst der Alten (der Ausg. seiner Werke v.
Fernow Bd. I. S. 372. f.) und in den Monum. ant. ined. (Par. IV.
c. 14. num. 206. p. 271. seg.) denselben Schluss gezogen. Bei die-
ser Gelegenheit leitet er auch die Entstehung der Triglyphen,
welche Vitruv als einen Zierrath von Ursprung an erklärt, dalier
ab, dass man an die Enden der Balken Einschnitte gemacht habe,
um dem Risse derselben zuvorzukommen, wogegen Fernow in
ihnen die Rinnen des Wassers nachgeahmt finden will, das vom
Kranze herablief und sich in den unter den Triglyphen befindli-
chen Tropfen sammelte. W.)