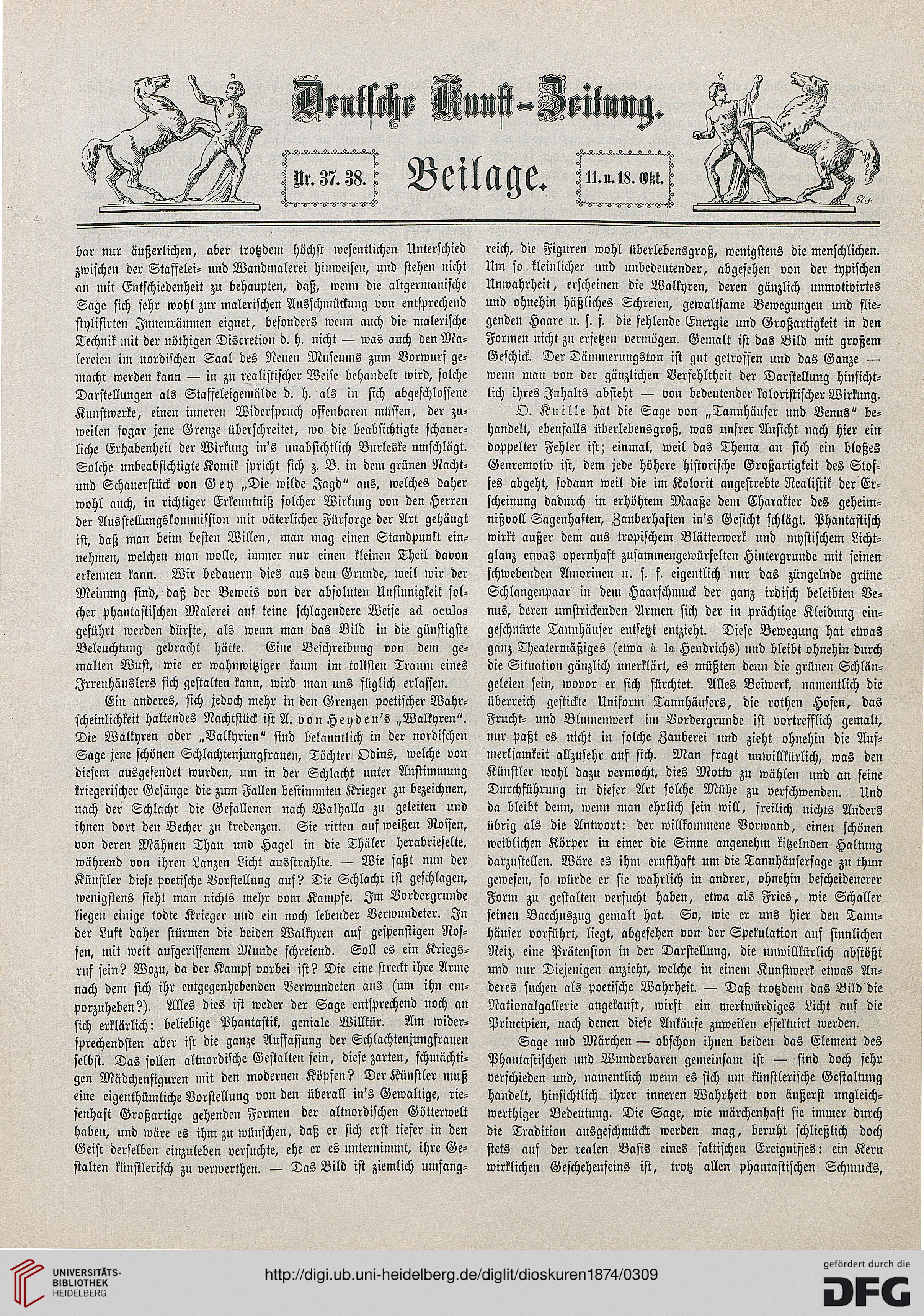bar nur äußerlichen, aber trotzdem höchst wesentlichen Unterschied
zwischen der Staffelei- und Wandmalerei Hinweisen, und stehen nicht
an mit Entschiedenheit zu behaupten, daß, wenn die altgermanische
Sage sich sehr wohl zur malerischen Ausschmückung von entsprechend
stylisirten Jnnenräumen eignet, besonders wenn auch die malerische
Technik mit der nöthige» Discretion d. h. nicht •— was auch den Ma-
lereien im nordischen Saal des Neuen Museums zum Vorwurf ge-
macht werden kann — in zu realistischer Weise behandelt wird, solche
Darstellungen als Staffeleigemälde d. h. als in sich abgeschlossene
Kunstwerke, einen inneren Widerspruch offenbaren müssen, der zu-
weilen sogar jene Grenze überschreitet, wo die beabsichtigte schauer-
liche Erhabenheit der Wirkung in's unabsichtlich Burleske umschlägt.
Solche unbeabsichtigte Komik spricht sich z. B. in dem grünen Nacht-
und Schauerstück von Gey „Die wilde Jagd" aus, welches daher
wohl auch, in richtiger Erkenntniß solcher Wirkung von den Herren
der Ausstellungskommission mit väterlicher Fürsorge der Art gehängt
ist, daß man beim besten Willen, man mag einen Standpunkt ein-
nehmen, welchen man wolle, immer nur einen kleinen Theil davon
erkennen kann. Wir bedauern dies aus dem Grunde, weil wir der
Meinung sind, daß der Beweis von der absoluten Unsinnigkeit sol-
cher phantastischen Malerei auf keine schlagendere Weise ad oculos
geführt werden dürfte, als wenn man das Bild in die günstigste
Beleuchtung gebracht hätte. Eine Beschreibung von dem ge-
malten Wust, wie er wahnwitziger kaum im tollsten Traum eines
Irrenhäuslers sich gestalten kann, wird man uns füglich erlassen.
Ein anderes, sich jedoch mehr in den Grenzen poetischer Wahr-
scheinlichkeit haltendes Nachtstück ist A. von Heyden's „Walkyren".
Die Walkyren oder „Balkyrien" sind bekanntlich in der nordischen
Sage jene schönen Schlachtenjungfrauen, Töchter Odins, welche von
diesem ausgesendet wurden, um in der Schlacht unter Anstimmung
kriegerischer Gesänge die zum Fallen bestimmten Krieger zu bezeichnen,
nach der Schlacht die Gefallenen nach Walhalla zu geleiten und
ihnen dort den Becher zu kredenzen. Sie ritten auf weißen Rossen,
von deren Mähnen Thau und Hagel in die Thäler herabrieselte,
während von ihren Lanzen Licht ausstrahlte. — Wie faßt nun der
Künstler diese poetische Vorstellung auf? Die Schlacht ist geschlagen,
wenigstens sieht man nichts mehr vom Kampfe. Im Vordergründe
liegen einige todte Krieger und ein noch lebender Verwundeter. In
der Luft daher stürmen die beiden Walkyren auf gespenstigen Ros-
sen, mit weit aufgerissenem Munde schreiend. Soll es ein Kriegs-
ruf sein? Wozu, da der Kampf vorbei ist? Die eine streckt ihre Arme
nach denl sich ihr entgegenhebenden Verwundeten aus (um ihn em-
porzuheben?). Alles dies ist weder der Sage entsprechend noch an
sich erklärlich: beliebige Phantastik, geniale Willkür. Am wider-
sprechendsten aber ist die ganze Auffassung der Schlachtenjungfrauen
selbst. Das sollen altnordische Gestalten sein, diese zarten, schmächti-
gen Mädchensiguren mit den modernen Köpfen? Der Künstler muß
eine eigenthümliche Vorstellung von den überall in's Gewaltige, rie-
senhaft Großartige gehenden Formen der altnordischen Götterwelt
haben, und wäre es ihm zu wünschen, daß er sich erst tiefer in den
Geist derselben einzuleben versuchte, ehe er es unternimmt, ihre Ge-
stalten künstlerisch zu verwerthen. — Das Bild ist ziemlich umfang-
reich, die Figuren wohl überlebensgroß, wenigstens die menschlichen.
Um so kleinlicher und unbedeutender, abgesehen von der typischen
Unwahrheit, erscheinen die Walkyren, deren gänzlich unmotivirtes
und ohnehin häßliches Schreien, gewaltsame Bewegungen und flie-
genden Haare u. s. f. die fehlende Energie und Großartigkeit in den
Formen nicht zu ersetzen vermögen. Gemalt ist das Bild mit großem
Geschick. Der Dämmerungston ist gut getroffen und das Ganze —
wenn man von der gänzlichen Verfehltheit der Darstellung hinsicht-
lich ihres Inhalts absieht — von bedeutender koloristischer Wirkung.
O. Knille hat die Sage von „Tannhäuser und Venus" be-
handelt, ebenfalls überlebensgroß, was unsrer Ansicht nach hier ein
doppelter Fehler ist; einmal, weil das Thema an sich ein bloßes
Genremotiv ist, dem jede höhere historische Großartigkeit des Stof-
fes abgeht, sodann weil die im Kolorit angestrebte Realistik der Er-
scheinung dadurch in erhöhtem Maaße dem Charakter des geheim-
nißvoll Sagenhaften, Zauberhaften in's Gesicht schlägt. Phantastisch
wirkt außer dem aus tropischem Blätterwerk und mystischem Licht-
glanz etwas opernhaft zusammengewürfelten Hintergründe mit seinen
schwebenden Amorinen u. s. f. eigentlich nur das züngelnde grüne
Schlangenpaar in dem Haarschmuck der ganz irdisch beleibten Ve-
nus, deren umstrickenden Armen sich der in prächtige Kleidung ein-
geschnürte Tannhäuser entsetzt entzieht. Diese Bewegung hat etwas
ganz Theatermäßiges (etwa k la Hendrichs) und bleibt ohnehin durch
die Situation gänzlich unerklärt, es müßten denn die grünen Schlän-
geleien sein, wovor er sich fürchtet. Alles Beiwerk, namentlich die
überreich gestickte Uniform Tannhäusers, die rothen Hosen, das
Frucht- und Blumenwerk im Vordergründe ist vortrefflich gemalt,
nur paßt es nicht in solche Zauberei und zieht ohnehin die Auf-
merksamkeit allzusehr auf sich. Man fragt unwillkürlich, was den
Künstler wohl dazu vermocht, dies Motto zu wählen und an seine
Durchführung in dieser Art solche Mühe zu verschwenden. Und
da bleibt denn, wenn man ehrlich sein will, freilich nichts Anders
übrig als die Antwort: der willkommene Vorwand, einen schönen
weiblichen Körper in einer die Sinne angenehm kitzelnden Haltung
darzustellen. Wäre es ihm ernsthaft um die Tannhäusersage zu thun
gewesen, so würde er sie wahrlich in andrer, ohnehin bescheidenerer
Form zu gestalten versucht haben, etwa als Fries, wie Schalter
seinen Bacchuszug gemalt hat. So, wie er uns hier den Tann-
häuser vorführt, liegt, abgesehen von der Spekulation auf sinnlichen
Reiz, eine Prätension in der Darstellung, die unwillkürlich abstößt
und nur Diejenigen anzieht, welche in einem Kunstwerk etwas An-
deres suchen als poetische Wahrheit. — Daß trotzdem das Bild die
Nationalgallerie angekauft, wirft ein merkwürdiges Licht auf die
Principien, nach denen diese Ankäufe zuweilen effektuirt werden.
Sage und Märchen — obschon ihnen beiden das Element des
Phantastischen und Wunderbaren gemeinsam ist — sind doch sehr
verschieden und, namentlich wenn es sich um künstlerische Gestaltung
handelt, hinsichtlich ihrer inneren Wahrheit von äußerst ungleich-
werthiger Bedeutung. Die Sage, wie märchenhaft sie immer durch
die Tradition ausgeschmückt werden mag, beruht schließlich doch
stets auf der realen Basis eines faktischen Ereignisses: ein Kern
wirklichen Geschehenseins ist, trotz allen phantastischen Schmucks,
zwischen der Staffelei- und Wandmalerei Hinweisen, und stehen nicht
an mit Entschiedenheit zu behaupten, daß, wenn die altgermanische
Sage sich sehr wohl zur malerischen Ausschmückung von entsprechend
stylisirten Jnnenräumen eignet, besonders wenn auch die malerische
Technik mit der nöthige» Discretion d. h. nicht •— was auch den Ma-
lereien im nordischen Saal des Neuen Museums zum Vorwurf ge-
macht werden kann — in zu realistischer Weise behandelt wird, solche
Darstellungen als Staffeleigemälde d. h. als in sich abgeschlossene
Kunstwerke, einen inneren Widerspruch offenbaren müssen, der zu-
weilen sogar jene Grenze überschreitet, wo die beabsichtigte schauer-
liche Erhabenheit der Wirkung in's unabsichtlich Burleske umschlägt.
Solche unbeabsichtigte Komik spricht sich z. B. in dem grünen Nacht-
und Schauerstück von Gey „Die wilde Jagd" aus, welches daher
wohl auch, in richtiger Erkenntniß solcher Wirkung von den Herren
der Ausstellungskommission mit väterlicher Fürsorge der Art gehängt
ist, daß man beim besten Willen, man mag einen Standpunkt ein-
nehmen, welchen man wolle, immer nur einen kleinen Theil davon
erkennen kann. Wir bedauern dies aus dem Grunde, weil wir der
Meinung sind, daß der Beweis von der absoluten Unsinnigkeit sol-
cher phantastischen Malerei auf keine schlagendere Weise ad oculos
geführt werden dürfte, als wenn man das Bild in die günstigste
Beleuchtung gebracht hätte. Eine Beschreibung von dem ge-
malten Wust, wie er wahnwitziger kaum im tollsten Traum eines
Irrenhäuslers sich gestalten kann, wird man uns füglich erlassen.
Ein anderes, sich jedoch mehr in den Grenzen poetischer Wahr-
scheinlichkeit haltendes Nachtstück ist A. von Heyden's „Walkyren".
Die Walkyren oder „Balkyrien" sind bekanntlich in der nordischen
Sage jene schönen Schlachtenjungfrauen, Töchter Odins, welche von
diesem ausgesendet wurden, um in der Schlacht unter Anstimmung
kriegerischer Gesänge die zum Fallen bestimmten Krieger zu bezeichnen,
nach der Schlacht die Gefallenen nach Walhalla zu geleiten und
ihnen dort den Becher zu kredenzen. Sie ritten auf weißen Rossen,
von deren Mähnen Thau und Hagel in die Thäler herabrieselte,
während von ihren Lanzen Licht ausstrahlte. — Wie faßt nun der
Künstler diese poetische Vorstellung auf? Die Schlacht ist geschlagen,
wenigstens sieht man nichts mehr vom Kampfe. Im Vordergründe
liegen einige todte Krieger und ein noch lebender Verwundeter. In
der Luft daher stürmen die beiden Walkyren auf gespenstigen Ros-
sen, mit weit aufgerissenem Munde schreiend. Soll es ein Kriegs-
ruf sein? Wozu, da der Kampf vorbei ist? Die eine streckt ihre Arme
nach denl sich ihr entgegenhebenden Verwundeten aus (um ihn em-
porzuheben?). Alles dies ist weder der Sage entsprechend noch an
sich erklärlich: beliebige Phantastik, geniale Willkür. Am wider-
sprechendsten aber ist die ganze Auffassung der Schlachtenjungfrauen
selbst. Das sollen altnordische Gestalten sein, diese zarten, schmächti-
gen Mädchensiguren mit den modernen Köpfen? Der Künstler muß
eine eigenthümliche Vorstellung von den überall in's Gewaltige, rie-
senhaft Großartige gehenden Formen der altnordischen Götterwelt
haben, und wäre es ihm zu wünschen, daß er sich erst tiefer in den
Geist derselben einzuleben versuchte, ehe er es unternimmt, ihre Ge-
stalten künstlerisch zu verwerthen. — Das Bild ist ziemlich umfang-
reich, die Figuren wohl überlebensgroß, wenigstens die menschlichen.
Um so kleinlicher und unbedeutender, abgesehen von der typischen
Unwahrheit, erscheinen die Walkyren, deren gänzlich unmotivirtes
und ohnehin häßliches Schreien, gewaltsame Bewegungen und flie-
genden Haare u. s. f. die fehlende Energie und Großartigkeit in den
Formen nicht zu ersetzen vermögen. Gemalt ist das Bild mit großem
Geschick. Der Dämmerungston ist gut getroffen und das Ganze —
wenn man von der gänzlichen Verfehltheit der Darstellung hinsicht-
lich ihres Inhalts absieht — von bedeutender koloristischer Wirkung.
O. Knille hat die Sage von „Tannhäuser und Venus" be-
handelt, ebenfalls überlebensgroß, was unsrer Ansicht nach hier ein
doppelter Fehler ist; einmal, weil das Thema an sich ein bloßes
Genremotiv ist, dem jede höhere historische Großartigkeit des Stof-
fes abgeht, sodann weil die im Kolorit angestrebte Realistik der Er-
scheinung dadurch in erhöhtem Maaße dem Charakter des geheim-
nißvoll Sagenhaften, Zauberhaften in's Gesicht schlägt. Phantastisch
wirkt außer dem aus tropischem Blätterwerk und mystischem Licht-
glanz etwas opernhaft zusammengewürfelten Hintergründe mit seinen
schwebenden Amorinen u. s. f. eigentlich nur das züngelnde grüne
Schlangenpaar in dem Haarschmuck der ganz irdisch beleibten Ve-
nus, deren umstrickenden Armen sich der in prächtige Kleidung ein-
geschnürte Tannhäuser entsetzt entzieht. Diese Bewegung hat etwas
ganz Theatermäßiges (etwa k la Hendrichs) und bleibt ohnehin durch
die Situation gänzlich unerklärt, es müßten denn die grünen Schlän-
geleien sein, wovor er sich fürchtet. Alles Beiwerk, namentlich die
überreich gestickte Uniform Tannhäusers, die rothen Hosen, das
Frucht- und Blumenwerk im Vordergründe ist vortrefflich gemalt,
nur paßt es nicht in solche Zauberei und zieht ohnehin die Auf-
merksamkeit allzusehr auf sich. Man fragt unwillkürlich, was den
Künstler wohl dazu vermocht, dies Motto zu wählen und an seine
Durchführung in dieser Art solche Mühe zu verschwenden. Und
da bleibt denn, wenn man ehrlich sein will, freilich nichts Anders
übrig als die Antwort: der willkommene Vorwand, einen schönen
weiblichen Körper in einer die Sinne angenehm kitzelnden Haltung
darzustellen. Wäre es ihm ernsthaft um die Tannhäusersage zu thun
gewesen, so würde er sie wahrlich in andrer, ohnehin bescheidenerer
Form zu gestalten versucht haben, etwa als Fries, wie Schalter
seinen Bacchuszug gemalt hat. So, wie er uns hier den Tann-
häuser vorführt, liegt, abgesehen von der Spekulation auf sinnlichen
Reiz, eine Prätension in der Darstellung, die unwillkürlich abstößt
und nur Diejenigen anzieht, welche in einem Kunstwerk etwas An-
deres suchen als poetische Wahrheit. — Daß trotzdem das Bild die
Nationalgallerie angekauft, wirft ein merkwürdiges Licht auf die
Principien, nach denen diese Ankäufe zuweilen effektuirt werden.
Sage und Märchen — obschon ihnen beiden das Element des
Phantastischen und Wunderbaren gemeinsam ist — sind doch sehr
verschieden und, namentlich wenn es sich um künstlerische Gestaltung
handelt, hinsichtlich ihrer inneren Wahrheit von äußerst ungleich-
werthiger Bedeutung. Die Sage, wie märchenhaft sie immer durch
die Tradition ausgeschmückt werden mag, beruht schließlich doch
stets auf der realen Basis eines faktischen Ereignisses: ein Kern
wirklichen Geschehenseins ist, trotz allen phantastischen Schmucks,