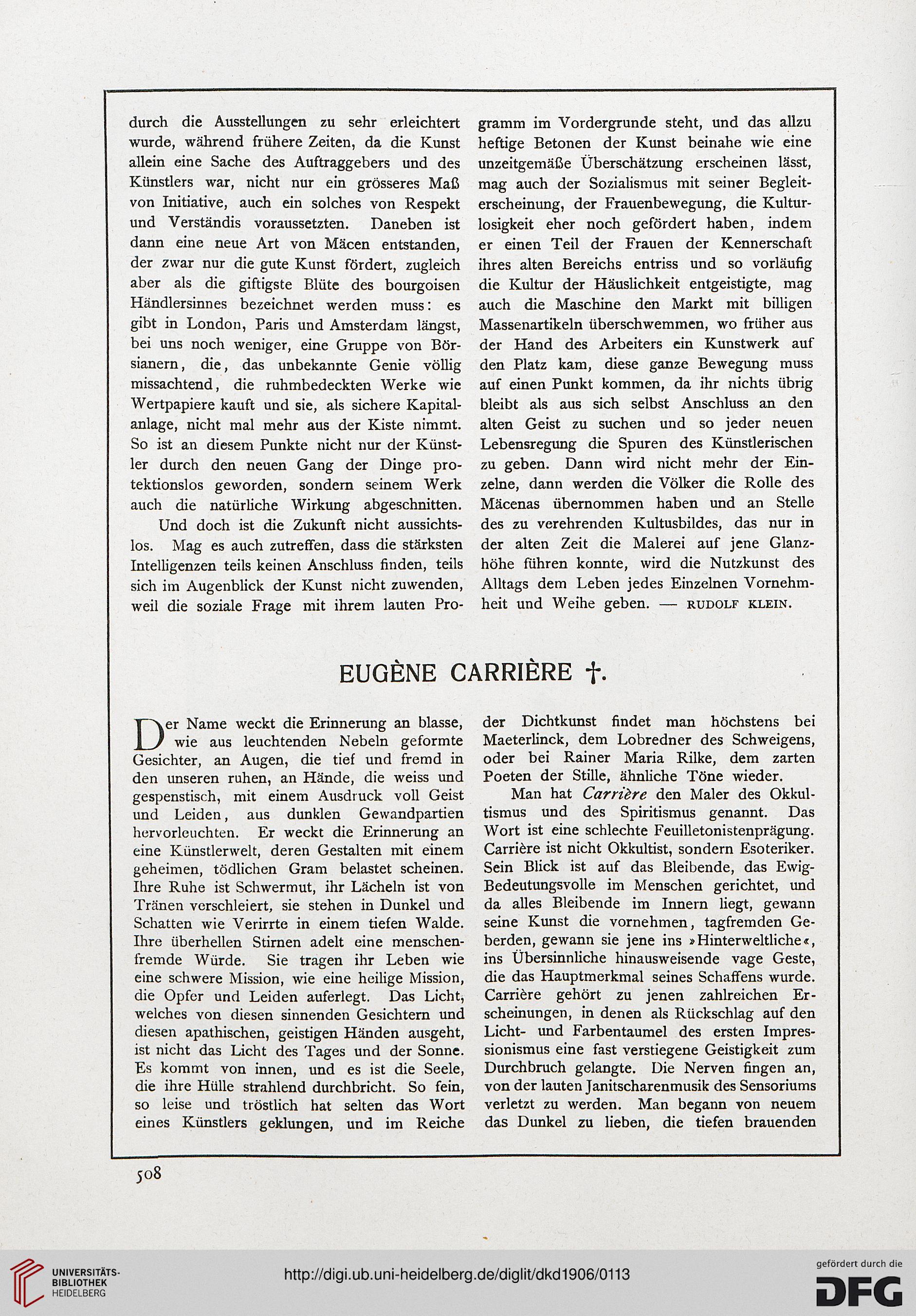durch die Ausstellungen zu sehr erleichtert
wurde, während frühere Zeiten, da die Kunst
allein eine Sache des Auftraggebers und des
Künstlers war, nicht nur ein grösseres Maß
von Initiative, auch ein solches von Respekt
und Verständis voraussetzten. Daneben ist
dann eine neue Art von Mäcen entstanden,
der zwar nur die gute Kunst fördert, zugleich
aber als die giftigste Blüte des bourgoisen
Händlersinnes bezeichnet werden muss: es
gibt in London, Paris und Amsterdam längst,
bei uns noch weniger, eine Gruppe von Bör-
sianern, die, das unbekannte Genie völlig
missachtend, die ruhmbedeckten Werke wie
Wertpapiere kauft und sie, als sichere Kapital-
anlage, nicht mal mehr aus der Kiste nimmt.
So ist an diesem Punkte nicht nur der Künst-
ler durch den neuen Gang der Dinge pro-
tektionslos geworden, sondern seinem Werk
auch die natürliche Wirkung abgeschnitten.
Und doch ist die Zukunft nicht aussichts-
los. Mag es auch zutreffen, dass die stärksten
Intelligenzen teils keinen Anschluss finden, teils
sich im Augenblick der Kunst nicht zuwenden,
weil die soziale Frage mit ihrem lauten Pro-
gramm im Vordergrunde steht, und das allzu
heftige Betonen der Kunst beinahe wie eine
unzeitgemäße Überschätzung erscheinen lässt,
mag auch der Sozialismus mit seiner Begleit-
erscheinung, der Frauenbewegung, die Kultur-
losigkeit eher noch gefördert haben, indem
er einen Teil der Frauen der Kennerschaft
ihres alten Bereichs entriss und so vorläufig
die Kultur der Häuslichkeit entgeistigte, mag
auch die Maschine den Markt mit billigen
Massenartikeln überschwemmen, wo früher aus
der Hand des Arbeiters ein Kunstwerk auf
den Platz kam, diese ganze Bewegung muss
auf einen Punkt kommen, da ihr nichts übrig
bleibt als aus sich selbst Anschluss an den
alten Geist zu suchen und so jeder neuen
Lebensregung die Spuren des Künstlerischen
zu geben. Dann wird nicht mehr der Ein-
zelne, dann werden die Völker die Rolle des
Mäcenas übernommen haben und an Stelle
des zu verehrenden Kultusbildes, das nur in
der alten Zeit die Malerei auf jene Glanz-
höhe führen konnte, wird die Nutzkunst des
Alltags dem Leben jedes Einzelnen Vornehm-
heit und Weihe geben. — rudolf klein.
EUGENE CARRIERE f.
Der Name weckt die Erinnerung an blasse,
wie aus leuchtenden Nebeln geformte
Gesichter, an Augen, die tief und fremd in
den unseren ruhen, an Hände, die weiss und
gespenstisch, mit einem Ausdruck voll Geist
und Leiden, aus dunklen Gewandpartien
hervorleuchten. Er weckt die Erinnerung an
eine Künstlerwelt, deren Gestalten mit einem
geheimen, tödlichen Gram belastet scheinen.
Ihre Ruhe ist Schwermut, ihr Lächeln ist von
Tränen verschleiert, sie stehen in Dunkel und
Schatten wie Verirrte in einem tiefen Walde.
Ihre überhellen Stirnen adelt eine menschen-
fremde Würde. Sie tragen ihr Leben wie
eine schwere Mission, wie eine heilige Mission,
die Opfer und Leiden auferlegt. Das Licht,
welches von diesen sinnenden Gesichtern und
diesen apathischen, geistigen Händen ausgeht,
ist nicht das Licht des Tages und der Sonne.
Es kommt von innen, und es ist die Seele,
die ihre Hülle strahlend durchbricht. So fein,
so leise und tröstlich hat selten das Wort
eines Künstlers geklungen, und im Reiche
der Dichtkunst findet man höchstens bei
Maeterlinck, dem Lobredner des Schweigens,
oder bei Rainer Maria Rilke, dem zarten
Poeten der Stille, ähnliche Töne wieder.
Man hat Carrihre den Maler des Okkul-
tismus und des Spiritismus genannt. Das
Wort ist eine schlechte Feuilletonistenprägung.
Carriere ist nicht Okkultist, sondern Esoteriker.
Sein Blick ist auf das Bleibende, das Ewig-
Bedeutungsvolle im Menschen gerichtet, und
da alles Bleibende im Innern liegt, gewann
seine Kunst die vornehmen, tagfremden Ge-
berden, gewann sie jene ins »Hinterweltliche«,
ins Übersinnliche hinausweisende vage Geste,
die das Hauptmerkmal seines Schaffens wurde.
Carriere gehört zu jenen zahlreichen Er-
scheinungen, in denen als Rückschlag auf den
Licht- und Farbentaumel des ersten Impres-
sionismus eine fast verstiegene Geistigkeit zum
Durchbruch gelangte. Die Nerven fingen an,
von der lauten Janitscharenmusik des Sensoriums
verletzt zu werden. Man begann von neuem
das Dunkel zu lieben, die tiefen brauenden
508
wurde, während frühere Zeiten, da die Kunst
allein eine Sache des Auftraggebers und des
Künstlers war, nicht nur ein grösseres Maß
von Initiative, auch ein solches von Respekt
und Verständis voraussetzten. Daneben ist
dann eine neue Art von Mäcen entstanden,
der zwar nur die gute Kunst fördert, zugleich
aber als die giftigste Blüte des bourgoisen
Händlersinnes bezeichnet werden muss: es
gibt in London, Paris und Amsterdam längst,
bei uns noch weniger, eine Gruppe von Bör-
sianern, die, das unbekannte Genie völlig
missachtend, die ruhmbedeckten Werke wie
Wertpapiere kauft und sie, als sichere Kapital-
anlage, nicht mal mehr aus der Kiste nimmt.
So ist an diesem Punkte nicht nur der Künst-
ler durch den neuen Gang der Dinge pro-
tektionslos geworden, sondern seinem Werk
auch die natürliche Wirkung abgeschnitten.
Und doch ist die Zukunft nicht aussichts-
los. Mag es auch zutreffen, dass die stärksten
Intelligenzen teils keinen Anschluss finden, teils
sich im Augenblick der Kunst nicht zuwenden,
weil die soziale Frage mit ihrem lauten Pro-
gramm im Vordergrunde steht, und das allzu
heftige Betonen der Kunst beinahe wie eine
unzeitgemäße Überschätzung erscheinen lässt,
mag auch der Sozialismus mit seiner Begleit-
erscheinung, der Frauenbewegung, die Kultur-
losigkeit eher noch gefördert haben, indem
er einen Teil der Frauen der Kennerschaft
ihres alten Bereichs entriss und so vorläufig
die Kultur der Häuslichkeit entgeistigte, mag
auch die Maschine den Markt mit billigen
Massenartikeln überschwemmen, wo früher aus
der Hand des Arbeiters ein Kunstwerk auf
den Platz kam, diese ganze Bewegung muss
auf einen Punkt kommen, da ihr nichts übrig
bleibt als aus sich selbst Anschluss an den
alten Geist zu suchen und so jeder neuen
Lebensregung die Spuren des Künstlerischen
zu geben. Dann wird nicht mehr der Ein-
zelne, dann werden die Völker die Rolle des
Mäcenas übernommen haben und an Stelle
des zu verehrenden Kultusbildes, das nur in
der alten Zeit die Malerei auf jene Glanz-
höhe führen konnte, wird die Nutzkunst des
Alltags dem Leben jedes Einzelnen Vornehm-
heit und Weihe geben. — rudolf klein.
EUGENE CARRIERE f.
Der Name weckt die Erinnerung an blasse,
wie aus leuchtenden Nebeln geformte
Gesichter, an Augen, die tief und fremd in
den unseren ruhen, an Hände, die weiss und
gespenstisch, mit einem Ausdruck voll Geist
und Leiden, aus dunklen Gewandpartien
hervorleuchten. Er weckt die Erinnerung an
eine Künstlerwelt, deren Gestalten mit einem
geheimen, tödlichen Gram belastet scheinen.
Ihre Ruhe ist Schwermut, ihr Lächeln ist von
Tränen verschleiert, sie stehen in Dunkel und
Schatten wie Verirrte in einem tiefen Walde.
Ihre überhellen Stirnen adelt eine menschen-
fremde Würde. Sie tragen ihr Leben wie
eine schwere Mission, wie eine heilige Mission,
die Opfer und Leiden auferlegt. Das Licht,
welches von diesen sinnenden Gesichtern und
diesen apathischen, geistigen Händen ausgeht,
ist nicht das Licht des Tages und der Sonne.
Es kommt von innen, und es ist die Seele,
die ihre Hülle strahlend durchbricht. So fein,
so leise und tröstlich hat selten das Wort
eines Künstlers geklungen, und im Reiche
der Dichtkunst findet man höchstens bei
Maeterlinck, dem Lobredner des Schweigens,
oder bei Rainer Maria Rilke, dem zarten
Poeten der Stille, ähnliche Töne wieder.
Man hat Carrihre den Maler des Okkul-
tismus und des Spiritismus genannt. Das
Wort ist eine schlechte Feuilletonistenprägung.
Carriere ist nicht Okkultist, sondern Esoteriker.
Sein Blick ist auf das Bleibende, das Ewig-
Bedeutungsvolle im Menschen gerichtet, und
da alles Bleibende im Innern liegt, gewann
seine Kunst die vornehmen, tagfremden Ge-
berden, gewann sie jene ins »Hinterweltliche«,
ins Übersinnliche hinausweisende vage Geste,
die das Hauptmerkmal seines Schaffens wurde.
Carriere gehört zu jenen zahlreichen Er-
scheinungen, in denen als Rückschlag auf den
Licht- und Farbentaumel des ersten Impres-
sionismus eine fast verstiegene Geistigkeit zum
Durchbruch gelangte. Die Nerven fingen an,
von der lauten Janitscharenmusik des Sensoriums
verletzt zu werden. Man begann von neuem
das Dunkel zu lieben, die tiefen brauenden
508