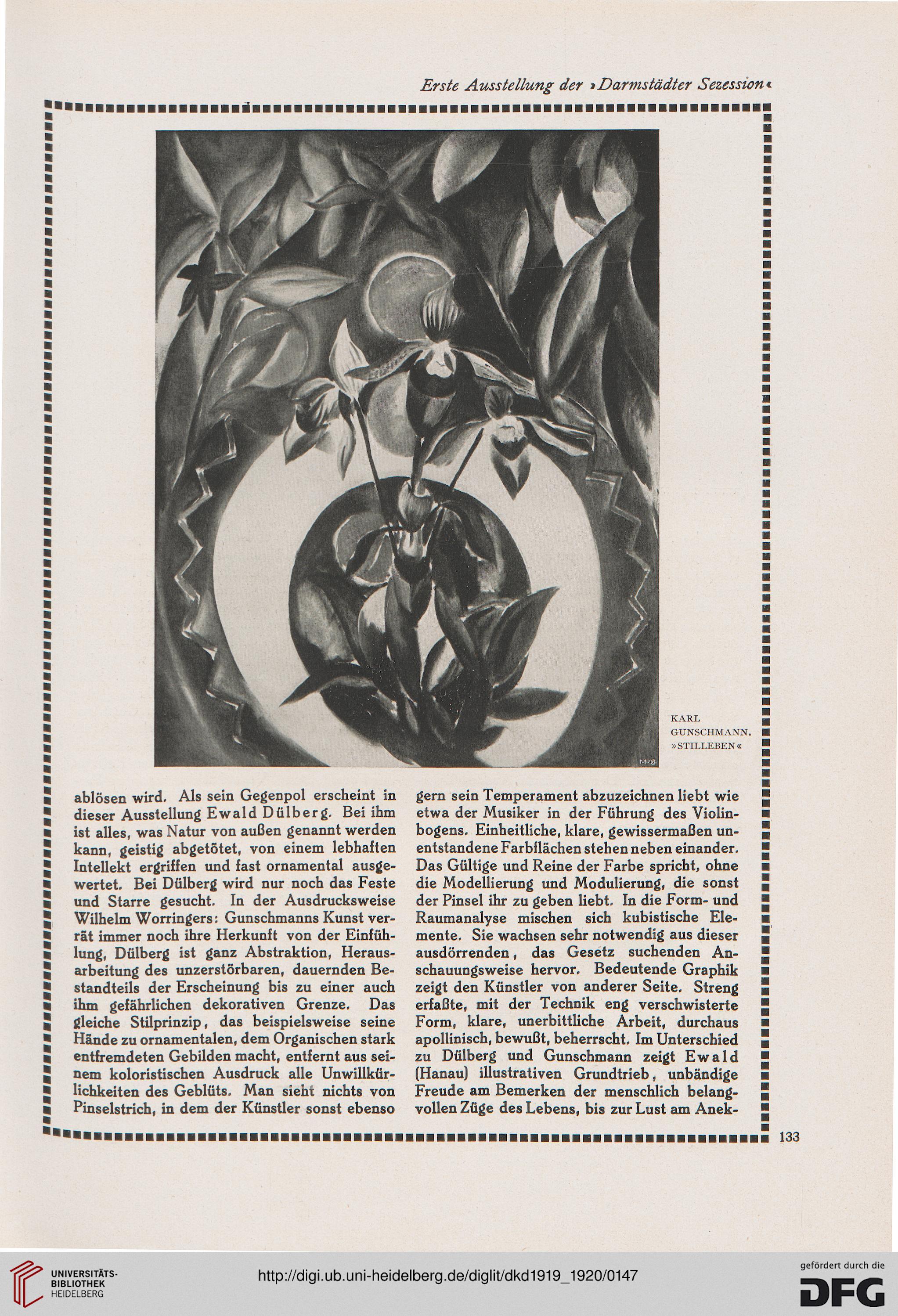Erste Ausstellung der »Darmstädter Sezession*.
KARL
GUNSCH M A NN.
»STILLEBEN«
ablösen wird. Als sein Gegenpol erscheint in
dieser Ausstellung Ewald Dülberg. Bei ihm
ist alles, was Natur von außen genannt werden
kann, geistig abgetötet, von einem lebhaften
Intellekt ergriffen und fast ornamental ausge-
wertet. Bei Dülberg wird nur noch das Feste
und Starre gesucht. In der Ausdrucksweise
Wilhelm Worringers: Gunschmanns Kunst ver-
rät immer noch ihre Herkunft von der Einfüh-
lung, Dülberg ist ganz Abstraktion, Heraus-
arbeitung des unzerstörbaren, dauernden Be-
standteils der Erscheinung bis zu einer auch
ihm gefährlichen dekorativen Grenze. Das
gleiche Stilprinzip, das beispielsweise seine
Hände zu ornamentalen, dem Organischen stark
entfremdeten Gebilden macht, entfernt aus sei-
nem koloristischen Ausdruck alle Unwillkür-
lichkeiten des Geblüts. Man sieht nichts von
Pinselstrich, in dem der Künstler sonst ebenso
gern sein Temperament abzuzeichnen liebt wie
etwa der Musiker in der Führung des Violin-
bogens. Einheitliche, klare, gewissermaßen un-
entstandene Farbflächen stehen neben einander.
Das Gültige und Reine der Farbe spricht, ohne
die Modellierung und Modulierung, die sonst
der Pinsel ihr zu geben liebt. In die Form- und
Raumanalyse mischen sich kubistische Ele-
mente. Sie wachsen sehr notwendig aus dieser
ausdörrenden, das Gesetz suchenden An-
schauungsweise hervor. Bedeutende Graphik
zeigt den Künstler von anderer Seite. Streng
erfaßte, mit der Technik eng verschwisterte
Form, klare, unerbittliche Arbeit, durchaus
apollinisch, bewußt, beherrscht. Im Unterschied
zu Dülberg und Gunschmann zeigt Ewald
(Hanau) illustrativen Grundtrieb, unbändige
Freude am Bemerken der menschlich belang-
vollen Züge des Lebens, bis zur Lust am Anek-
KARL
GUNSCH M A NN.
»STILLEBEN«
ablösen wird. Als sein Gegenpol erscheint in
dieser Ausstellung Ewald Dülberg. Bei ihm
ist alles, was Natur von außen genannt werden
kann, geistig abgetötet, von einem lebhaften
Intellekt ergriffen und fast ornamental ausge-
wertet. Bei Dülberg wird nur noch das Feste
und Starre gesucht. In der Ausdrucksweise
Wilhelm Worringers: Gunschmanns Kunst ver-
rät immer noch ihre Herkunft von der Einfüh-
lung, Dülberg ist ganz Abstraktion, Heraus-
arbeitung des unzerstörbaren, dauernden Be-
standteils der Erscheinung bis zu einer auch
ihm gefährlichen dekorativen Grenze. Das
gleiche Stilprinzip, das beispielsweise seine
Hände zu ornamentalen, dem Organischen stark
entfremdeten Gebilden macht, entfernt aus sei-
nem koloristischen Ausdruck alle Unwillkür-
lichkeiten des Geblüts. Man sieht nichts von
Pinselstrich, in dem der Künstler sonst ebenso
gern sein Temperament abzuzeichnen liebt wie
etwa der Musiker in der Führung des Violin-
bogens. Einheitliche, klare, gewissermaßen un-
entstandene Farbflächen stehen neben einander.
Das Gültige und Reine der Farbe spricht, ohne
die Modellierung und Modulierung, die sonst
der Pinsel ihr zu geben liebt. In die Form- und
Raumanalyse mischen sich kubistische Ele-
mente. Sie wachsen sehr notwendig aus dieser
ausdörrenden, das Gesetz suchenden An-
schauungsweise hervor. Bedeutende Graphik
zeigt den Künstler von anderer Seite. Streng
erfaßte, mit der Technik eng verschwisterte
Form, klare, unerbittliche Arbeit, durchaus
apollinisch, bewußt, beherrscht. Im Unterschied
zu Dülberg und Gunschmann zeigt Ewald
(Hanau) illustrativen Grundtrieb, unbändige
Freude am Bemerken der menschlich belang-
vollen Züge des Lebens, bis zur Lust am Anek-