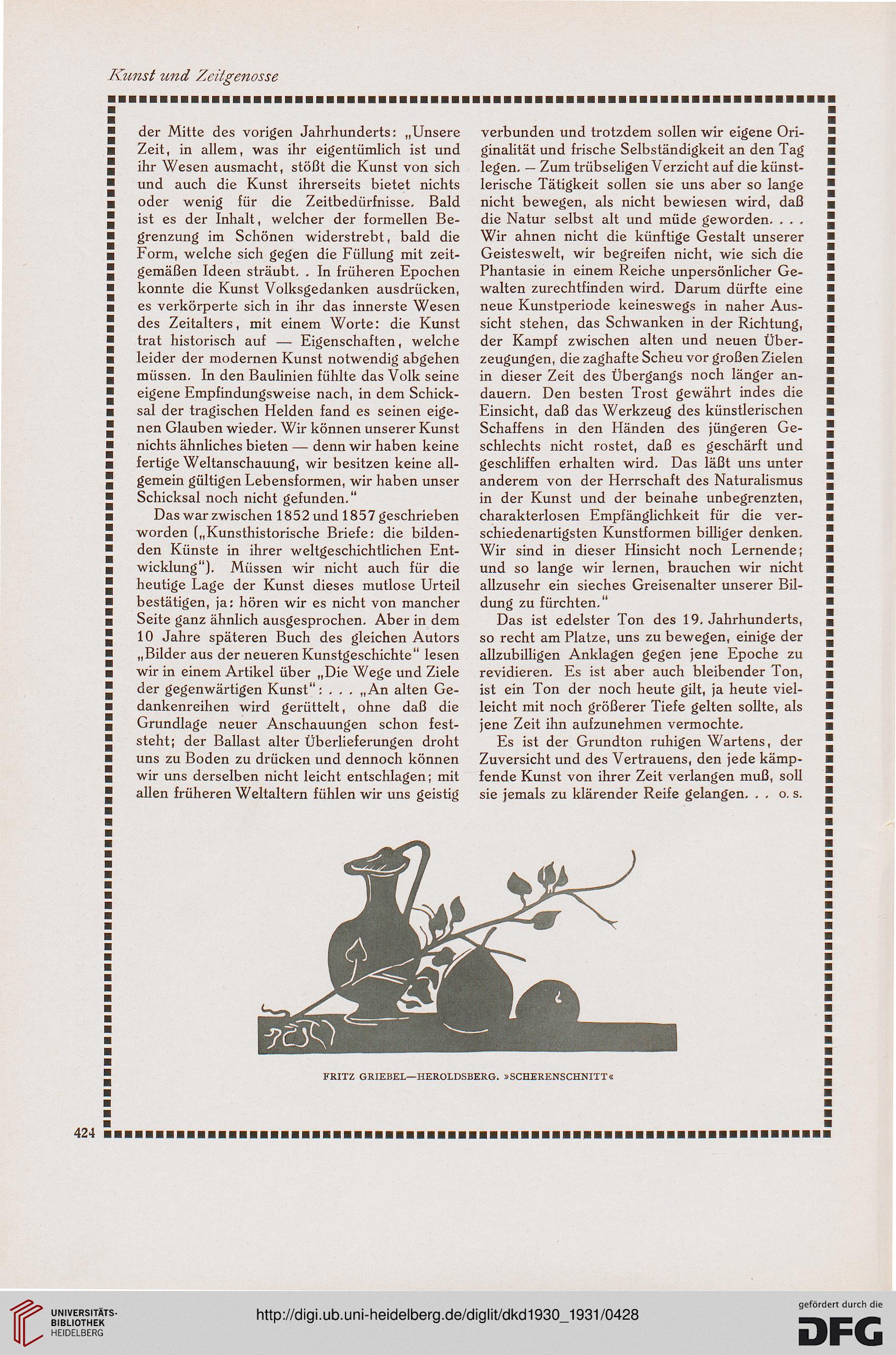Kunst und Zeitgenosse
der Mitte des vorigen Jahrhunderts: „Unsere
Zeit, in allem, was ihr eigentümlich ist und
ihr Wesen ausmacht, stößt die Kunst von sich
und auch die Kunst ihrerseits bietet nichts
oder wenig für die Zeitbedürfnisse, Bald
ist es der Inhalt, welcher der formellen Be-
grenzung im Schönen widerstrebt, bald die
Form, welche sich gegen die Füllung mit zeit-
gemäßen Ideen sträubt. . In früheren Epochen
konnte die Kunst Volksgedanken ausdrücken,
es verkörperte sich in ihr das innerste Wesen
des Zeitalters, mit einem Worte: die Kunst
trat historisch auf — Eigenschaften, welche
leider der modernen Kunst notwendig abgehen
müssen. In den Baulinien fühlte das Volk seine
eigene Empfindungsweise nach, in dem Schick-
sal der tragischen Helden fand es seinen eige-
nen Glauben wieder. Wir können unserer Kunst
nichts ähnliches bieten — denn wir haben keine
fertige Weltanschauung, wir besitzen keine all-
gemein gültigen Lebensformen, wir haben unser
Schicksal noch nicht gefunden."
Das war zwischen 1852 und 1857 geschrieben
worden („Kunsthistorische Briefe: die bilden-
den Künste in ihrer weltgeschichtlichen Ent-
wicklung"). Müssen wir nicht auch für die
heutige Lage der Kunst dieses mutlose Urteil
bestätigen, ja: hören wir es nicht von mancher
Seite ganz ähnlich ausgesprochen. Aber in dem
10 Jahre späteren Buch des gleichen Autors
„Bilder aus der neueren Kunstgeschichte" lesen
wir in einem Artikel über „Die Wege und Ziele
der gegenwärtigen Kunst": . . . „An alten Ge-
dankenreihen wird gerüttelt, ohne daß die
Grundlage neuer Anschauungen schon fest-
steht; der Ballast alter Überlieferungen droht
uns zu Boden zu drücken und dennoch können
wir uns derselben nicht leicht entschlagen; mit
allen früheren Weltaltern fühlen wir uns geistig
verbunden und trotzdem sollen wir eigene Ori-
ginalität und frische Selbständigkeit an den Tag
legen. — Zum trübseligen Verzicht auf die künst-
lerische Tätigkeit sollen sie uns aber so lange
nicht bewegen, als nicht bewiesen wird, daß
die Natur selbst alt und müde geworden. . . .
Wir ahnen nicht die künftige Gestalt unserer
Geisteswelt, wir begreifen nicht, wie sich die
Phantasie in einem Reiche unpersönlicher Ge-
walten zurechtfinden wird. Darum dürfte eine
neue Kunstperiode keineswegs in naher Aus-
sicht stehen, das Schwanken in der Richtung,
der Kampf zwischen alten und neuen Über-
zeugungen, die zaghafte Scheu vor großen Zielen
in dieser Zeit des Übergangs noch länger an-
dauern. Den besten Trost gewährt indes die
Einsicht, daß das Werkzeug des künstlerischen
Schaffens in den Händen des jüngeren Ge-
schlechts nicht rostet, daß es geschärft und
geschliffen erhalten wird. Das läßt uns unter
anderem von der Herrschaft des Naturalismus
in der Kunst und der beinahe unbegrenzten,
charakterlosen Empfänglichkeit für die ver-
schiedenartigsten Kunstformen billiger denken.
Wir sind in dieser Hinsicht noch Lernende;
und so lange wir lernen, brauchen wir nicht
allzusehr ein sieches Greisenalter unserer Bil-
dung zu fürchten."
Das ist edelster Ton des 19. Jahrhunderts,
so recht am Platze, uns zu bewegen, einige der
allzubilligen Anklagen gegen jene Epoche zu
revidieren. Es ist aber auch bleibender Ton,
ist ein Ton der noch heute gilt, ja heute viel-
leicht mit noch größerer Tiefe gelten sollte, als
jene Zeit ihn aufzunehmen vermochte.
Es ist der Grundton ruhigen Wartens, der
Zuversicht und des Vertrauens, den jede kämp-
fende Kunst von ihrer Zeit verlangen muß, soll
sie jemals zu klärender Reife gelangen. . . o. s.
FRITZ GRIEBEL—HEROLDSBERG. »SCHERENSCHNITT«
der Mitte des vorigen Jahrhunderts: „Unsere
Zeit, in allem, was ihr eigentümlich ist und
ihr Wesen ausmacht, stößt die Kunst von sich
und auch die Kunst ihrerseits bietet nichts
oder wenig für die Zeitbedürfnisse, Bald
ist es der Inhalt, welcher der formellen Be-
grenzung im Schönen widerstrebt, bald die
Form, welche sich gegen die Füllung mit zeit-
gemäßen Ideen sträubt. . In früheren Epochen
konnte die Kunst Volksgedanken ausdrücken,
es verkörperte sich in ihr das innerste Wesen
des Zeitalters, mit einem Worte: die Kunst
trat historisch auf — Eigenschaften, welche
leider der modernen Kunst notwendig abgehen
müssen. In den Baulinien fühlte das Volk seine
eigene Empfindungsweise nach, in dem Schick-
sal der tragischen Helden fand es seinen eige-
nen Glauben wieder. Wir können unserer Kunst
nichts ähnliches bieten — denn wir haben keine
fertige Weltanschauung, wir besitzen keine all-
gemein gültigen Lebensformen, wir haben unser
Schicksal noch nicht gefunden."
Das war zwischen 1852 und 1857 geschrieben
worden („Kunsthistorische Briefe: die bilden-
den Künste in ihrer weltgeschichtlichen Ent-
wicklung"). Müssen wir nicht auch für die
heutige Lage der Kunst dieses mutlose Urteil
bestätigen, ja: hören wir es nicht von mancher
Seite ganz ähnlich ausgesprochen. Aber in dem
10 Jahre späteren Buch des gleichen Autors
„Bilder aus der neueren Kunstgeschichte" lesen
wir in einem Artikel über „Die Wege und Ziele
der gegenwärtigen Kunst": . . . „An alten Ge-
dankenreihen wird gerüttelt, ohne daß die
Grundlage neuer Anschauungen schon fest-
steht; der Ballast alter Überlieferungen droht
uns zu Boden zu drücken und dennoch können
wir uns derselben nicht leicht entschlagen; mit
allen früheren Weltaltern fühlen wir uns geistig
verbunden und trotzdem sollen wir eigene Ori-
ginalität und frische Selbständigkeit an den Tag
legen. — Zum trübseligen Verzicht auf die künst-
lerische Tätigkeit sollen sie uns aber so lange
nicht bewegen, als nicht bewiesen wird, daß
die Natur selbst alt und müde geworden. . . .
Wir ahnen nicht die künftige Gestalt unserer
Geisteswelt, wir begreifen nicht, wie sich die
Phantasie in einem Reiche unpersönlicher Ge-
walten zurechtfinden wird. Darum dürfte eine
neue Kunstperiode keineswegs in naher Aus-
sicht stehen, das Schwanken in der Richtung,
der Kampf zwischen alten und neuen Über-
zeugungen, die zaghafte Scheu vor großen Zielen
in dieser Zeit des Übergangs noch länger an-
dauern. Den besten Trost gewährt indes die
Einsicht, daß das Werkzeug des künstlerischen
Schaffens in den Händen des jüngeren Ge-
schlechts nicht rostet, daß es geschärft und
geschliffen erhalten wird. Das läßt uns unter
anderem von der Herrschaft des Naturalismus
in der Kunst und der beinahe unbegrenzten,
charakterlosen Empfänglichkeit für die ver-
schiedenartigsten Kunstformen billiger denken.
Wir sind in dieser Hinsicht noch Lernende;
und so lange wir lernen, brauchen wir nicht
allzusehr ein sieches Greisenalter unserer Bil-
dung zu fürchten."
Das ist edelster Ton des 19. Jahrhunderts,
so recht am Platze, uns zu bewegen, einige der
allzubilligen Anklagen gegen jene Epoche zu
revidieren. Es ist aber auch bleibender Ton,
ist ein Ton der noch heute gilt, ja heute viel-
leicht mit noch größerer Tiefe gelten sollte, als
jene Zeit ihn aufzunehmen vermochte.
Es ist der Grundton ruhigen Wartens, der
Zuversicht und des Vertrauens, den jede kämp-
fende Kunst von ihrer Zeit verlangen muß, soll
sie jemals zu klärender Reife gelangen. . . o. s.
FRITZ GRIEBEL—HEROLDSBERG. »SCHERENSCHNITT«