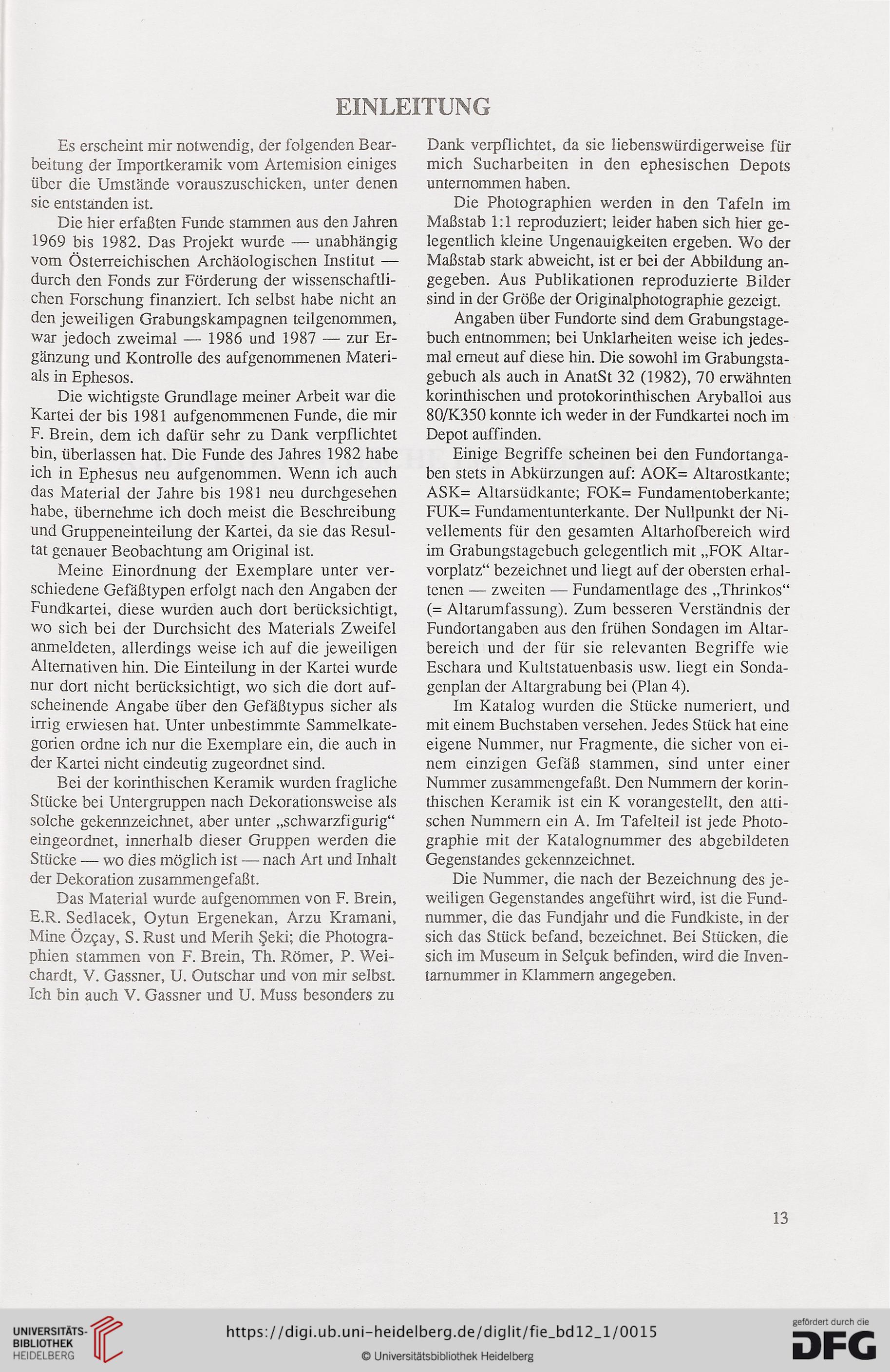EINLEITUNG
Es erscheint mir notwendig, der folgenden Bear-
beitung der Importkeramik vom Artemision einiges
über die Umstände vorauszuschicken, unter denen
sie entständen ist.
Die hier erfaßten Funde stammen aus den Jahren
1969 bis 1982. Das Projekt wurde — unabhängig
vom Österreichischen Archäologischen Institut —
durch den Fonds zur Förderung der wissenschaftli-
chen Forschung finanziert. Ich selbst habe nicht an
den jeweiligen Grabungskampagnen teilgenommen,
war jedoch zweimal — 1986 und 1987 — zur Er-
gänzung und Kontrolle des aufgenommenen Materi-
als in Ephesos.
Die wichtigste Grundlage meiner Arbeit war die
Kartei der bis 1981 aufgenommenen Funde, die mir
F. Brein, dem ich dafür sehr zu Dank verpflichtet
bin, überlassen hat. Die Funde des Jahres 1982 habe
ich in Ephesus neu aufgenommen. Wenn ich auch
das Material der Jahre bis 1981 neu durchgesehen
habe, übernehme ich doch meist die Beschreibung
und Gruppeneinteilung der Kartei, da sie das Resul-
tat genauer Beobachtung am Original ist.
Meine Einordnung der Exemplare unter ver-
schiedene Gefäßtypen erfolgt nach den Angaben der
Fundkartei, diese wurden auch dort berücksichtigt,
wo sich bei der Durchsicht des Materials Zweifel
anmeldeten, allerdings weise ich auf die jeweiligen
Alternativen hin. Die Einteilung in der Kartei wurde
nur dort nicht berücksichtigt, wo sich die dort auf-
scheinende Angabe über den Gefäßtypus sicher als
irrig erwiesen hat. Unter unbestimmte Sammelkate-
gorien ordne ich nur die Exemplare ein, die auch in
der Kartei nicht eindeutig zugeordnet sind.
Bei der korinthischen Keramik wurden fragliche
Stücke bei Untergruppen nach Dekorationsweise als
solche gekennzeichnet, aber unter „schwarzfigurig“
eingeordnet, innerhalb dieser Gruppen werden die
Stücke — wo dies möglich ist — nach Art und Inhalt
der Dekoration zusammengefaßt.
Das Material wurde aufgenommen von F. Brein,
E.R. Sedlacek, Oytun Ergenekan, Arzu Kramani,
Mine Öz^ay, S. Rust und Merih §eki; die Photogra-
phien stammen von F. Brein, Th. Römer, P. Wei-
chardt, V. Gassner, U. Outschar und von mir selbst.
Ich bin auch V. Gassner und U. Muss besonders zu
Dank verpflichtet, da sie liebenswürdigerweise für
mich Sucharbeiten in den ephesischen Depots
unternommen haben.
Die Photographien werden in den Tafeln im
Maßstab 1:1 reproduziert; leider haben sich hier ge-
legentlich kleine Ungenauigkeiten ergeben. Wo der
Maßstab stark abweicht, ist er bei der Abbildung an-
gegeben. Aus Publikationen reproduzierte Bilder
sind in der Größe der Originalphotographie gezeigt.
Angaben über Fundorte sind dem Grabungstage-
buch entnommen; bei Unklarheiten weise ich jedes-
mal erneut auf diese hin. Die sowohl im Grabungsta-
gebuch als auch in AnatSt 32 (1982), 70 erwähnten
korinthischen und protokorinthischen Aryballoi aus
80/K350 konnte ich weder in der Fundkartei noch im
Depot auffinden.
Einige Begriffe scheinen bei den Fundortanga-
ben stets in Abkürzungen auf: AOK= Altarostkante;
ASK= Altarsüdkante; FOK= Fundamentoberkante;
FUK= Fundamentunterkante. Der Nullpunkt der Ni-
vellements für den gesamten Altarhofbereich wird
im Grabungstagebuch gelegentlich mit „FOK Altar-
vorplatz“ bezeichnet und liegt auf der obersten erhal-
tenen — zweiten — Fundamentlage des „Thrinkos“
(= Altarumfassung). Zum besseren Verständnis der
Fundortangaben aus den frühen Sondagen im Altar-
bereich und der für sie relevanten Begriffe wie
Eschara und Kultstatuenbasis usw. liegt ein Sonda-
genplan der Altargrabung bei (Plan 4).
Im Katalog wurden die Stücke numeriert, und
mit einem Buchstaben versehen. Jedes Stück hat eine
eigene Nummer, nur Fragmente, die sicher von ei-
nem einzigen Gefäß stammen, sind unter einer
Nummer zusammengefaßt. Den Nummern der korin-
thischen Keramik ist ein K vorangestellt, den atti-
schen Nummern ein A. Im Tafelteil ist jede Photo-
graphie mit der Katalognummer des abgebildeten
Gegenstandes gekennzeichnet.
Die Nummer, die nach der Bezeichnung des je-
weiligen Gegenstandes angeführt wird, ist die Fund-
nummer, die das Fundjahr und die Fundkiste, in der
sich das Stück befand, bezeichnet. Bei Stücken, die
sich im Museum in Selfuk befinden, wird die Inven-
tarriummer in Klammem angegeben.
13
Es erscheint mir notwendig, der folgenden Bear-
beitung der Importkeramik vom Artemision einiges
über die Umstände vorauszuschicken, unter denen
sie entständen ist.
Die hier erfaßten Funde stammen aus den Jahren
1969 bis 1982. Das Projekt wurde — unabhängig
vom Österreichischen Archäologischen Institut —
durch den Fonds zur Förderung der wissenschaftli-
chen Forschung finanziert. Ich selbst habe nicht an
den jeweiligen Grabungskampagnen teilgenommen,
war jedoch zweimal — 1986 und 1987 — zur Er-
gänzung und Kontrolle des aufgenommenen Materi-
als in Ephesos.
Die wichtigste Grundlage meiner Arbeit war die
Kartei der bis 1981 aufgenommenen Funde, die mir
F. Brein, dem ich dafür sehr zu Dank verpflichtet
bin, überlassen hat. Die Funde des Jahres 1982 habe
ich in Ephesus neu aufgenommen. Wenn ich auch
das Material der Jahre bis 1981 neu durchgesehen
habe, übernehme ich doch meist die Beschreibung
und Gruppeneinteilung der Kartei, da sie das Resul-
tat genauer Beobachtung am Original ist.
Meine Einordnung der Exemplare unter ver-
schiedene Gefäßtypen erfolgt nach den Angaben der
Fundkartei, diese wurden auch dort berücksichtigt,
wo sich bei der Durchsicht des Materials Zweifel
anmeldeten, allerdings weise ich auf die jeweiligen
Alternativen hin. Die Einteilung in der Kartei wurde
nur dort nicht berücksichtigt, wo sich die dort auf-
scheinende Angabe über den Gefäßtypus sicher als
irrig erwiesen hat. Unter unbestimmte Sammelkate-
gorien ordne ich nur die Exemplare ein, die auch in
der Kartei nicht eindeutig zugeordnet sind.
Bei der korinthischen Keramik wurden fragliche
Stücke bei Untergruppen nach Dekorationsweise als
solche gekennzeichnet, aber unter „schwarzfigurig“
eingeordnet, innerhalb dieser Gruppen werden die
Stücke — wo dies möglich ist — nach Art und Inhalt
der Dekoration zusammengefaßt.
Das Material wurde aufgenommen von F. Brein,
E.R. Sedlacek, Oytun Ergenekan, Arzu Kramani,
Mine Öz^ay, S. Rust und Merih §eki; die Photogra-
phien stammen von F. Brein, Th. Römer, P. Wei-
chardt, V. Gassner, U. Outschar und von mir selbst.
Ich bin auch V. Gassner und U. Muss besonders zu
Dank verpflichtet, da sie liebenswürdigerweise für
mich Sucharbeiten in den ephesischen Depots
unternommen haben.
Die Photographien werden in den Tafeln im
Maßstab 1:1 reproduziert; leider haben sich hier ge-
legentlich kleine Ungenauigkeiten ergeben. Wo der
Maßstab stark abweicht, ist er bei der Abbildung an-
gegeben. Aus Publikationen reproduzierte Bilder
sind in der Größe der Originalphotographie gezeigt.
Angaben über Fundorte sind dem Grabungstage-
buch entnommen; bei Unklarheiten weise ich jedes-
mal erneut auf diese hin. Die sowohl im Grabungsta-
gebuch als auch in AnatSt 32 (1982), 70 erwähnten
korinthischen und protokorinthischen Aryballoi aus
80/K350 konnte ich weder in der Fundkartei noch im
Depot auffinden.
Einige Begriffe scheinen bei den Fundortanga-
ben stets in Abkürzungen auf: AOK= Altarostkante;
ASK= Altarsüdkante; FOK= Fundamentoberkante;
FUK= Fundamentunterkante. Der Nullpunkt der Ni-
vellements für den gesamten Altarhofbereich wird
im Grabungstagebuch gelegentlich mit „FOK Altar-
vorplatz“ bezeichnet und liegt auf der obersten erhal-
tenen — zweiten — Fundamentlage des „Thrinkos“
(= Altarumfassung). Zum besseren Verständnis der
Fundortangaben aus den frühen Sondagen im Altar-
bereich und der für sie relevanten Begriffe wie
Eschara und Kultstatuenbasis usw. liegt ein Sonda-
genplan der Altargrabung bei (Plan 4).
Im Katalog wurden die Stücke numeriert, und
mit einem Buchstaben versehen. Jedes Stück hat eine
eigene Nummer, nur Fragmente, die sicher von ei-
nem einzigen Gefäß stammen, sind unter einer
Nummer zusammengefaßt. Den Nummern der korin-
thischen Keramik ist ein K vorangestellt, den atti-
schen Nummern ein A. Im Tafelteil ist jede Photo-
graphie mit der Katalognummer des abgebildeten
Gegenstandes gekennzeichnet.
Die Nummer, die nach der Bezeichnung des je-
weiligen Gegenstandes angeführt wird, ist die Fund-
nummer, die das Fundjahr und die Fundkiste, in der
sich das Stück befand, bezeichnet. Bei Stücken, die
sich im Museum in Selfuk befinden, wird die Inven-
tarriummer in Klammem angegeben.
13