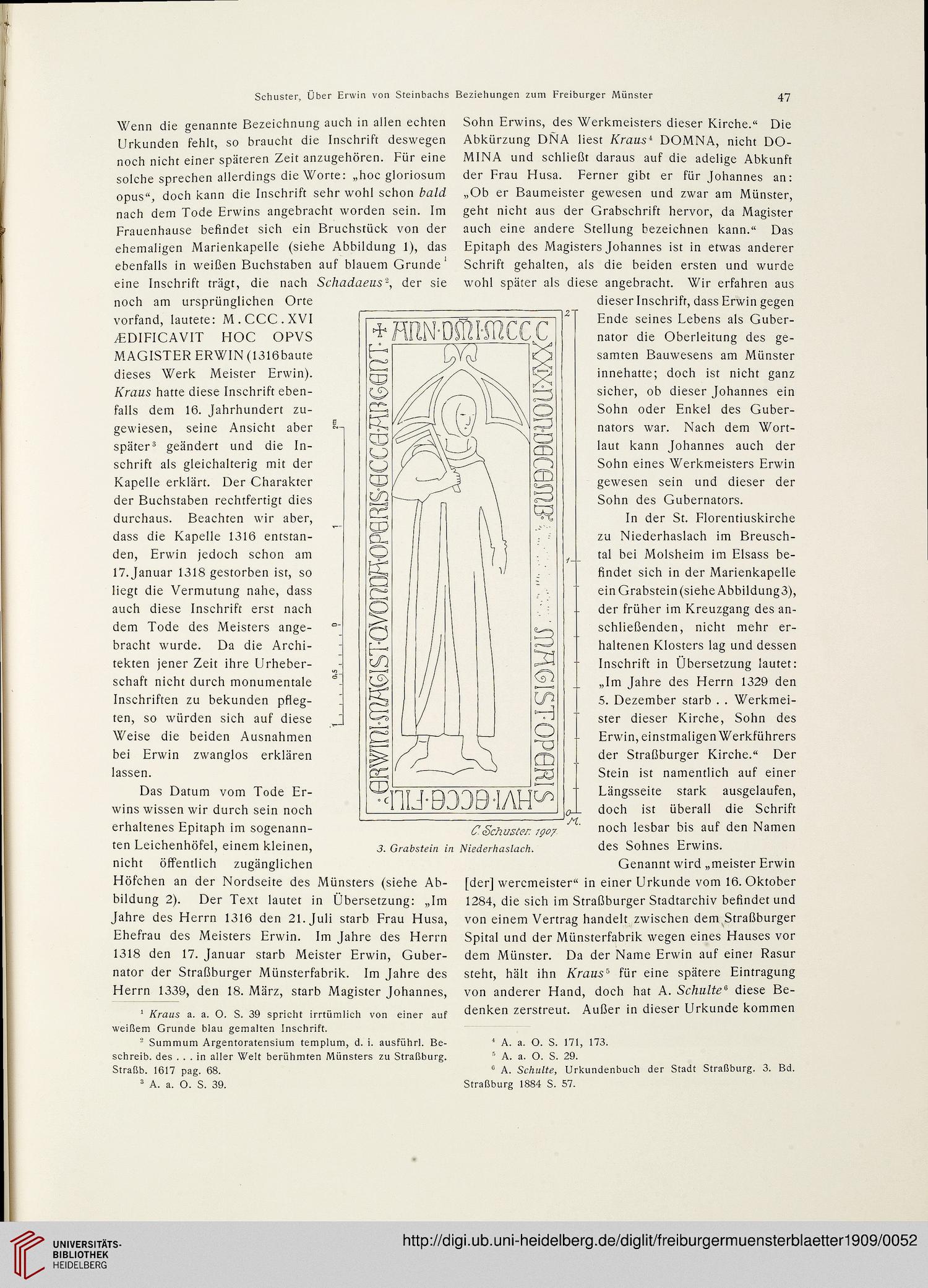Schuster, Über Erwin von Steinbachs Beziehungen zum Freiburger Münster
47
Wenn die genannte Bezeichnung auch in allen echten
Urkunden fehlt, so braucht die Inschrift deswegen
noch nicht einer späteren Zeit anzugehören. Für eine
solche sprechen allerdings die Worte: „hoc gloriosum
opus", doch kann die Inschrift sehr wohl schon bald
nach dem Tode Erwins angebracht worden sein. Im
Frauenhause befindet sich ein Bruchstück von der
ehemaligen Marienkapelle (siehe Abbildung 1), das
ebenfalls in weißen Buchstaben auf blauem Grunde1
eine Inschrift trägt, die nach Schadaeus'2, der sie
noch am ursprünglichen Orte
vorfand, lautete: M.CCC.XVI
yEDIFICAVIT HOC OPVS
MAGISTER ERWIN (1316baute
dieses Werk Meister Erwin).
Kraus hatte diese Inschrift eben-
falls dem 16. Jahrhundert zu-
gewiesen, seine Ansicht aber
später3 geändert und die In-
schrift als gleichalterig mit der
Kapelle erklärt. Der Charakter
der Buchstaben rechtfertigt dies
durchaus. Beachten wir aber,
dass die Kapelle 1316 entstan-
den, Erwin jedoch schon am
17. Januar 1318 gestorben ist, so
liegt die Vermutung nahe, dass
auch diese Inschrift erst nach
dem Tode des Meisters ange-
bracht wurde. Da die Archi-
tekten jener Zeit ihre Urheber-
schaft nicht durch monumentale
Inschriften zu bekunden pfleg-
ten, so würden sich auf diese
Weise die beiden Ausnahmen
bei Erwin zwanglos erklären
lassen.
Das Datum vom Tode Er-
wins wissen wir durch sein noch
erhaltenes Epitaph im sogenann-
ten Leichenhöfel, einem kleinen,
nicht öffentlich zugänglichen
Höfchen an der Nordseite des Münsters (siehe Ab-
bildung 2). Der Text lautet in Übersetzung: „Im
Jahre des Herrn 1316 den 21. Juli starb Frau Husa,
Ehefrau des Meisters Erwin. Im Jahre des Herrn
1318 den 17. Januar starb Meister Erwin, Guber-
nator der Straßburger Münsterfabrik. Im Jahre des
Herrn 1339, den 18. März, starb Magister Johannes,
1 Kraus a. a. O. S. 39 spricht irrtümlich von einer auf
weißem Grunde blau gemalten Inschrift.
s Summum Argentoratensìum templum, d. i. ausführt. Be-
schreib, des ... in aller Welt berühmten Münsters zu Straßburg.
Straßb. 1617 pag. 68.
3 A. a. O. S. 39.
Sohn Erwins, des Werkmeisters dieser Kirche." Die
Abkürzung DNA liest Kraus4- DOMNA, nicht DO-
MINA und schließt daraus auf die adelige Abkunft
der Frau Husa. Ferner gibt er für Johannes an:
„Ob er Baumeister gewesen und zwar am Münster,
geht nicht aus der Grabschrift hervor, da Magister
auch eine andere Stellung bezeichnen kann." Das
Epitaph des Magisters Johannes ist in etwas anderer
Schrift gehalten, als die beiden ersten und wurde
wohl später als diese angebracht. Wir erfahren aus
dieser Inschrift, dass Erwin gegen
Ende seines Lebens als Guber-
nator die Oberleitung des ge-
samten Bauwesens am Münster
innehatte; doch ist nicht ganz
sicher, ob dieser Johannes ein
Sohn oder Enkel des Guber-
nators war. Nach dem Wort-
laut kann Johannes auch der
Sohn eines Werkmeisters Erwin
gewesen sein und dieser der
Sohn des Gubernators.
In der St. Florentiuskirche
zu Niederhaslach im Breusch-
tal bei Molsheim im Elsass be-
findet sich in der Marienkapelle
einGrabstein(sieheAbbildung3),
der früher im Kreuzgang des an-
schließenden, nicht mehr er-
haltenen Klosters lag und dessen
Inschrift in Übersetzung lautet:
„Im Jahre des Herrn 1329 den
5. Dezember starb . . Werkmei-
ster dieser Kirche, Sohn des
Erwin, einstmaligen Werkführers
der Straßburger Kirche." Der
Stein ist namentlich auf einer
Längsseite stark ausgelaufen,
doch ist überall die Schrift
noch lesbar bis auf den Namen
des Sohnes Erwins.
Genannt wird „meister Erwin
[der] wercmeister" in einer Urkunde vom 16. Oktober
1284, die sich im Straßburger Stadtarchiv befindet und
von einem Vertrag handelt zwischen dem^Straßburger
Spital und der Münsterfabrik wegen eines Hauses vor
dem Münster. Da der Name Erwin auf einet Rasur
steht, hält ihn Krausr° für eine spätere Eintragung
von anderer Hand, doch hat A. Schulte6 diese Be-
denken zerstreut. Außer in dieser Urkunde kommen
' A. a. O. S. 171, 173.
5 A. a. O. S. 29.
11 A. Schulte, Urkundenbuch der Stadt Straßburg. 3. Bd.
Straßburg 1884 S. 57.
C. Schuster, jgoy
3. Grabstein, in Niederhaslach.
0^-
Si.
47
Wenn die genannte Bezeichnung auch in allen echten
Urkunden fehlt, so braucht die Inschrift deswegen
noch nicht einer späteren Zeit anzugehören. Für eine
solche sprechen allerdings die Worte: „hoc gloriosum
opus", doch kann die Inschrift sehr wohl schon bald
nach dem Tode Erwins angebracht worden sein. Im
Frauenhause befindet sich ein Bruchstück von der
ehemaligen Marienkapelle (siehe Abbildung 1), das
ebenfalls in weißen Buchstaben auf blauem Grunde1
eine Inschrift trägt, die nach Schadaeus'2, der sie
noch am ursprünglichen Orte
vorfand, lautete: M.CCC.XVI
yEDIFICAVIT HOC OPVS
MAGISTER ERWIN (1316baute
dieses Werk Meister Erwin).
Kraus hatte diese Inschrift eben-
falls dem 16. Jahrhundert zu-
gewiesen, seine Ansicht aber
später3 geändert und die In-
schrift als gleichalterig mit der
Kapelle erklärt. Der Charakter
der Buchstaben rechtfertigt dies
durchaus. Beachten wir aber,
dass die Kapelle 1316 entstan-
den, Erwin jedoch schon am
17. Januar 1318 gestorben ist, so
liegt die Vermutung nahe, dass
auch diese Inschrift erst nach
dem Tode des Meisters ange-
bracht wurde. Da die Archi-
tekten jener Zeit ihre Urheber-
schaft nicht durch monumentale
Inschriften zu bekunden pfleg-
ten, so würden sich auf diese
Weise die beiden Ausnahmen
bei Erwin zwanglos erklären
lassen.
Das Datum vom Tode Er-
wins wissen wir durch sein noch
erhaltenes Epitaph im sogenann-
ten Leichenhöfel, einem kleinen,
nicht öffentlich zugänglichen
Höfchen an der Nordseite des Münsters (siehe Ab-
bildung 2). Der Text lautet in Übersetzung: „Im
Jahre des Herrn 1316 den 21. Juli starb Frau Husa,
Ehefrau des Meisters Erwin. Im Jahre des Herrn
1318 den 17. Januar starb Meister Erwin, Guber-
nator der Straßburger Münsterfabrik. Im Jahre des
Herrn 1339, den 18. März, starb Magister Johannes,
1 Kraus a. a. O. S. 39 spricht irrtümlich von einer auf
weißem Grunde blau gemalten Inschrift.
s Summum Argentoratensìum templum, d. i. ausführt. Be-
schreib, des ... in aller Welt berühmten Münsters zu Straßburg.
Straßb. 1617 pag. 68.
3 A. a. O. S. 39.
Sohn Erwins, des Werkmeisters dieser Kirche." Die
Abkürzung DNA liest Kraus4- DOMNA, nicht DO-
MINA und schließt daraus auf die adelige Abkunft
der Frau Husa. Ferner gibt er für Johannes an:
„Ob er Baumeister gewesen und zwar am Münster,
geht nicht aus der Grabschrift hervor, da Magister
auch eine andere Stellung bezeichnen kann." Das
Epitaph des Magisters Johannes ist in etwas anderer
Schrift gehalten, als die beiden ersten und wurde
wohl später als diese angebracht. Wir erfahren aus
dieser Inschrift, dass Erwin gegen
Ende seines Lebens als Guber-
nator die Oberleitung des ge-
samten Bauwesens am Münster
innehatte; doch ist nicht ganz
sicher, ob dieser Johannes ein
Sohn oder Enkel des Guber-
nators war. Nach dem Wort-
laut kann Johannes auch der
Sohn eines Werkmeisters Erwin
gewesen sein und dieser der
Sohn des Gubernators.
In der St. Florentiuskirche
zu Niederhaslach im Breusch-
tal bei Molsheim im Elsass be-
findet sich in der Marienkapelle
einGrabstein(sieheAbbildung3),
der früher im Kreuzgang des an-
schließenden, nicht mehr er-
haltenen Klosters lag und dessen
Inschrift in Übersetzung lautet:
„Im Jahre des Herrn 1329 den
5. Dezember starb . . Werkmei-
ster dieser Kirche, Sohn des
Erwin, einstmaligen Werkführers
der Straßburger Kirche." Der
Stein ist namentlich auf einer
Längsseite stark ausgelaufen,
doch ist überall die Schrift
noch lesbar bis auf den Namen
des Sohnes Erwins.
Genannt wird „meister Erwin
[der] wercmeister" in einer Urkunde vom 16. Oktober
1284, die sich im Straßburger Stadtarchiv befindet und
von einem Vertrag handelt zwischen dem^Straßburger
Spital und der Münsterfabrik wegen eines Hauses vor
dem Münster. Da der Name Erwin auf einet Rasur
steht, hält ihn Krausr° für eine spätere Eintragung
von anderer Hand, doch hat A. Schulte6 diese Be-
denken zerstreut. Außer in dieser Urkunde kommen
' A. a. O. S. 171, 173.
5 A. a. O. S. 29.
11 A. Schulte, Urkundenbuch der Stadt Straßburg. 3. Bd.
Straßburg 1884 S. 57.
C. Schuster, jgoy
3. Grabstein, in Niederhaslach.
0^-
Si.