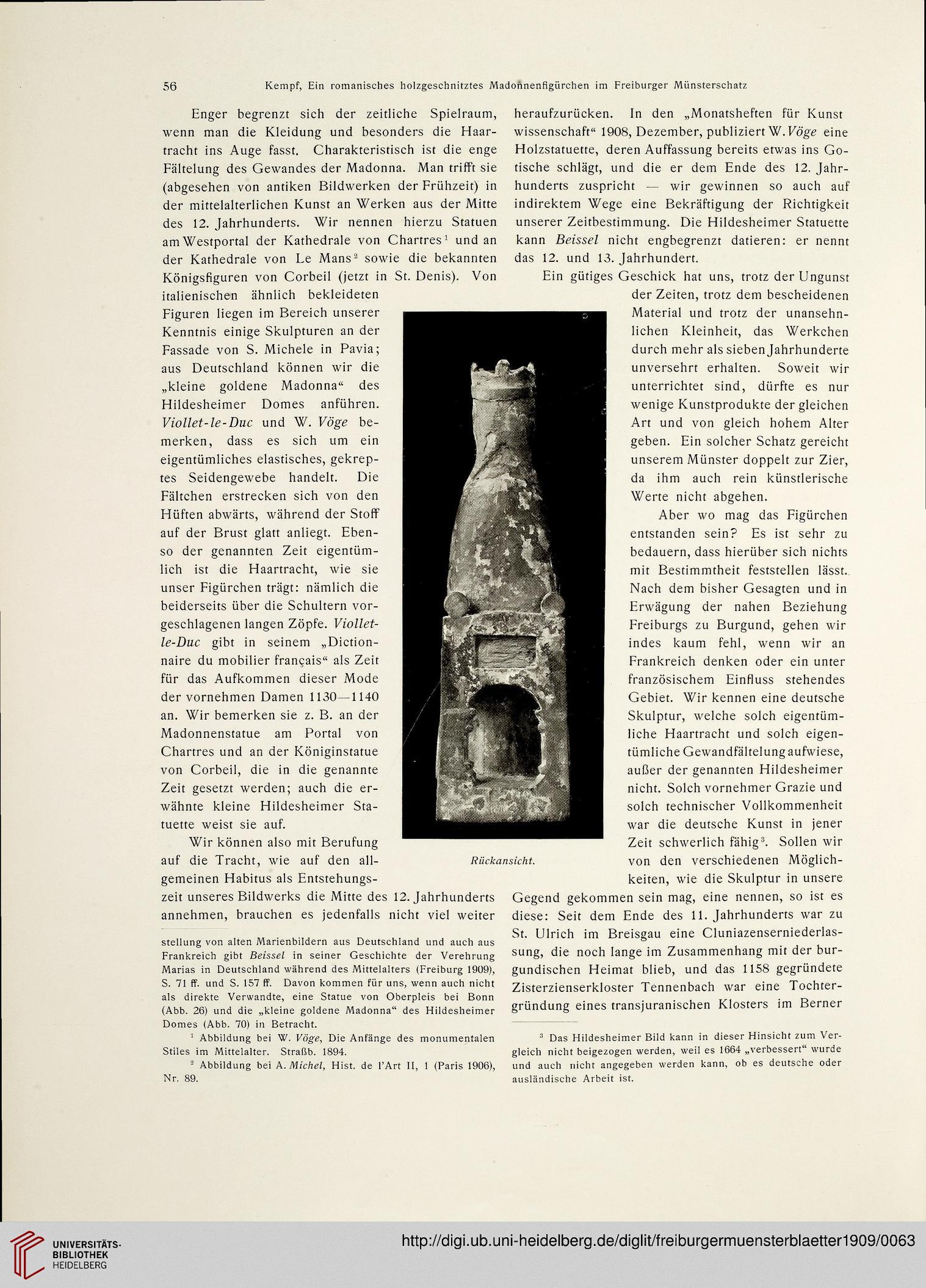56
Kempf, Ein romanisches holzgeschnitztes Madohnenfigürchen im Freiburger Münsterschatz
Enger begrenzt sich der zeitliche Spielraum,
wenn man die Kleidung und besonders die Haar-
tracht ins Auge fasst. Charakteristisch ist die enge
Fältelung des Gewandes der Madonna. Man trifft sie
(abgesehen von antiken Bildwerken der Frühzeit) in
der mittelalterlichen Kunst an Werken aus der Mitte
des 12. Jahrhunderts. Wir nennen hierzu Statuen
am Westportal der Kathedrale von Chartres1 und an
der Kathedrale von Le Mans2 sowie die bekannten
Königsfiguren von Corbeil (jetzt in St. Denis). Von
italienischen ähnlich bekleideten
Figuren liegen im Bereich unserer
Kenntnis einige Skulpturen an der
Fassade von S. Michele in Pavia;
aus Deutschland können wir die
„kleine goldene Madonna" des
Hildesheimer Domes anführen.
Viollet-le-Duc und W. Vöge be-
merken, dass es sich um ein
eigentümliches elastisches, gekrep-
tes Seidengewebe handelt. Die
Fältchen erstrecken sich von den
Hüften abwärts, während der Stoff
auf der Brust glatt anliegt. Eben-
so der genannten Zeit eigentüm-
lich ist die Haartracht, wie sie
unser Figürchen trägt: nämlich die
beiderseits über die Schultern vor-
geschlagenen langen Zöpfe. Viollet-
le-Duc gibt in seinem „Diction-
naire du mobilier français" als Zeit
für das Aufkommen dieser Mode
der vornehmen Damen 1130—1140
an. Wir bemerken sie z. B. an der
Madonnenstatue am Portal von
Chartres und an der Königinstatue
von Corbeil, die in die genannte
Zeit gesetzt werden; auch die er-
wähnte kleine Hildesheimer Sta-
tuette weist sie auf.
Wir können also mit Berufung
auf die Tracht, wie auf den all- Rückansicht
gemeinen Habitus als Entstehungs-
zeit unseres Bildwerks die Mitte des 12. Jahrhunderts
annehmen, brauchen es jedenfalls nicht viel weiter
Stellung von alten Marienbildern aus Deutschland und auch aus
Frankreich gibt Beissel in seiner Geschichte der Verehrung
Marias in Deutschland während des Mittelalters (Freiburg 1909),
S. 71 ff. und S. 157 ff. Davon kommen für uns, wenn auch nicht
als direkte Verwandte, eine Statue von Oberpleis bei Bonn
(Abb. 26) und die „kleine goldene Madonna" des Hildesheimer
Domes (Abb. 70) in Betracht.
1 Abbildung bei W. Vöge, Die Anfänge des monumentalen
Stiles im Mittelalter. Straßb. 1894.
- Abbildung bei A.Michel, Hist, de l'Art II, 1 (Paris 1906),
Nr. 89.
heraufzurücken. In den „Monatsheften für Kunst
Wissenschaft" 1908, Dezember, publiziert W.Vöge eine
Holzstatuette, deren Auffassung bereits etwas ins Go-
tische schlägt, und die er dem Ende des 12. Jahr-
hunderts zuspricht — wir gewinnen so auch auf
indirektem Wege eine Bekräftigung der Richtigkeit
unserer Zeitbestimmung. Die Hildesheimer Statuette
kann Beissel nicht engbegrenzt datieren: er nennt
das 12. und 13. Jahrhundert.
Ein gütiges Geschick hat uns, trotz der Ungunst
der Zeiten, trotz dem bescheidenen
Material und trotz der unansehn-
lichen Kleinheit, das Werkchen
durch mehr als sieben Jahrhunderte
unversehrt erhalten. Soweit wir
unterrichtet sind, dürfte es nur
wenige Kunstprodukte der gleichen
Art und von gleich hohem Alter
geben. Ein solcher Schatz gereicht
unserem Münster doppelt zur Zier,
da ihm auch rein künstlerische
Werte nicht abgehen.
Aber wo mag das Figürchen
entstanden sein? Es ist sehr zu
bedauern, dass hierüber sich nichts
mit Bestimmtheit feststellen lässt.
Nach dem bisher Gesagten und in
Erwägung der nahen Beziehung
Freiburgs zu Burgund, gehen wir
indes kaum fehl, wenn wir an
Frankreich denken oder ein unter
französischem Einfluss stehendes
Gebiet. Wir kennen eine deutsche
Skulptur, welche solch eigentüm-
liche Haartracht und solch eigen-
tümliche Gewandfältelung aufwiese,
außer der genannten Hildesheimer
nicht. Solch vornehmer Grazie und
solch technischer Vollkommenheit
war die deutsche Kunst in jener
Zeit schwerlich fähig3. Sollen wir
von den verschiedenen Möglich-
keiten, wie die Skulptur in unsere
Gegend gekommen sein mag, eine nennen, so ist es
diese: Seit dem Ende des 11. Jahrhunderts war zu
St. Ulrich im Breisgau eine Cluniazenserniederlas-
sung, die noch lange im Zusammenhang mit der bur-
gundischen Heimat blieb, und das 1158 gegründete
Zisterzienserkloster Tennenbach war eine Tochter-
gründung eines transjuranischen Klosters im Berner
3 Das Hildesheimer Bild kann in dieser Hinsicht zum Ver-
gleich nicht beigezogen werden, weil es 1664 „verbessert" wurde
und auch nicht angegeben werden kann, ob es deutsche oder
ausländische Arbeit ist.
Kempf, Ein romanisches holzgeschnitztes Madohnenfigürchen im Freiburger Münsterschatz
Enger begrenzt sich der zeitliche Spielraum,
wenn man die Kleidung und besonders die Haar-
tracht ins Auge fasst. Charakteristisch ist die enge
Fältelung des Gewandes der Madonna. Man trifft sie
(abgesehen von antiken Bildwerken der Frühzeit) in
der mittelalterlichen Kunst an Werken aus der Mitte
des 12. Jahrhunderts. Wir nennen hierzu Statuen
am Westportal der Kathedrale von Chartres1 und an
der Kathedrale von Le Mans2 sowie die bekannten
Königsfiguren von Corbeil (jetzt in St. Denis). Von
italienischen ähnlich bekleideten
Figuren liegen im Bereich unserer
Kenntnis einige Skulpturen an der
Fassade von S. Michele in Pavia;
aus Deutschland können wir die
„kleine goldene Madonna" des
Hildesheimer Domes anführen.
Viollet-le-Duc und W. Vöge be-
merken, dass es sich um ein
eigentümliches elastisches, gekrep-
tes Seidengewebe handelt. Die
Fältchen erstrecken sich von den
Hüften abwärts, während der Stoff
auf der Brust glatt anliegt. Eben-
so der genannten Zeit eigentüm-
lich ist die Haartracht, wie sie
unser Figürchen trägt: nämlich die
beiderseits über die Schultern vor-
geschlagenen langen Zöpfe. Viollet-
le-Duc gibt in seinem „Diction-
naire du mobilier français" als Zeit
für das Aufkommen dieser Mode
der vornehmen Damen 1130—1140
an. Wir bemerken sie z. B. an der
Madonnenstatue am Portal von
Chartres und an der Königinstatue
von Corbeil, die in die genannte
Zeit gesetzt werden; auch die er-
wähnte kleine Hildesheimer Sta-
tuette weist sie auf.
Wir können also mit Berufung
auf die Tracht, wie auf den all- Rückansicht
gemeinen Habitus als Entstehungs-
zeit unseres Bildwerks die Mitte des 12. Jahrhunderts
annehmen, brauchen es jedenfalls nicht viel weiter
Stellung von alten Marienbildern aus Deutschland und auch aus
Frankreich gibt Beissel in seiner Geschichte der Verehrung
Marias in Deutschland während des Mittelalters (Freiburg 1909),
S. 71 ff. und S. 157 ff. Davon kommen für uns, wenn auch nicht
als direkte Verwandte, eine Statue von Oberpleis bei Bonn
(Abb. 26) und die „kleine goldene Madonna" des Hildesheimer
Domes (Abb. 70) in Betracht.
1 Abbildung bei W. Vöge, Die Anfänge des monumentalen
Stiles im Mittelalter. Straßb. 1894.
- Abbildung bei A.Michel, Hist, de l'Art II, 1 (Paris 1906),
Nr. 89.
heraufzurücken. In den „Monatsheften für Kunst
Wissenschaft" 1908, Dezember, publiziert W.Vöge eine
Holzstatuette, deren Auffassung bereits etwas ins Go-
tische schlägt, und die er dem Ende des 12. Jahr-
hunderts zuspricht — wir gewinnen so auch auf
indirektem Wege eine Bekräftigung der Richtigkeit
unserer Zeitbestimmung. Die Hildesheimer Statuette
kann Beissel nicht engbegrenzt datieren: er nennt
das 12. und 13. Jahrhundert.
Ein gütiges Geschick hat uns, trotz der Ungunst
der Zeiten, trotz dem bescheidenen
Material und trotz der unansehn-
lichen Kleinheit, das Werkchen
durch mehr als sieben Jahrhunderte
unversehrt erhalten. Soweit wir
unterrichtet sind, dürfte es nur
wenige Kunstprodukte der gleichen
Art und von gleich hohem Alter
geben. Ein solcher Schatz gereicht
unserem Münster doppelt zur Zier,
da ihm auch rein künstlerische
Werte nicht abgehen.
Aber wo mag das Figürchen
entstanden sein? Es ist sehr zu
bedauern, dass hierüber sich nichts
mit Bestimmtheit feststellen lässt.
Nach dem bisher Gesagten und in
Erwägung der nahen Beziehung
Freiburgs zu Burgund, gehen wir
indes kaum fehl, wenn wir an
Frankreich denken oder ein unter
französischem Einfluss stehendes
Gebiet. Wir kennen eine deutsche
Skulptur, welche solch eigentüm-
liche Haartracht und solch eigen-
tümliche Gewandfältelung aufwiese,
außer der genannten Hildesheimer
nicht. Solch vornehmer Grazie und
solch technischer Vollkommenheit
war die deutsche Kunst in jener
Zeit schwerlich fähig3. Sollen wir
von den verschiedenen Möglich-
keiten, wie die Skulptur in unsere
Gegend gekommen sein mag, eine nennen, so ist es
diese: Seit dem Ende des 11. Jahrhunderts war zu
St. Ulrich im Breisgau eine Cluniazenserniederlas-
sung, die noch lange im Zusammenhang mit der bur-
gundischen Heimat blieb, und das 1158 gegründete
Zisterzienserkloster Tennenbach war eine Tochter-
gründung eines transjuranischen Klosters im Berner
3 Das Hildesheimer Bild kann in dieser Hinsicht zum Ver-
gleich nicht beigezogen werden, weil es 1664 „verbessert" wurde
und auch nicht angegeben werden kann, ob es deutsche oder
ausländische Arbeit ist.