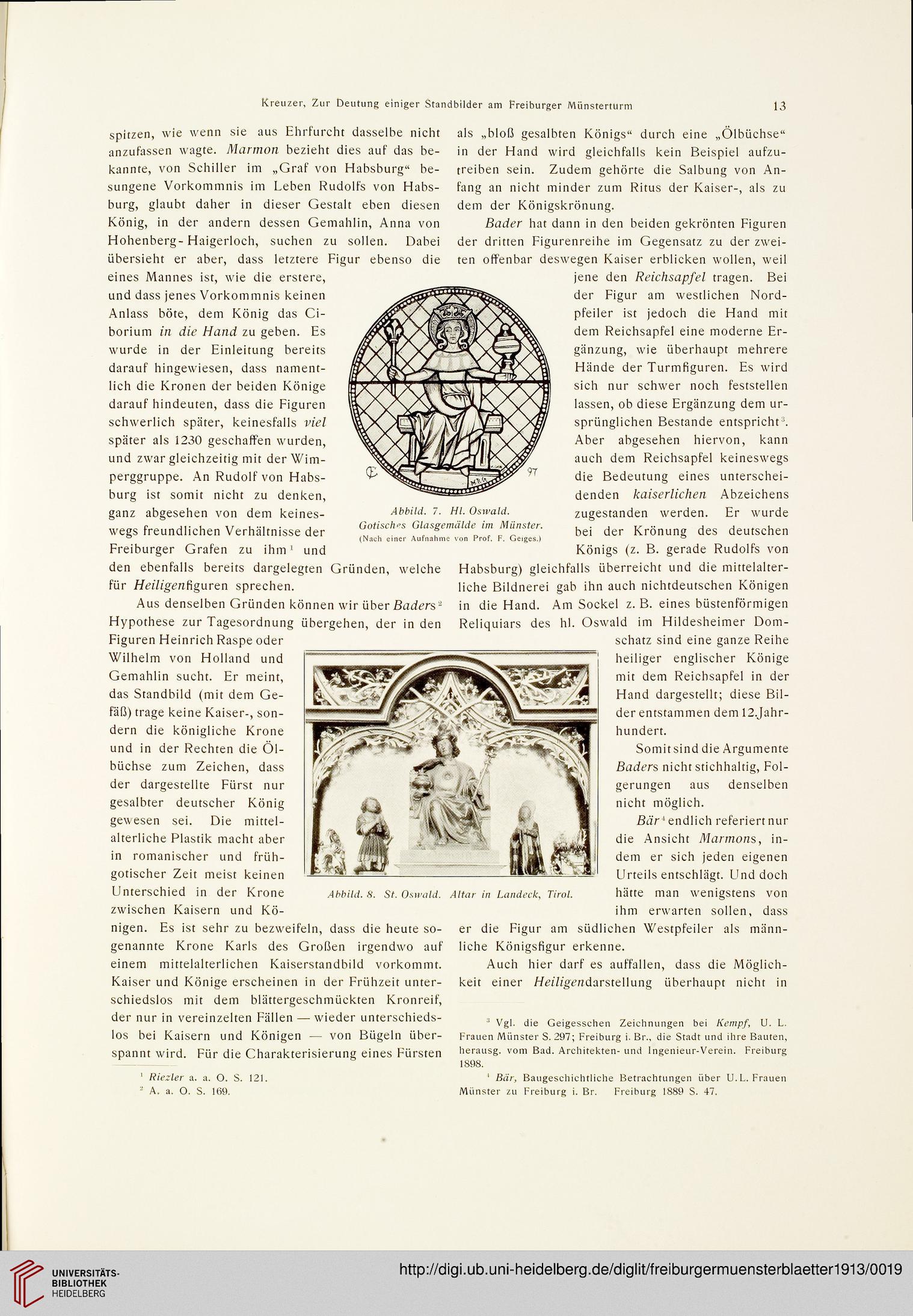Kreuzer, Zur Deutung einiger Standbilder am Preiburger Münsterturm
13
spitzen, wie wenn sie aus Ehrfurcht dasselbe nicht als „bloß gesalbten Königs" durch eine „Ölbüchse"
anzufassen wagte. Marmon bezieht dies auf das be- in der Hand wird gleichfalls kein Beispiel aufzu-
kannte, von Schiller im „Graf von Habsburg" be- treiben sein. Zudem gehörte die Salbung von An-
sungene Vorkommnis im Leben Rudolfs von Habs- fang an nicht minder zum Ritus der Kaiser-, als zu
bürg, glaubt daher in dieser Gestalt eben diesen dem der Königskrönung.
König, in der andern dessen Gemahlin, Anna von Bader hat dann in den beiden gekrönten Figuren
Hohenberg-Haigerloch, suchen zu sollen. Dabei der dritten Figurenreihe im Gegensatz zu der zwei-
übersieht er aber, dass letztere Figur ebenso die ten offenbar deswegen Kaiser erblicken wollen, weil
eines Mannes ist, wie die erstere,
und dass jenes Vorkommnis keinen
Anlass böte, dem König das Ci-
borium in die Hand zu geben. Es
wurde in der Einleitung bereits
darauf hingewiesen, dass nament-
lich die Kronen der beiden Könige
darauf hindeuten, dass die Figuren
schwerlich später, keinesfalls viel
später als 1230 geschaffen wurden,
und zwar gleichzeitig mit der Wim-
perggruppe. An Rudolf von Habs-
burg ist somit nicht zu denken,
ganz abgesehen von dem keines-
wegs freundlichen Verhältnisse der
Freiburger Grafen zu ihm1 und
Abbild. 7. Hl. Oswald.
Gotisches Glasgemälde im Münster.
(Nach einer Aufnahme von Prof. F. Geiges.)
jene den Reichsapfel tragen. Bei
der Figur am westlichen Nord-
pfeiler ist jedoch die Hand mit
dem Reichsapfel eine moderne Er-
gänzung, wie überhaupt mehrere
Hände der Turmfiguren. Es wird
sich nur schwer noch feststellen
lassen, ob diese Ergänzung dem ur-
sprünglichen Bestände entspricht3.
Aber abgesehen hiervon, kann
auch dem Reichsapfel keineswegs
die Bedeutung eines unterschei-
denden kaiserlichen Abzeichens
zugestanden werden. Er wurde
bei der Krönung des deutschen
Königs (z. B. gerade Rudolfs von
den ebenfalls bereits dargelegten Gründen, welche Habsburg) gleichfalls überreicht und die mittelalter-
für Heiligenfiguren sprechen. liehe Bildnerei gab ihn auch nichtdeutschen Königen
Aus denselben Gründen können wir über Baders2 in die Hand. Am Sockel z. B. eines büstenförmigen
Hypothese zur Tagesordnung übergehen, der in den Reliquiars des hl. Oswald im Hildesheimer Dom-
Figuren Heinrich Raspe oder
Wilhelm von Holland und
Gemahlin sucht. Er meint,
das Standbild (mit dem Ge-
fäß) trage keine Kaiser-, son-
dern die königliche Krone
und in der Rechten die Öl-
büchse zum Zeichen, dass
der dargestellte Fürst nur
gesalbter deutscher König
gewesen sei. Die mittel-
alterliche Plastik macht aber
in romanischer und früh-
gotischer Zeit meist keinen
Unterschied in der Krone
zwischen Kaisern und Kö-
nigen. Es ist sehr zu bezweifeln, dass die heute so-
genannte Krone Karls des Großen irgendwo auf
einem mittelalterlichen Kaiserstandbild vorkommt.
Kaiser und Könige erscheinen in der Frühzeit unter-
schiedslos mit dem blättergeschmückten Kronreif,
der nur in vereinzelten Fällen — wieder unterschieds-
los bei Kaisern und Königen — von Bügeln über-
spannt wird. Für die Charakterisierung eines Fürsten
1 Riezler a. a. O. S. 121.
- A. a. O. S. 169.
Abbild. S. St. Oswald. Altar in Landeck. Tirol
schätz sind eine ganze Reihe
heiliger englischer Könige
mit dem Reichsapfel in der
Hand dargestellt; diese Bil-
der entstammen dem ^.Jahr-
hundert.
Somitsind die Argumente
Baders nicht stichhaltig, Fol-
gerungen aus denselben
nicht möglich.
Bär1 endlich referiert nur
die Ansicht Marmons, in-
dem er sich jeden eigenen
Urteils entschlägt. Und doch
hätte man wenigstens von
ihm erwarten sollen, dass
er die Figur am südlichen Westpfeiler als männ-
liche Königsfigur erkenne.
Auch hier darf es auffallen, dass die Möglich-
keit einer HeiligendarsttUung überhaupt nicht in
:J Vgl. die Geigesschen Zeichnungen bei Kempf, U. L.
Frauen Münster S. 297; Freiburg i. Br., die Stadt und ihre Bauten,
herausg. vom Bad. Architekten- und Ingenieur-Verein. Freiburg
1898.
' Bär, Baugeschichtliche Betrachtungen über U.L.Frauen
Münster zu Freiburg i. Br. Freiburg 1889 S. 47.
13
spitzen, wie wenn sie aus Ehrfurcht dasselbe nicht als „bloß gesalbten Königs" durch eine „Ölbüchse"
anzufassen wagte. Marmon bezieht dies auf das be- in der Hand wird gleichfalls kein Beispiel aufzu-
kannte, von Schiller im „Graf von Habsburg" be- treiben sein. Zudem gehörte die Salbung von An-
sungene Vorkommnis im Leben Rudolfs von Habs- fang an nicht minder zum Ritus der Kaiser-, als zu
bürg, glaubt daher in dieser Gestalt eben diesen dem der Königskrönung.
König, in der andern dessen Gemahlin, Anna von Bader hat dann in den beiden gekrönten Figuren
Hohenberg-Haigerloch, suchen zu sollen. Dabei der dritten Figurenreihe im Gegensatz zu der zwei-
übersieht er aber, dass letztere Figur ebenso die ten offenbar deswegen Kaiser erblicken wollen, weil
eines Mannes ist, wie die erstere,
und dass jenes Vorkommnis keinen
Anlass böte, dem König das Ci-
borium in die Hand zu geben. Es
wurde in der Einleitung bereits
darauf hingewiesen, dass nament-
lich die Kronen der beiden Könige
darauf hindeuten, dass die Figuren
schwerlich später, keinesfalls viel
später als 1230 geschaffen wurden,
und zwar gleichzeitig mit der Wim-
perggruppe. An Rudolf von Habs-
burg ist somit nicht zu denken,
ganz abgesehen von dem keines-
wegs freundlichen Verhältnisse der
Freiburger Grafen zu ihm1 und
Abbild. 7. Hl. Oswald.
Gotisches Glasgemälde im Münster.
(Nach einer Aufnahme von Prof. F. Geiges.)
jene den Reichsapfel tragen. Bei
der Figur am westlichen Nord-
pfeiler ist jedoch die Hand mit
dem Reichsapfel eine moderne Er-
gänzung, wie überhaupt mehrere
Hände der Turmfiguren. Es wird
sich nur schwer noch feststellen
lassen, ob diese Ergänzung dem ur-
sprünglichen Bestände entspricht3.
Aber abgesehen hiervon, kann
auch dem Reichsapfel keineswegs
die Bedeutung eines unterschei-
denden kaiserlichen Abzeichens
zugestanden werden. Er wurde
bei der Krönung des deutschen
Königs (z. B. gerade Rudolfs von
den ebenfalls bereits dargelegten Gründen, welche Habsburg) gleichfalls überreicht und die mittelalter-
für Heiligenfiguren sprechen. liehe Bildnerei gab ihn auch nichtdeutschen Königen
Aus denselben Gründen können wir über Baders2 in die Hand. Am Sockel z. B. eines büstenförmigen
Hypothese zur Tagesordnung übergehen, der in den Reliquiars des hl. Oswald im Hildesheimer Dom-
Figuren Heinrich Raspe oder
Wilhelm von Holland und
Gemahlin sucht. Er meint,
das Standbild (mit dem Ge-
fäß) trage keine Kaiser-, son-
dern die königliche Krone
und in der Rechten die Öl-
büchse zum Zeichen, dass
der dargestellte Fürst nur
gesalbter deutscher König
gewesen sei. Die mittel-
alterliche Plastik macht aber
in romanischer und früh-
gotischer Zeit meist keinen
Unterschied in der Krone
zwischen Kaisern und Kö-
nigen. Es ist sehr zu bezweifeln, dass die heute so-
genannte Krone Karls des Großen irgendwo auf
einem mittelalterlichen Kaiserstandbild vorkommt.
Kaiser und Könige erscheinen in der Frühzeit unter-
schiedslos mit dem blättergeschmückten Kronreif,
der nur in vereinzelten Fällen — wieder unterschieds-
los bei Kaisern und Königen — von Bügeln über-
spannt wird. Für die Charakterisierung eines Fürsten
1 Riezler a. a. O. S. 121.
- A. a. O. S. 169.
Abbild. S. St. Oswald. Altar in Landeck. Tirol
schätz sind eine ganze Reihe
heiliger englischer Könige
mit dem Reichsapfel in der
Hand dargestellt; diese Bil-
der entstammen dem ^.Jahr-
hundert.
Somitsind die Argumente
Baders nicht stichhaltig, Fol-
gerungen aus denselben
nicht möglich.
Bär1 endlich referiert nur
die Ansicht Marmons, in-
dem er sich jeden eigenen
Urteils entschlägt. Und doch
hätte man wenigstens von
ihm erwarten sollen, dass
er die Figur am südlichen Westpfeiler als männ-
liche Königsfigur erkenne.
Auch hier darf es auffallen, dass die Möglich-
keit einer HeiligendarsttUung überhaupt nicht in
:J Vgl. die Geigesschen Zeichnungen bei Kempf, U. L.
Frauen Münster S. 297; Freiburg i. Br., die Stadt und ihre Bauten,
herausg. vom Bad. Architekten- und Ingenieur-Verein. Freiburg
1898.
' Bär, Baugeschichtliche Betrachtungen über U.L.Frauen
Münster zu Freiburg i. Br. Freiburg 1889 S. 47.