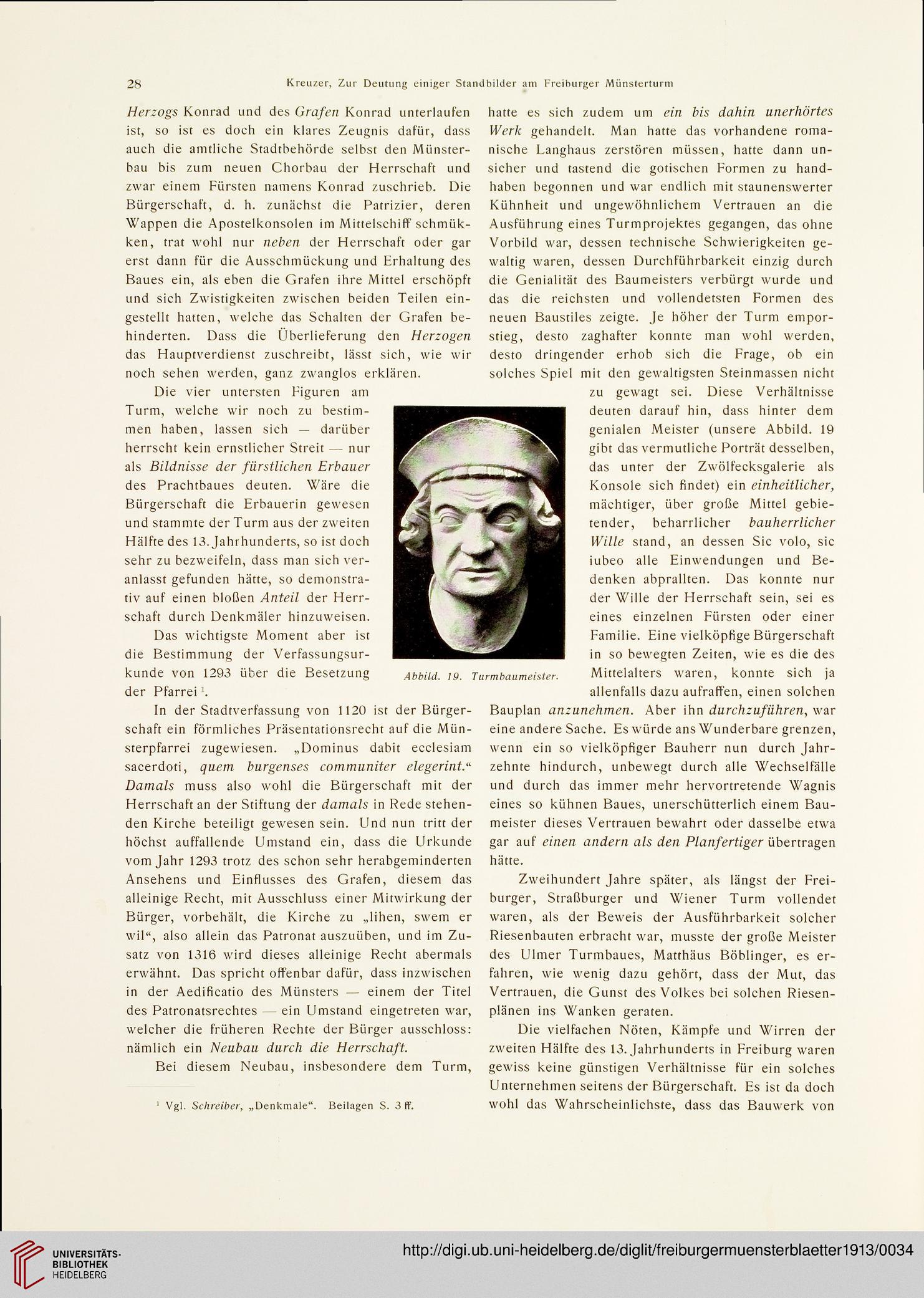28
Kreuzer, Zur Deutung einiger Standbilder am Freiburger Münsterturm
Herzogs Konrad und des Grafen Konrad unterlaufen
ist, so ist es doch ein klares Zeugnis dafür, dass
auch die amtliche Stadtbehörde selbst den Münster-
bau bis zum neuen Chorbau der Herrschaft und
zwar einem Fürsten namens Konrad zuschrieb. Die
Bürgerschaft, d. h. zunächst die Patrizier, deren
Wappen die Apostelkonsolen im Mittelschiff schmük-
ken, trat wohl nur neben der Herrschaft oder gar
erst dann für die Ausschmückung und Erhaltung des
Baues ein, als eben die Grafen ihre Mittel erschöpft
und sich Zwistigkeiten zwischen beiden Teilen ein-
gestellt hatten, welche das Schalten der Grafen be-
hinderten. Dass die Überlieferung den Herzogen
das Hauptverdienst zuschreibt, lässt sich, wie wir
noch sehen werden, ganz zwanglos erklären.
Die vier untersten Figuren am
Turm, welche wir noch zu bestim-
men haben, lassen sich - - darüber
herrscht kein ernstlicher Streit — nur
als Bildnisse der fürstlichen Erbauer
des Prachtbaues deuten. Wäre die
Bürgerschaft die Erbauerin gewesen
und stammte der Turm aus der zweiten
Hälfte des 13. Jahrhunderts, so ist doch
sehr zu bezweifeln, dass man sich ver-
anlasst gefunden hätte, so demonstra-
tiv auf einen bloßen Anteil der Herr-
schaft durch Denkmäler hinzuweisen.
Das wichtigste Moment aber ist
die Bestimmung der Verfassungsur-
kunde von 1293 über die Besetzung
der Pfarrei '.
In der Stadtverfassung von 1120 ist der Bürger-
schaft ein förmliches Präsentationsrecht auf die Mün-
sterpfarrei zugewiesen. „Dominus dabit ecclesiam
sacerdoti, quem burgenses communiter elegerint."
Damals muss also wohl die Bürgerschaft mit der
Herrschaft an der Stiftung der damals in Rede stehen-
den Kirche beteiligt gewesen sein. Und nun tritt der
höchst auffallende Umstand ein, dass die Urkunde
vom Jahr 1293 trotz des schon sehr herabgeminderten
Ansehens und Einflusses des Grafen, diesem das
alleinige Recht, mit Ausschluss einer Mitwirkung der
Bürger, vorbehält, die Kirche zu „lihen, swem er
wil", also allein das Patronat auszuüben, und im Zu-
satz von 1316 wird dieses alleinige Recht abermals
erwähnt. Das spricht offenbar dafür, dass inzwischen
in der Aedificatio des Münsters — einem der Titel
des Patronatsrechtes — ein Umstand eingetreten war,
welcher die früheren Rechte der Bürger ausschloss:
nämlich ein Neubau durch die Herrschaft.
Bei diesem Neubau, insbesondere dem Turm,
1 Vgl. Schreiber, „Denkmale". Beilagen S. 3 ff.
Abbild. 19. Turmbaumeister
hatte es sich zudem um ein bis dahin unerhörtes
Werk gehandelt. Man hatte das vorhandene roma-
nische Langhaus zerstören müssen, hatte dann un-
sicher und tastend die gotischen Formen zu hand-
haben begonnen und war endlich mit staunenswerter
Kühnheit und ungewöhnlichem Vertrauen an die
Ausführung eines Turmprojektes gegangen, das ohne
Vorbild war, dessen technische Schwierigkeiten ge-
waltig waren, dessen Durchführbarkeit einzig durch
die Genialität des Baumeisters verbürgt wurde und
das die reichsten und vollendetsten Formen des
neuen Baustiles zeigte. Je höher der Turm empor-
stieg, desto zaghafter konnte man wohl werden,
desto dringender erhob sich die Frage, ob ein
solches Spiel mit den gewaltigsten Steinmassen nicht
zu gewagt sei. Diese Verhältnisse
deuten darauf hin, dass hinter dem
genialen Meister (unsere Abbild. 19
gibt das vermutliche Porträt desselben,
das unter der Zwölfecksgalerie als
Konsole sich findet) ein einheitlicher,
mächtiger, über große Mittel gebie-
tender, beharrlicher bauherrlicher
Wille stand, an dessen Sic volo, sic
iubeo alle Einwendungen und Be-
denken abprallten. Das konnte nur
der Wille der Herrschaft sein, sei es
eines einzelnen Fürsten oder einer
Familie. Eine vielköpfige Bürgerschaft
in so bewegten Zeiten, wie es die des
Mittelalters waren, konnte sich ja
allenfalls dazu aufraffen, einen solchen
Bauplan anzunehmen. Aber ihn durchzuführen, war
eine andere Sache. Es würde ans Wunderbare grenzen,
wenn ein so vielköpfiger Bauherr nun durch Jahr-
zehnte hindurch, unbewegt durch alle Wechselfälle
und durch das immer mehr hervortretende Wagnis
eines so kühnen Baues, unerschütterlich einem Bau-
meister dieses Vertrauen bewahrt oder dasselbe etwa
gar auf einen andern als den Planfertiger übertragen
hätte.
Zweihundert Jahre später, als längst der Frei-
burger, Straßburger und Wiener Turm vollendet
waren, als der Beweis der Ausführbarkeit solcher
Riesenbauten erbracht war, musste der große Meister
des Ulmer Turmbaues, Matthäus Böblinger, es er-
fahren, wie wenig dazu gehört, dass der Mut, das
Vertrauen, die Gunst des Volkes bei solchen Riesen-
plänen ins Wanken geraten.
Die vielfachen Nöten, Kämpfe und Wirren der
zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts in Freiburg waren
gewiss keine günstigen Verhältnisse für ein solches
Unternehmen seitens der Bürgerschaft. Es ist da doch
wohl das Wahrscheinlichste, dass das Bauwerk von
Kreuzer, Zur Deutung einiger Standbilder am Freiburger Münsterturm
Herzogs Konrad und des Grafen Konrad unterlaufen
ist, so ist es doch ein klares Zeugnis dafür, dass
auch die amtliche Stadtbehörde selbst den Münster-
bau bis zum neuen Chorbau der Herrschaft und
zwar einem Fürsten namens Konrad zuschrieb. Die
Bürgerschaft, d. h. zunächst die Patrizier, deren
Wappen die Apostelkonsolen im Mittelschiff schmük-
ken, trat wohl nur neben der Herrschaft oder gar
erst dann für die Ausschmückung und Erhaltung des
Baues ein, als eben die Grafen ihre Mittel erschöpft
und sich Zwistigkeiten zwischen beiden Teilen ein-
gestellt hatten, welche das Schalten der Grafen be-
hinderten. Dass die Überlieferung den Herzogen
das Hauptverdienst zuschreibt, lässt sich, wie wir
noch sehen werden, ganz zwanglos erklären.
Die vier untersten Figuren am
Turm, welche wir noch zu bestim-
men haben, lassen sich - - darüber
herrscht kein ernstlicher Streit — nur
als Bildnisse der fürstlichen Erbauer
des Prachtbaues deuten. Wäre die
Bürgerschaft die Erbauerin gewesen
und stammte der Turm aus der zweiten
Hälfte des 13. Jahrhunderts, so ist doch
sehr zu bezweifeln, dass man sich ver-
anlasst gefunden hätte, so demonstra-
tiv auf einen bloßen Anteil der Herr-
schaft durch Denkmäler hinzuweisen.
Das wichtigste Moment aber ist
die Bestimmung der Verfassungsur-
kunde von 1293 über die Besetzung
der Pfarrei '.
In der Stadtverfassung von 1120 ist der Bürger-
schaft ein förmliches Präsentationsrecht auf die Mün-
sterpfarrei zugewiesen. „Dominus dabit ecclesiam
sacerdoti, quem burgenses communiter elegerint."
Damals muss also wohl die Bürgerschaft mit der
Herrschaft an der Stiftung der damals in Rede stehen-
den Kirche beteiligt gewesen sein. Und nun tritt der
höchst auffallende Umstand ein, dass die Urkunde
vom Jahr 1293 trotz des schon sehr herabgeminderten
Ansehens und Einflusses des Grafen, diesem das
alleinige Recht, mit Ausschluss einer Mitwirkung der
Bürger, vorbehält, die Kirche zu „lihen, swem er
wil", also allein das Patronat auszuüben, und im Zu-
satz von 1316 wird dieses alleinige Recht abermals
erwähnt. Das spricht offenbar dafür, dass inzwischen
in der Aedificatio des Münsters — einem der Titel
des Patronatsrechtes — ein Umstand eingetreten war,
welcher die früheren Rechte der Bürger ausschloss:
nämlich ein Neubau durch die Herrschaft.
Bei diesem Neubau, insbesondere dem Turm,
1 Vgl. Schreiber, „Denkmale". Beilagen S. 3 ff.
Abbild. 19. Turmbaumeister
hatte es sich zudem um ein bis dahin unerhörtes
Werk gehandelt. Man hatte das vorhandene roma-
nische Langhaus zerstören müssen, hatte dann un-
sicher und tastend die gotischen Formen zu hand-
haben begonnen und war endlich mit staunenswerter
Kühnheit und ungewöhnlichem Vertrauen an die
Ausführung eines Turmprojektes gegangen, das ohne
Vorbild war, dessen technische Schwierigkeiten ge-
waltig waren, dessen Durchführbarkeit einzig durch
die Genialität des Baumeisters verbürgt wurde und
das die reichsten und vollendetsten Formen des
neuen Baustiles zeigte. Je höher der Turm empor-
stieg, desto zaghafter konnte man wohl werden,
desto dringender erhob sich die Frage, ob ein
solches Spiel mit den gewaltigsten Steinmassen nicht
zu gewagt sei. Diese Verhältnisse
deuten darauf hin, dass hinter dem
genialen Meister (unsere Abbild. 19
gibt das vermutliche Porträt desselben,
das unter der Zwölfecksgalerie als
Konsole sich findet) ein einheitlicher,
mächtiger, über große Mittel gebie-
tender, beharrlicher bauherrlicher
Wille stand, an dessen Sic volo, sic
iubeo alle Einwendungen und Be-
denken abprallten. Das konnte nur
der Wille der Herrschaft sein, sei es
eines einzelnen Fürsten oder einer
Familie. Eine vielköpfige Bürgerschaft
in so bewegten Zeiten, wie es die des
Mittelalters waren, konnte sich ja
allenfalls dazu aufraffen, einen solchen
Bauplan anzunehmen. Aber ihn durchzuführen, war
eine andere Sache. Es würde ans Wunderbare grenzen,
wenn ein so vielköpfiger Bauherr nun durch Jahr-
zehnte hindurch, unbewegt durch alle Wechselfälle
und durch das immer mehr hervortretende Wagnis
eines so kühnen Baues, unerschütterlich einem Bau-
meister dieses Vertrauen bewahrt oder dasselbe etwa
gar auf einen andern als den Planfertiger übertragen
hätte.
Zweihundert Jahre später, als längst der Frei-
burger, Straßburger und Wiener Turm vollendet
waren, als der Beweis der Ausführbarkeit solcher
Riesenbauten erbracht war, musste der große Meister
des Ulmer Turmbaues, Matthäus Böblinger, es er-
fahren, wie wenig dazu gehört, dass der Mut, das
Vertrauen, die Gunst des Volkes bei solchen Riesen-
plänen ins Wanken geraten.
Die vielfachen Nöten, Kämpfe und Wirren der
zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts in Freiburg waren
gewiss keine günstigen Verhältnisse für ein solches
Unternehmen seitens der Bürgerschaft. Es ist da doch
wohl das Wahrscheinlichste, dass das Bauwerk von