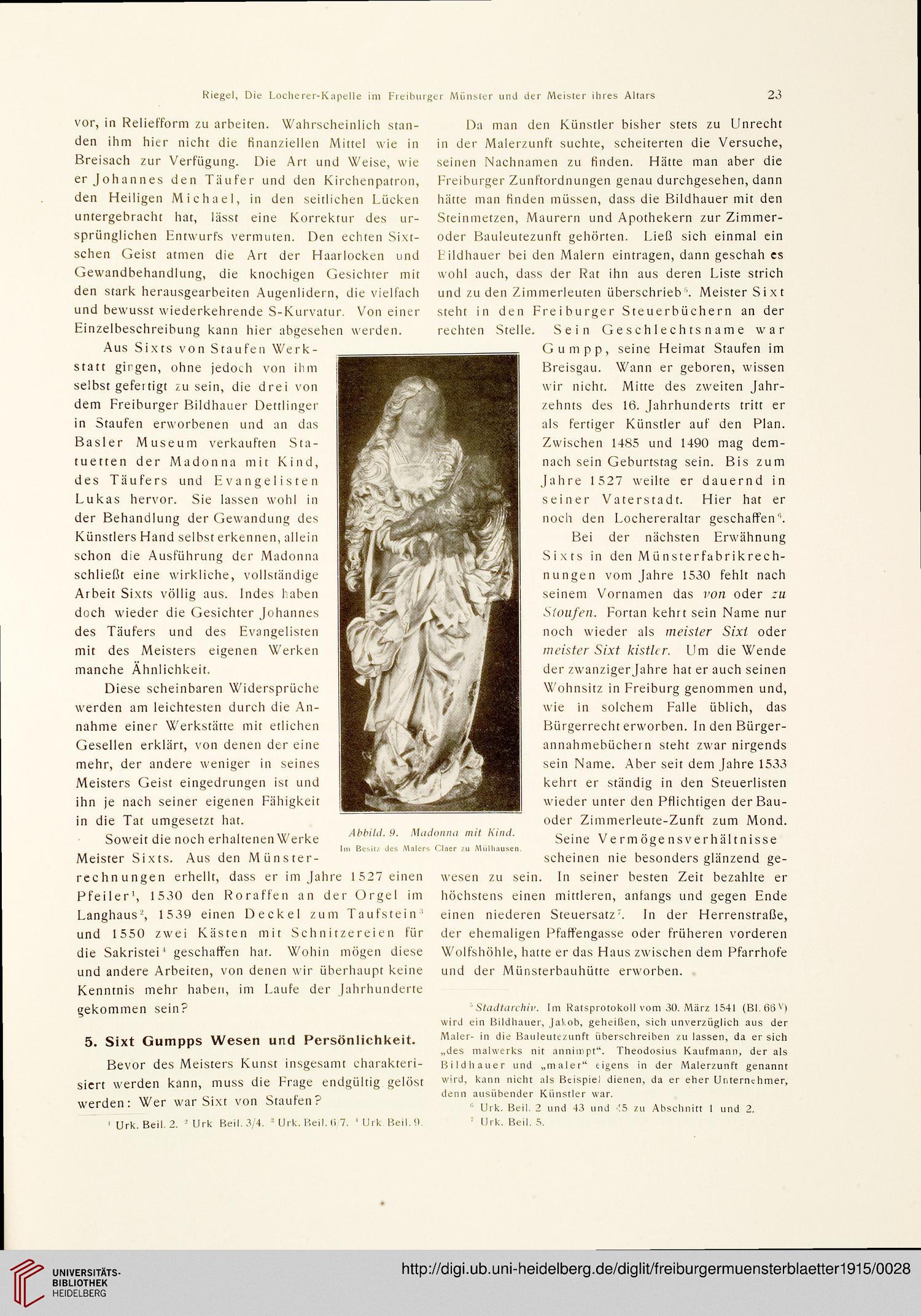Riegel, Die Locherer-Kapelle im Freiburger Münster und der Meister ihres Altars 23
vor, in Reliefform zu arbeiten. Wahrscheinlich stan- Da man den Künstler bisher stets zu Unrecht
den ihm hier nicht die finanziellen Mittel wie in in der Malerzunft suchte, scheiterten die Versuche,
Breisach zur Verfügung. Die Art und Weise, wie seinen Nachnamen zu finden. Hätte man aber die
er Johannes den Täufer und den Kirchenpatron, Freiburger Zunftordnungen genau durchgesehen, dann
den Heiligen Michael, in den seitlichen Lücken hätte man finden müssen, dass die Bildhauer mit den
untergebracht hat, lässt eine Korrektur des ur-
sprünglichen Entwurfs vermuten. Den echten Sixt-
schen Geist atmen die Art der Haarlocken und
Gewandbehandlung, die knochigen Gesichter mit
den stark herausgearbeiten Augenlidern, die vielfach
und bewusst wiederkehrende S-Kurvatur. Von einer
Einzelbeschreibung kann hier abgesehen werden.
Aus Sixts von Staufen Werk-
statt gingen, ohne jedoch von ihm
selbst gefertigt zusein, die drei von
dem Freiburger Bildhauer Dettlinger
in Staufen erworbenen und an das
Basler Museum verkauften Sta-
tuetten der Madonna mit Kind,
des Täufers und Evangelisten
Lukas hervor. Sie lassen wohl in
der Behandlung der Gewandung des
Künstlers Hand selbst erkennen, allein
schon die Ausführung der Madonna
schließt eine wirkliche, vollständige
Arbeit Sixts völlig aus. Indes haben
doch wieder die Gesichter Johannes
des Täufers und des Evangelisten
mit des Meisters eigenen Werken
manche Ähnlichkeit.
Diese scheinbaren Widersprüche
werden am leichtesten durch die An-
nahme einer Werkstätte mit etlichen
Gesellen erklärt, von denen der eine
mehr, der andere weniger in seines
Meisters Geist eingedrungen ist und
ihn je nach seiner eigenen Fähigkeit
in die Tat umgesetzt hat.
Soweit die noch erhaltenen Werke
Meister Sixts. Aus den Münster-
rechnungen erhellt, dass er im Jahre 1527 einen
Pfeiler1, 1530 den Roraffen an der Orgel im
Langhaus", 1539 einen Deckel zum Taufstein1
und 1550 zwei Kästen mit Schnitzereien für
die Sakristei4 geschaffen hat. Wohin mögen diese
und andere Arbeiten, von denen wir überhaupt keine
Kenntnis mehr haben, im Laufe der Jahrhunderte
gekommen sein?
5. Sixt Gumpps Wesen und Persönlichkeit.
Bevor des Meisters Kunst insgesamt charakteri-
siert werden kann, muss die Frage endgültig gelöst
werden: Wer war Sixt von Staufen?
1 Urk. Beil. 2. 'Urk Beil. 3/4. :! Urk. Beil. (i 7. ' Urk Beil. 9.
Steinmetzen, Maurern und Apothekern zur Zimmer-
oder Bauleutezunft gehörten. Ließ sich einmal ein
Eildhauer bei den Malern eintragen, dann geschah es
wohl auch, dass der Rat ihn aus deren Liste strich
und zu den Zimmerleuten überschrieb \ Meister Sixt
steht in den Freiburger Steuerbüchern an der
rechten Stelle. Sein Geschlechtsname war
Gumpp, seine Heimat Staufen im
Breisgau. Wann er geboren, wissen
wir nicht. Mitte des zweiten Jahr-
zehnts des 16. Jahrhunderts tritt er
als fertiger Künstler auf den Plan.
Zwischen 1485 und 1490 mag dem-
nach sein Geburtstag sein. Bis zum
Jahre 1527 weilte er dauernd in
seiner Vaterstadt. Hier hat er
noch den Lochereraltar geschaffen",
Bei der nächsten Erwähnung
Sixts in den Münsterfabrikrech-
nungen vom Jahre 1530 fehlt nach
seinem Vornamen das von oder zu
Sioufen. Fortan kehrt sein Name nur
noch wieder als meisier Sixt oder
meister Sixt kistler. Um die Wende
der zwanziger Jahre hat er auch seinen
Wohnsitz in Freiburg genommen und,
wie in solchem Falle üblich, das
Bürgerrecht erworben. In den Bürger-
annahmebüchern steht zwar nirgends
sein Name. Aber seit dem Jahre 1533
kehrt er ständig in den Steuerlisten
wieder unter den Pflichtigen der Bau-
oder Zimmerleute-Zunft zum Mond.
Seine Vermögensverhältnisse
scheinen nie besonders glänzend ge-
wesen zu sein. In seiner besten Zeit bezahlte er
höchstens einen mittleren, anfangs und gegen Ende
einen niederen Steuersatz7. In der Herrenstraße,
der ehemaligen Pfaffengasse oder früheren vorderen
Wolfshöhle, hatte er das Haus zwischen dem Pfarrhofe
und der Münsterbauhütte erworben.
5 Stadtarchiv. Im Ratsprotokoll vom 30. März 1541 (Bl, 66 v)
wird ein Bildhauer, Jakob, geheißen, sich unverzüglich aus der
Maler- in die Bauleutezunft überschreiben zu lassen, da er sich
„des malwerks nit annimpt". Theodosius Kaufmann, der als
Bildhauer und „maier" tigens in der Malerzunft genannt
wird, kann nicht als Beispiel dienen, da er eher Unternehmer,
denn ausübender Künstler war.
'' Urk. Beil, 2 und 43 und !5 zu Abschnitt 1 und 2.
7 Urk. Beil. 5.
Abbild. 9. Madonna mit Kind.
n Besitz des Malers Ciaer zu Mülhausen
vor, in Reliefform zu arbeiten. Wahrscheinlich stan- Da man den Künstler bisher stets zu Unrecht
den ihm hier nicht die finanziellen Mittel wie in in der Malerzunft suchte, scheiterten die Versuche,
Breisach zur Verfügung. Die Art und Weise, wie seinen Nachnamen zu finden. Hätte man aber die
er Johannes den Täufer und den Kirchenpatron, Freiburger Zunftordnungen genau durchgesehen, dann
den Heiligen Michael, in den seitlichen Lücken hätte man finden müssen, dass die Bildhauer mit den
untergebracht hat, lässt eine Korrektur des ur-
sprünglichen Entwurfs vermuten. Den echten Sixt-
schen Geist atmen die Art der Haarlocken und
Gewandbehandlung, die knochigen Gesichter mit
den stark herausgearbeiten Augenlidern, die vielfach
und bewusst wiederkehrende S-Kurvatur. Von einer
Einzelbeschreibung kann hier abgesehen werden.
Aus Sixts von Staufen Werk-
statt gingen, ohne jedoch von ihm
selbst gefertigt zusein, die drei von
dem Freiburger Bildhauer Dettlinger
in Staufen erworbenen und an das
Basler Museum verkauften Sta-
tuetten der Madonna mit Kind,
des Täufers und Evangelisten
Lukas hervor. Sie lassen wohl in
der Behandlung der Gewandung des
Künstlers Hand selbst erkennen, allein
schon die Ausführung der Madonna
schließt eine wirkliche, vollständige
Arbeit Sixts völlig aus. Indes haben
doch wieder die Gesichter Johannes
des Täufers und des Evangelisten
mit des Meisters eigenen Werken
manche Ähnlichkeit.
Diese scheinbaren Widersprüche
werden am leichtesten durch die An-
nahme einer Werkstätte mit etlichen
Gesellen erklärt, von denen der eine
mehr, der andere weniger in seines
Meisters Geist eingedrungen ist und
ihn je nach seiner eigenen Fähigkeit
in die Tat umgesetzt hat.
Soweit die noch erhaltenen Werke
Meister Sixts. Aus den Münster-
rechnungen erhellt, dass er im Jahre 1527 einen
Pfeiler1, 1530 den Roraffen an der Orgel im
Langhaus", 1539 einen Deckel zum Taufstein1
und 1550 zwei Kästen mit Schnitzereien für
die Sakristei4 geschaffen hat. Wohin mögen diese
und andere Arbeiten, von denen wir überhaupt keine
Kenntnis mehr haben, im Laufe der Jahrhunderte
gekommen sein?
5. Sixt Gumpps Wesen und Persönlichkeit.
Bevor des Meisters Kunst insgesamt charakteri-
siert werden kann, muss die Frage endgültig gelöst
werden: Wer war Sixt von Staufen?
1 Urk. Beil. 2. 'Urk Beil. 3/4. :! Urk. Beil. (i 7. ' Urk Beil. 9.
Steinmetzen, Maurern und Apothekern zur Zimmer-
oder Bauleutezunft gehörten. Ließ sich einmal ein
Eildhauer bei den Malern eintragen, dann geschah es
wohl auch, dass der Rat ihn aus deren Liste strich
und zu den Zimmerleuten überschrieb \ Meister Sixt
steht in den Freiburger Steuerbüchern an der
rechten Stelle. Sein Geschlechtsname war
Gumpp, seine Heimat Staufen im
Breisgau. Wann er geboren, wissen
wir nicht. Mitte des zweiten Jahr-
zehnts des 16. Jahrhunderts tritt er
als fertiger Künstler auf den Plan.
Zwischen 1485 und 1490 mag dem-
nach sein Geburtstag sein. Bis zum
Jahre 1527 weilte er dauernd in
seiner Vaterstadt. Hier hat er
noch den Lochereraltar geschaffen",
Bei der nächsten Erwähnung
Sixts in den Münsterfabrikrech-
nungen vom Jahre 1530 fehlt nach
seinem Vornamen das von oder zu
Sioufen. Fortan kehrt sein Name nur
noch wieder als meisier Sixt oder
meister Sixt kistler. Um die Wende
der zwanziger Jahre hat er auch seinen
Wohnsitz in Freiburg genommen und,
wie in solchem Falle üblich, das
Bürgerrecht erworben. In den Bürger-
annahmebüchern steht zwar nirgends
sein Name. Aber seit dem Jahre 1533
kehrt er ständig in den Steuerlisten
wieder unter den Pflichtigen der Bau-
oder Zimmerleute-Zunft zum Mond.
Seine Vermögensverhältnisse
scheinen nie besonders glänzend ge-
wesen zu sein. In seiner besten Zeit bezahlte er
höchstens einen mittleren, anfangs und gegen Ende
einen niederen Steuersatz7. In der Herrenstraße,
der ehemaligen Pfaffengasse oder früheren vorderen
Wolfshöhle, hatte er das Haus zwischen dem Pfarrhofe
und der Münsterbauhütte erworben.
5 Stadtarchiv. Im Ratsprotokoll vom 30. März 1541 (Bl, 66 v)
wird ein Bildhauer, Jakob, geheißen, sich unverzüglich aus der
Maler- in die Bauleutezunft überschreiben zu lassen, da er sich
„des malwerks nit annimpt". Theodosius Kaufmann, der als
Bildhauer und „maier" tigens in der Malerzunft genannt
wird, kann nicht als Beispiel dienen, da er eher Unternehmer,
denn ausübender Künstler war.
'' Urk. Beil, 2 und 43 und !5 zu Abschnitt 1 und 2.
7 Urk. Beil. 5.
Abbild. 9. Madonna mit Kind.
n Besitz des Malers Ciaer zu Mülhausen