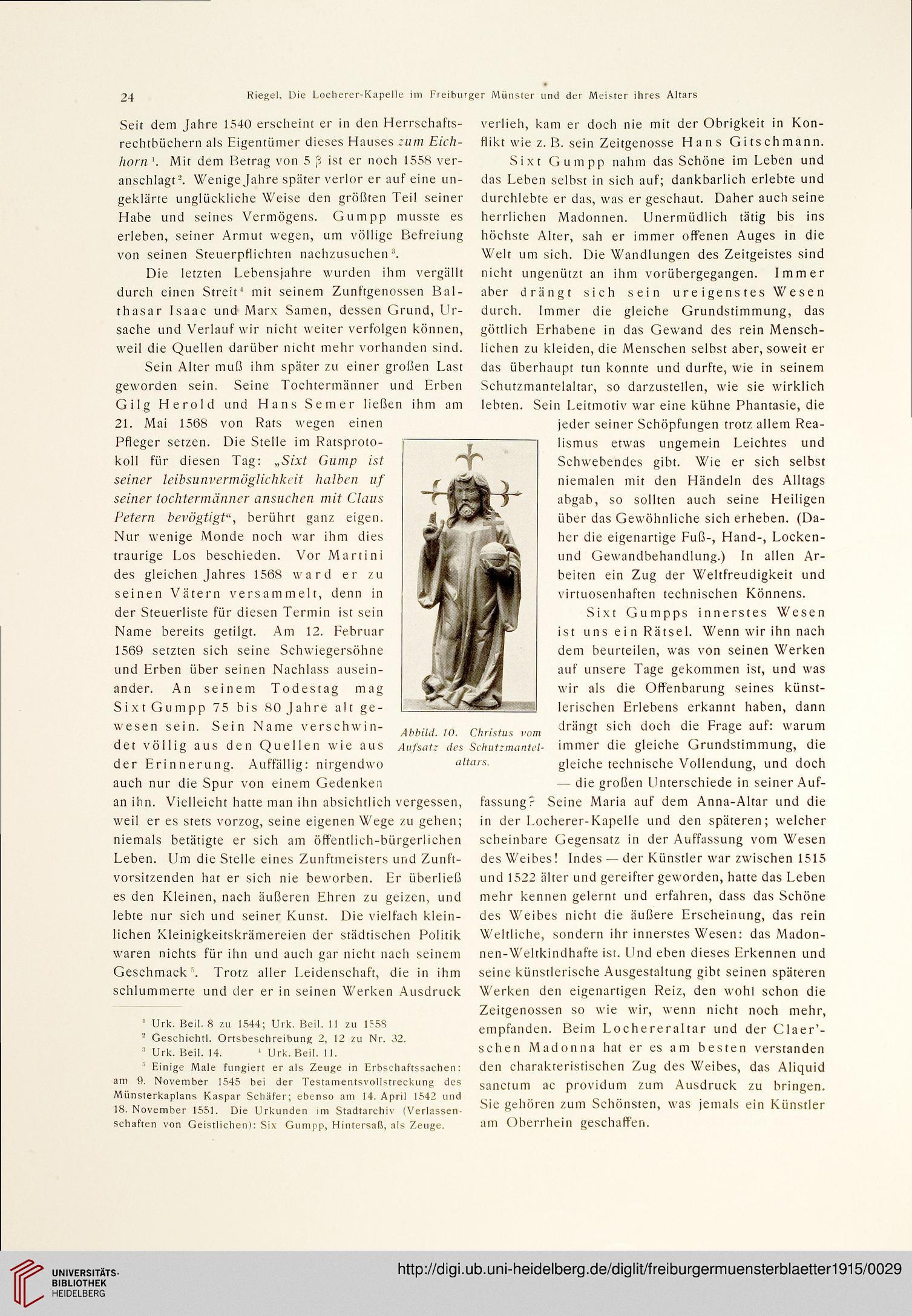24
Riegel, Die Locherer-Kapelle im Freiburger Münster und der Meister ihres Altars
Seit dem Jahre 1540 erscheint er in den Herrschafts- verlieh, kam er doch nie mit der Obrigkeit in Kon-
rech tbüchern als Eigentümer dieses Hauses zum Eich- flikt wie z. B. sein Zeitgenosse Hans Gitschmann.
hörn'. Mit dem Betrag von 5 ,r-s ist er noch 1558 ver- Sixt Gumpp nahm das Schöne im Leben und
anschlagt'. Wenige Jahre später verlor er auf eine un- das Leben selbst in sich auf; dankbarlich erlebte und
geklärte unglückliche Weise den größten Teil seiner durchlebte er das, was er geschaut. Daher auch seine
Habe und seines Vermögens. Gumpp musste es herrlichen Madonnen. Unermüdlich tätig bis ins
erleben, seiner Armut wegen, um völlige Befreiung höchste Alter, sah er immer offenen Auges in die
von seinen Steuerpflichten nachzusuchen3. Welt um sich. Die Wandlungen des Zeitgeistes sind
Die letzten Lebensjahre wurden ihm vergällt nicht ungenützt an ihm vorübergegangen. Immer
durch einen Streit4 mit seinem Zunftgenossen Bai- aber drängt sich sein ureigenstes Wesen
thasar Isaac und Marx Samen, dessen Grund, Ur- durch. Immer die gleiche Grundstimmung, das
sache und Verlauf wir nicht weiter verfolgen können, göttlich Erhabene in das Gewand des rein Mensch-
weil die Quellen darüber nicht mehr vorhanden sind, liehen zu kleiden, die Menschen selbst aber, soweit er
Sein Alter muß ihm später zu einer großen Last das überhaupt tun konnte und durfte, wie in seinem
geworden sein. Seine Tochtermänner und Erben Schutzmantelaltar, so darzustellen, wie sie wirklich
Gilg Herold und Hans Semer ließen ihm am lebten. Sein Leitmotiv war eine kühne Phantasie, die
21. Mai 1568 von Rats wegen einen
Pfleger setzen. Die Stelle im Ratsproto-
koll für diesen Tag: „Sixt Gump ist
seiner leibsunvermöglichkcit halben uf
seiner iochtermänner ansuchen mit Claus
Petern bevögtigt", berührt ganz eigen.
Nur wenige Monde noch war ihm dies
traurige Los beschieden. Vor Martini
des gleichen Jahres 1568 ward er zu
seinen Vätern versammelt, denn in
der Steuerliste für diesen Termin ist sein
Name bereits getilgt. Am 12. Februar
1569 setzten sich seine Schwiegersöhne
und Erben über seinen Nachlass ausein-
ander. An seinem Todestag mag
Sixt Gumpp 75 bis 80 Jahre alt ge-
wesen sein. Sein Name verschwin- Abbiut 1(h Christus vom
det völlig aus den Quellen wie aus Aufsatz des Schutzmantel-
der Erinnerung. Auffällig: nirgendwo
auch nur die Spur von einem Gedenken
altars.
jeder seiner Schöpfungen trotz allem Rea-
lismus etwas ungemein Leichtes und
Schwebendes gibt. Wie er sich selbst
niemalen mit den Händeln des Alltags
abgab, so sollten auch seine Heiligen
über das Gewöhnliche sich erheben. (Da-
her die eigenartige Fuß-, Hand-, Locken-
und Gewandbehandlung.) In allen Ar-
beiten ein Zug der Weltfreudigkeit und
virtuosenhaften technischen Könnens.
Sixt Gumpps innerstes Wesen
ist uns ein Rätsel. Wenn wir ihn nach
dem beurteilen, was von seinen Werken
auf unsere Tage gekommen ist, und was
wir als die Offenbarung seines künst-
lerischen Erlebens erkannt haben, dann
drängt sich doch die Frage auf: warum
immer die gleiche Grundstimmung, die
gleiche technische Vollendung, und doch
— die großen Unterschiede in seiner Auf-
an ihn. Vielleicht hatte man ihn absichtlich vergessen, fassung? Seine Maria auf dem Anna-Altar und die
weil er es stets vorzog, seine eigenen Wege zu gehen; in der Locherer-Kapelle und den späteren; welcher
niemals betätigte er sich am öffentlich-bürgerlichen
Leben. Um die Stelle eines Zunftmeisters und Zunft-
vorsitzenden hat er sich nie beworben. Er überließ
es den Kleinen, nach äußeren Ehren zu geizen, und
lebte nur sich und seiner Kunst. Die vielfach klein-
lichen Kleinigkeitskrämereien der städtischen Politik
waren nichts für ihn und auch gar nicht nach seinem
scheinbare Gegensatz in der Auffassung vom Wesen
des Weibes! Indes — der Künstler war zwischen 1515
und 1522 älter und gereifter geworden, hatte das Leben
mehr kennen gelernt und erfahren, dass das Schöne
des Weibes nicht die äußere Erscheinung, das rein
Weltliche, sondern ihr innerstes Wesen: das Madon-
nen-Weltkindhafte ist. Lind eben dieses Erkennen und
Geschmack5. Trotz aller Leidenschaft, die in ihm seine künstlerische Ausgestaltung gibt seinen späteren
schlummerte und der er in seinen Werken Ausdruck Werken den eigenartigen Reiz, den wohl schon die
Zeitgenossen so wie wir, wenn nicht noch mehr,
' Urk. Beil. 8 zu 1544; Utk. Beil. 11 zu i?58 empfanden. Beim Lochereraltar und der Claer'-
- Geschichtl. Ortsbeschreibung 2, 12 zu Nr. 32.
' Urk. Beil. 14. 'Urk.Beil. ii. sehen Madonna hat er es am besten verstanden
5 Einige Male fungiert er als Zeuge in Erbschaftssachen: den charakteristischen Zug des Weibes, das Aliquid
am 9. November 1545 bei der Testamentsvollstreckung des sanctum ac providum zum Ausdruck ZU bringen.
Munsterkaplans Kaspar Schäfer; ebenso am 14. April 1542 und , .. _ , .. .
18. November 1551. Die Urkunden im Stadtarchiv (Verlassen- S.e gehören zum Schönsten, was jemals ein Künstler
schaffen von Geistlichen): Six Gumpp, Hintersaß, als Zeuge. am Oberrhein geschaffen.
Riegel, Die Locherer-Kapelle im Freiburger Münster und der Meister ihres Altars
Seit dem Jahre 1540 erscheint er in den Herrschafts- verlieh, kam er doch nie mit der Obrigkeit in Kon-
rech tbüchern als Eigentümer dieses Hauses zum Eich- flikt wie z. B. sein Zeitgenosse Hans Gitschmann.
hörn'. Mit dem Betrag von 5 ,r-s ist er noch 1558 ver- Sixt Gumpp nahm das Schöne im Leben und
anschlagt'. Wenige Jahre später verlor er auf eine un- das Leben selbst in sich auf; dankbarlich erlebte und
geklärte unglückliche Weise den größten Teil seiner durchlebte er das, was er geschaut. Daher auch seine
Habe und seines Vermögens. Gumpp musste es herrlichen Madonnen. Unermüdlich tätig bis ins
erleben, seiner Armut wegen, um völlige Befreiung höchste Alter, sah er immer offenen Auges in die
von seinen Steuerpflichten nachzusuchen3. Welt um sich. Die Wandlungen des Zeitgeistes sind
Die letzten Lebensjahre wurden ihm vergällt nicht ungenützt an ihm vorübergegangen. Immer
durch einen Streit4 mit seinem Zunftgenossen Bai- aber drängt sich sein ureigenstes Wesen
thasar Isaac und Marx Samen, dessen Grund, Ur- durch. Immer die gleiche Grundstimmung, das
sache und Verlauf wir nicht weiter verfolgen können, göttlich Erhabene in das Gewand des rein Mensch-
weil die Quellen darüber nicht mehr vorhanden sind, liehen zu kleiden, die Menschen selbst aber, soweit er
Sein Alter muß ihm später zu einer großen Last das überhaupt tun konnte und durfte, wie in seinem
geworden sein. Seine Tochtermänner und Erben Schutzmantelaltar, so darzustellen, wie sie wirklich
Gilg Herold und Hans Semer ließen ihm am lebten. Sein Leitmotiv war eine kühne Phantasie, die
21. Mai 1568 von Rats wegen einen
Pfleger setzen. Die Stelle im Ratsproto-
koll für diesen Tag: „Sixt Gump ist
seiner leibsunvermöglichkcit halben uf
seiner iochtermänner ansuchen mit Claus
Petern bevögtigt", berührt ganz eigen.
Nur wenige Monde noch war ihm dies
traurige Los beschieden. Vor Martini
des gleichen Jahres 1568 ward er zu
seinen Vätern versammelt, denn in
der Steuerliste für diesen Termin ist sein
Name bereits getilgt. Am 12. Februar
1569 setzten sich seine Schwiegersöhne
und Erben über seinen Nachlass ausein-
ander. An seinem Todestag mag
Sixt Gumpp 75 bis 80 Jahre alt ge-
wesen sein. Sein Name verschwin- Abbiut 1(h Christus vom
det völlig aus den Quellen wie aus Aufsatz des Schutzmantel-
der Erinnerung. Auffällig: nirgendwo
auch nur die Spur von einem Gedenken
altars.
jeder seiner Schöpfungen trotz allem Rea-
lismus etwas ungemein Leichtes und
Schwebendes gibt. Wie er sich selbst
niemalen mit den Händeln des Alltags
abgab, so sollten auch seine Heiligen
über das Gewöhnliche sich erheben. (Da-
her die eigenartige Fuß-, Hand-, Locken-
und Gewandbehandlung.) In allen Ar-
beiten ein Zug der Weltfreudigkeit und
virtuosenhaften technischen Könnens.
Sixt Gumpps innerstes Wesen
ist uns ein Rätsel. Wenn wir ihn nach
dem beurteilen, was von seinen Werken
auf unsere Tage gekommen ist, und was
wir als die Offenbarung seines künst-
lerischen Erlebens erkannt haben, dann
drängt sich doch die Frage auf: warum
immer die gleiche Grundstimmung, die
gleiche technische Vollendung, und doch
— die großen Unterschiede in seiner Auf-
an ihn. Vielleicht hatte man ihn absichtlich vergessen, fassung? Seine Maria auf dem Anna-Altar und die
weil er es stets vorzog, seine eigenen Wege zu gehen; in der Locherer-Kapelle und den späteren; welcher
niemals betätigte er sich am öffentlich-bürgerlichen
Leben. Um die Stelle eines Zunftmeisters und Zunft-
vorsitzenden hat er sich nie beworben. Er überließ
es den Kleinen, nach äußeren Ehren zu geizen, und
lebte nur sich und seiner Kunst. Die vielfach klein-
lichen Kleinigkeitskrämereien der städtischen Politik
waren nichts für ihn und auch gar nicht nach seinem
scheinbare Gegensatz in der Auffassung vom Wesen
des Weibes! Indes — der Künstler war zwischen 1515
und 1522 älter und gereifter geworden, hatte das Leben
mehr kennen gelernt und erfahren, dass das Schöne
des Weibes nicht die äußere Erscheinung, das rein
Weltliche, sondern ihr innerstes Wesen: das Madon-
nen-Weltkindhafte ist. Lind eben dieses Erkennen und
Geschmack5. Trotz aller Leidenschaft, die in ihm seine künstlerische Ausgestaltung gibt seinen späteren
schlummerte und der er in seinen Werken Ausdruck Werken den eigenartigen Reiz, den wohl schon die
Zeitgenossen so wie wir, wenn nicht noch mehr,
' Urk. Beil. 8 zu 1544; Utk. Beil. 11 zu i?58 empfanden. Beim Lochereraltar und der Claer'-
- Geschichtl. Ortsbeschreibung 2, 12 zu Nr. 32.
' Urk. Beil. 14. 'Urk.Beil. ii. sehen Madonna hat er es am besten verstanden
5 Einige Male fungiert er als Zeuge in Erbschaftssachen: den charakteristischen Zug des Weibes, das Aliquid
am 9. November 1545 bei der Testamentsvollstreckung des sanctum ac providum zum Ausdruck ZU bringen.
Munsterkaplans Kaspar Schäfer; ebenso am 14. April 1542 und , .. _ , .. .
18. November 1551. Die Urkunden im Stadtarchiv (Verlassen- S.e gehören zum Schönsten, was jemals ein Künstler
schaffen von Geistlichen): Six Gumpp, Hintersaß, als Zeuge. am Oberrhein geschaffen.