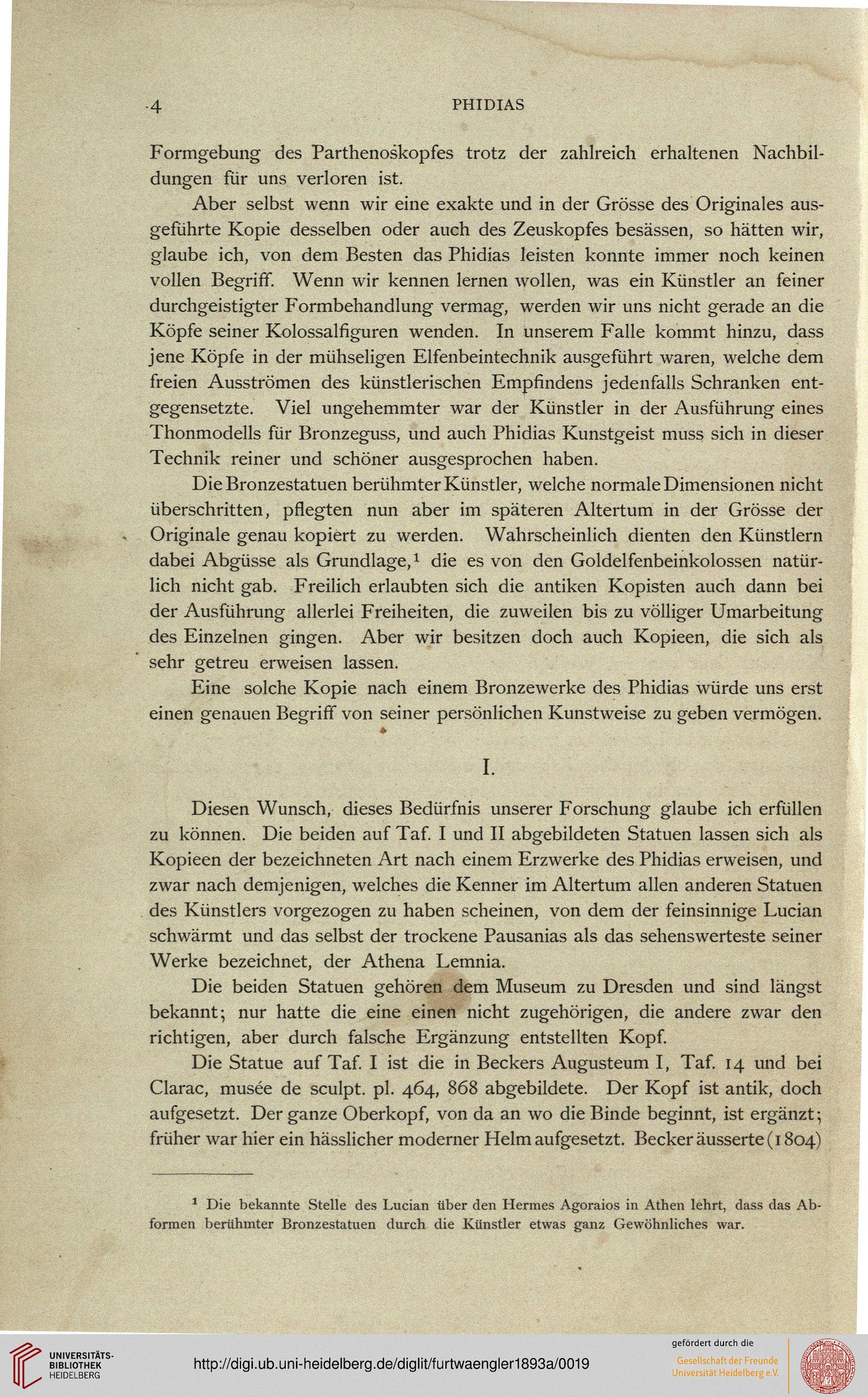PHIDIAS
Formgebung des Parthenoskopfes trotz der zahlreich erhaltenen Nachbil-
dungen für uns verloren ist.
Aber selbst wenn wir eine exakte und in der Grösse des Originales aus-
geführte Kopie desselben oder auch des Zeuskopfes besässen, so hätten wir,
glaube ich, von dem Besten das Phidias leisten konnte immer noch keinen
vollen Begriff. Wenn wir kennen lernen wollen, was ein Künstler an feiner
durchgeistigter Formbehandlung vermag, werden wir uns nicht gerade an die
Köpfe seiner Kolossalfiguren wenden. In unserem Falle kommt hinzu, dass
jene Köpfe in der mühseligen Elfenbeintechnik ausgeführt waren, welche dem
freien Ausströmen des künstlerischen Empfindens jedenfalls Schranken ent-
gegensetzte. Viel ungehemmter war der Künstler in der Ausführung eines
Thonmodells für Bronzeguss, und auch Phidias Kunstgeist muss sich in dieser
Technik reiner und schöner ausgesprochen haben.
Die Bronzestatuen berühmter Künstler, welche normale Dimensionen nicht
überschritten, pflegten nun aber im späteren Altertum in der Grösse der
Originale genau kopiert zu werden. Wahrscheinlich dienten den Künstlern
dabei Abgüsse als Grundlage,1 die es von den Goldelfenbeinkolossen natür-
lich nicht gab. Freilich erlaubten sich die antiken Kopisten auch dann bei
der Ausführung allerlei Freiheiten, die zuweilen bis zu völliger Umarbeitung
des Einzelnen gingen. Aber wir besitzen doch auch Kopieen, die sich als
sehr getreu erweisen lassen.
Eine solche Kopie nach einem Bronzewerke des Phidias würde uns erst
einen genauen Begriff von seiner persönlichen Kunstweise zu geben vermögen.
I.
Diesen Wunsch, dieses Bedürfnis unserer Forschung glaube ich erfüllen
zu können. Die beiden auf Taf. I und II abgebildeten Statuen lassen sich als
Kopieen der bezeichneten Art nach einem Erzwerke des Phidias erweisen, und
zwar nach demjenigen, welches die Kenner im Altertum allen anderen Statuen
des Künstlers vorgezogen zu haben scheinen, von dem der feinsinnige Lucian
schwärmt und das selbst der trockene Pausanias als das sehenswerteste seiner
Werke bezeichnet, der Athena Lemnia.
Die beiden Statuen gehören dem Museum zu Dresden und sind längst
bekannt; nur hatte die eine einen nicht zugehörigen, die andere zwar den
richtigen, aber durch falsche Ergänzung entstellten Kopf.
Die Statue auf Taf. I ist die in Beckers Augusteum I, Taf. 14 und bei
Clarac, musee de sculpt. pl. 464, 868 abgebildete. Der Kopf ist antik, doch
aufgesetzt. Der ganze Oberkopf, von da an wo die Binde beginnt, ist ergänzt;
früher war hier ein hässlicher moderner Helm aufgesetzt. Becker äusserte (1804)
1 Die bekannte Stelle des Lucian über den Hermes Agoraios in Athen lehrt, dass das Ab-
formen berühmter Bronzestatuen durch die Künstler etwas ganz Gewöhnliches war.
Formgebung des Parthenoskopfes trotz der zahlreich erhaltenen Nachbil-
dungen für uns verloren ist.
Aber selbst wenn wir eine exakte und in der Grösse des Originales aus-
geführte Kopie desselben oder auch des Zeuskopfes besässen, so hätten wir,
glaube ich, von dem Besten das Phidias leisten konnte immer noch keinen
vollen Begriff. Wenn wir kennen lernen wollen, was ein Künstler an feiner
durchgeistigter Formbehandlung vermag, werden wir uns nicht gerade an die
Köpfe seiner Kolossalfiguren wenden. In unserem Falle kommt hinzu, dass
jene Köpfe in der mühseligen Elfenbeintechnik ausgeführt waren, welche dem
freien Ausströmen des künstlerischen Empfindens jedenfalls Schranken ent-
gegensetzte. Viel ungehemmter war der Künstler in der Ausführung eines
Thonmodells für Bronzeguss, und auch Phidias Kunstgeist muss sich in dieser
Technik reiner und schöner ausgesprochen haben.
Die Bronzestatuen berühmter Künstler, welche normale Dimensionen nicht
überschritten, pflegten nun aber im späteren Altertum in der Grösse der
Originale genau kopiert zu werden. Wahrscheinlich dienten den Künstlern
dabei Abgüsse als Grundlage,1 die es von den Goldelfenbeinkolossen natür-
lich nicht gab. Freilich erlaubten sich die antiken Kopisten auch dann bei
der Ausführung allerlei Freiheiten, die zuweilen bis zu völliger Umarbeitung
des Einzelnen gingen. Aber wir besitzen doch auch Kopieen, die sich als
sehr getreu erweisen lassen.
Eine solche Kopie nach einem Bronzewerke des Phidias würde uns erst
einen genauen Begriff von seiner persönlichen Kunstweise zu geben vermögen.
I.
Diesen Wunsch, dieses Bedürfnis unserer Forschung glaube ich erfüllen
zu können. Die beiden auf Taf. I und II abgebildeten Statuen lassen sich als
Kopieen der bezeichneten Art nach einem Erzwerke des Phidias erweisen, und
zwar nach demjenigen, welches die Kenner im Altertum allen anderen Statuen
des Künstlers vorgezogen zu haben scheinen, von dem der feinsinnige Lucian
schwärmt und das selbst der trockene Pausanias als das sehenswerteste seiner
Werke bezeichnet, der Athena Lemnia.
Die beiden Statuen gehören dem Museum zu Dresden und sind längst
bekannt; nur hatte die eine einen nicht zugehörigen, die andere zwar den
richtigen, aber durch falsche Ergänzung entstellten Kopf.
Die Statue auf Taf. I ist die in Beckers Augusteum I, Taf. 14 und bei
Clarac, musee de sculpt. pl. 464, 868 abgebildete. Der Kopf ist antik, doch
aufgesetzt. Der ganze Oberkopf, von da an wo die Binde beginnt, ist ergänzt;
früher war hier ein hässlicher moderner Helm aufgesetzt. Becker äusserte (1804)
1 Die bekannte Stelle des Lucian über den Hermes Agoraios in Athen lehrt, dass das Ab-
formen berühmter Bronzestatuen durch die Künstler etwas ganz Gewöhnliches war.