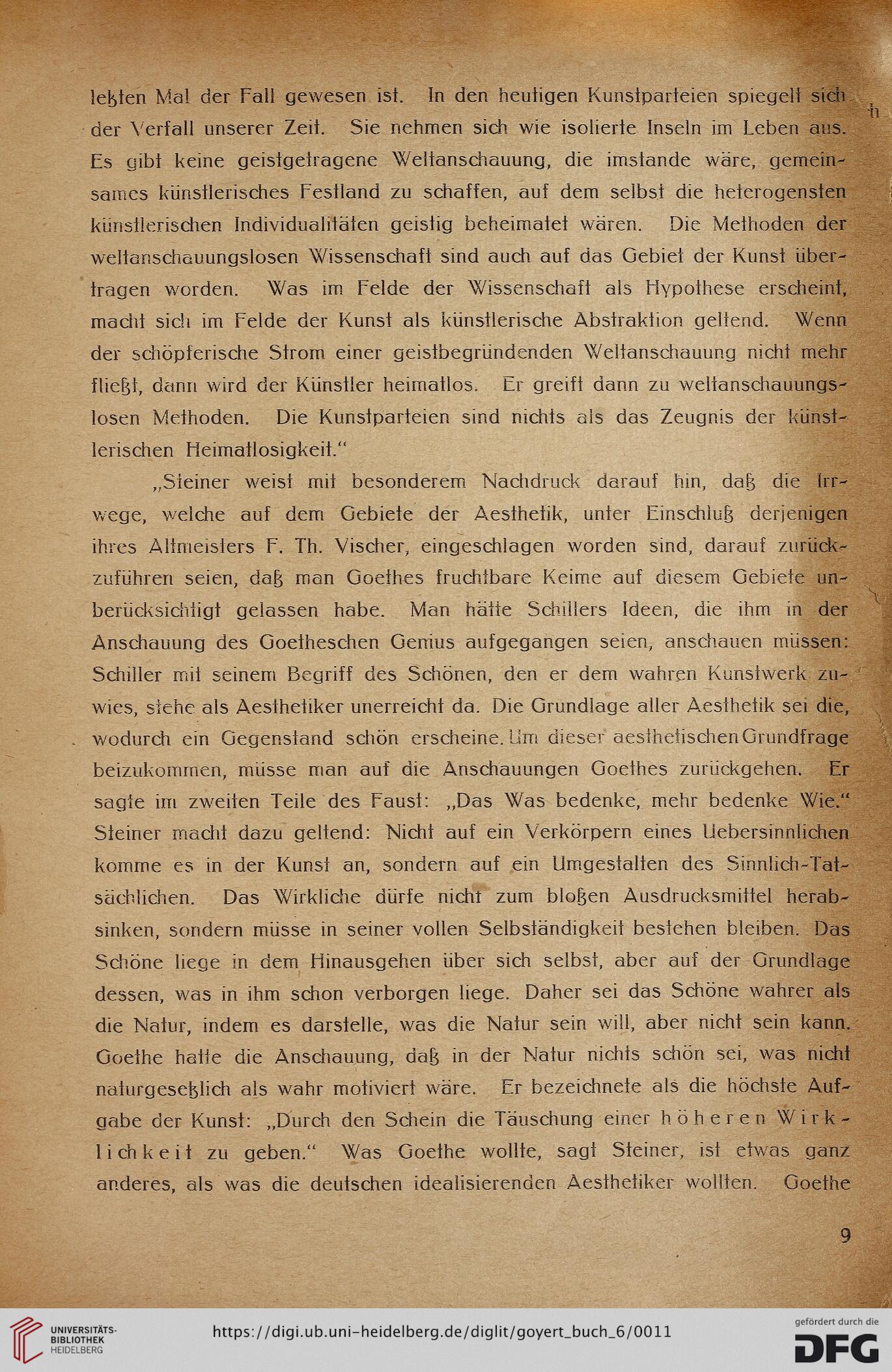lebten Mal der Fall gewesen ist. In den heutigen Kunstparteien spiegelt sich
der Verfall unserer Zeit. Sie nehmen sich wie isolierte Inseln im Leben aus.
Es gibt keine geistgetragene Weltanschauung, die imstande wäre, gemein-
sames künstlerisches Festland zu schaffen, auf dem selbst die heterogensten
künstlerischen Individualitäten geistig beheimatet wären. Die Methoden der
weltanschauungslosen Wissenschaft sind auch auf das Gebiet der Kunst über-
tragen worden. Was im Felde der Wissenschaft als Hypothese erscheint,
macht sich im Felde der Kunst als künstlerische Abstraktion geltend. Wenn
der schöpferische Strom einer geistbegründenden Weltanschauung nicht mehr
flieht, dann wird der Künstler heimatlos. Er greift dann zu weltanschauungs-
losen Methoden. Die Kunsfparfeien sind nichts als das Zeugnis der künst-
lerischen Heimatlosigkeit.“
„Steiner weist mit besonderem Nachdruck darauf hin, daß die Irr-
wege, welche auf dem Gebiete der Aestheiik, unter Einschluß derjenigen
ihres Altmeisters F. Th. Vischer, eingeschlagen worden sind, darauf zurück-
zuführen seien, daß man Goethes fruchtbare Keime auf diesem Gebiete un-
berücksichtigt gelassen habe. Man hätte Schillers Ideen, die ihm in der
Anschauung des Goetheschen Genius aufgegangen seien, anschauen müssen:
Schiller mit seinem Begriff des Schönen, den er dem wahren Kunstwerk zu-
wies, stehe als Aesthetiker unerreicht da. Die Grundlage aller Aesthetik sei die,
wodurch ein Gegenstand schön erscheine JJm dieser aesthetischen Grundfrage
beizukomrnen, müsse man auf die Anschauungen Goethes zurückgehen. Er
sagte im zweiten Teile des Faust: „Das Was bedenke, mehr bedenke Wie."
Steiner macht dazu geltend: Nicht auf ein Verkörpern eines Hebersinnlichen
komme es in der Kunst an, sondern auf ein Ilmgestalten des Sinnlich-Tat-
sächlichen. Das Wirkliche dürfe nicht zum bloßen Ausdrucksmiftel herab-
sinken, sondern müsse in seiner vollen Selbständigkeit bestehen bleiben. Das
Schöne liege in dem Hinausgehen über sich selbst, aber auf der Grundlage
dessen, was in ihm schon verborgen liege. Daher sei das Schöne wahrer als
die Natur, indem es darstelle, was die Natur sein will, aber nicht sein kann.
Goethe hatte die Anschauung, daß in der Natur nichts schön sei, was nicht
naturgeseßlich als wahr motiviert wäre. Er bezeichnete als die höchste Auf-
gabe der Kunst: „Durch den Schein die Täuschung einer höheren Wirk-
1 i ch k e i t zu geben.“ Was Goethe wollte, sagt Steiner, ist etwas ganz
anderes, als was die deutschen idealisierenden Aesthetiker wollten. Goethe
9
der Verfall unserer Zeit. Sie nehmen sich wie isolierte Inseln im Leben aus.
Es gibt keine geistgetragene Weltanschauung, die imstande wäre, gemein-
sames künstlerisches Festland zu schaffen, auf dem selbst die heterogensten
künstlerischen Individualitäten geistig beheimatet wären. Die Methoden der
weltanschauungslosen Wissenschaft sind auch auf das Gebiet der Kunst über-
tragen worden. Was im Felde der Wissenschaft als Hypothese erscheint,
macht sich im Felde der Kunst als künstlerische Abstraktion geltend. Wenn
der schöpferische Strom einer geistbegründenden Weltanschauung nicht mehr
flieht, dann wird der Künstler heimatlos. Er greift dann zu weltanschauungs-
losen Methoden. Die Kunsfparfeien sind nichts als das Zeugnis der künst-
lerischen Heimatlosigkeit.“
„Steiner weist mit besonderem Nachdruck darauf hin, daß die Irr-
wege, welche auf dem Gebiete der Aestheiik, unter Einschluß derjenigen
ihres Altmeisters F. Th. Vischer, eingeschlagen worden sind, darauf zurück-
zuführen seien, daß man Goethes fruchtbare Keime auf diesem Gebiete un-
berücksichtigt gelassen habe. Man hätte Schillers Ideen, die ihm in der
Anschauung des Goetheschen Genius aufgegangen seien, anschauen müssen:
Schiller mit seinem Begriff des Schönen, den er dem wahren Kunstwerk zu-
wies, stehe als Aesthetiker unerreicht da. Die Grundlage aller Aesthetik sei die,
wodurch ein Gegenstand schön erscheine JJm dieser aesthetischen Grundfrage
beizukomrnen, müsse man auf die Anschauungen Goethes zurückgehen. Er
sagte im zweiten Teile des Faust: „Das Was bedenke, mehr bedenke Wie."
Steiner macht dazu geltend: Nicht auf ein Verkörpern eines Hebersinnlichen
komme es in der Kunst an, sondern auf ein Ilmgestalten des Sinnlich-Tat-
sächlichen. Das Wirkliche dürfe nicht zum bloßen Ausdrucksmiftel herab-
sinken, sondern müsse in seiner vollen Selbständigkeit bestehen bleiben. Das
Schöne liege in dem Hinausgehen über sich selbst, aber auf der Grundlage
dessen, was in ihm schon verborgen liege. Daher sei das Schöne wahrer als
die Natur, indem es darstelle, was die Natur sein will, aber nicht sein kann.
Goethe hatte die Anschauung, daß in der Natur nichts schön sei, was nicht
naturgeseßlich als wahr motiviert wäre. Er bezeichnete als die höchste Auf-
gabe der Kunst: „Durch den Schein die Täuschung einer höheren Wirk-
1 i ch k e i t zu geben.“ Was Goethe wollte, sagt Steiner, ist etwas ganz
anderes, als was die deutschen idealisierenden Aesthetiker wollten. Goethe
9