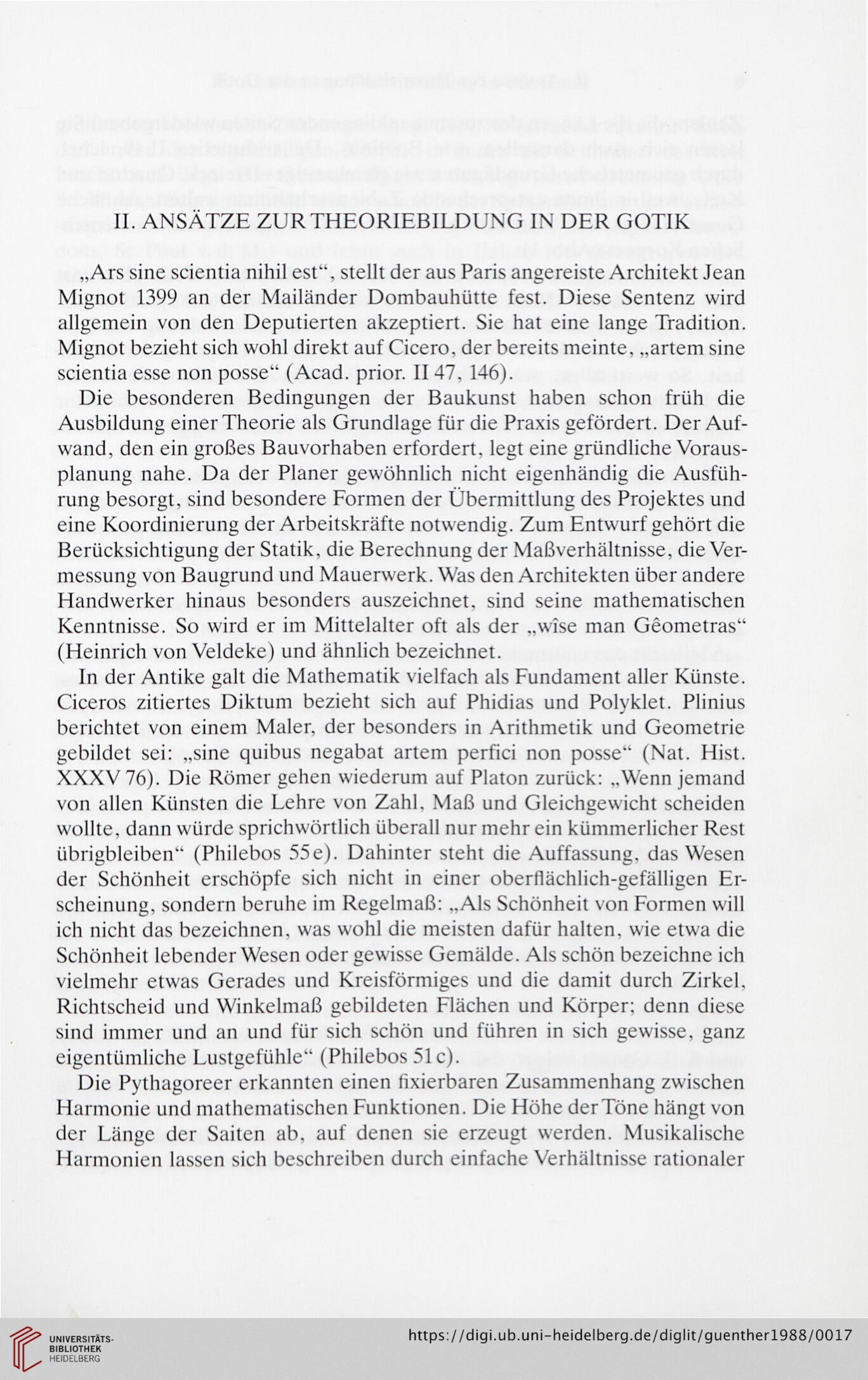II. ANSÄTZE ZUR THEORIEBILDUNG IN DER GOTIK
„Ars sine scientia nihil est“, stellt der aus Paris angereiste Architekt Jean
Mignot 1399 an der Mailänder Dombauhütte fest. Diese Sentenz wird
allgemein von den Deputierten akzeptiert. Sie hat eine lange Tradition.
Mignot bezieht sich wohl direkt auf Cicero, der bereits meinte, „artem sine
scientia esse non posse“ (Acad. prior. II47, 146).
Die besonderen Bedingungen der Baukunst haben schon früh die
Ausbildung einer Theorie als Grundlage für die Praxis gefördert. Der Auf-
wand, den ein großes Bauvorhaben erfordert, legt eine gründliche Voraus-
planung nahe. Da der Planer gewöhnlich nicht eigenhändig die Ausfüh-
rung besorgt, sind besondere Formen der Übermittlung des Projektes und
eine Koordinierung der Arbeitskräfte notwendig. Zum Entwurf gehört die
Berücksichtigung der Statik, die Berechnung der Maßverhältnisse, die Ver-
messung von Baugrund und Mauerwerk. Was den Architekten über andere
Handwerker hinaus besonders auszeichnet, sind seine mathematischen
Kenntnisse. So wird er im Mittelalter oft als der „wise man Geometras“
(Heinrich von Veldeke) und ähnlich bezeichnet.
In der Antike galt die Mathematik vielfach als Fundament aller Künste.
Ciceros zitiertes Diktum bezieht sich auf Phidias und Polyklet. Plinius
berichtet von einem Maler, der besonders in Arithmetik und Geometrie
gebildet sei: „sine quibus negabat artem perfici non posse“ (Nat. Hist.
XXXV 76). Die Römer gehen wiederum auf Platon zurück: „Wenn jemand
von allen Künsten die Lehre von Zahl, Maß und Gleichgewicht scheiden
wollte, dann würde sprichwörtlich überall nur mehr ein kümmerlicher Rest
übrigbleiben“ (Philebos 55e). Dahinter steht die Auffassung, das Wesen
der Schönheit erschöpfe sich nicht in einer oberflächlich-gefälligen Er-
scheinung, sondern beruhe im Regelmaß: „Als Schönheit von Formen will
ich nicht das bezeichnen, was wohl die meisten dafür halten, wie etwa die
Schönheit lebender Wesen oder gewisse Gemälde. Als schön bezeichne ich
vielmehr etwas Gerades und Kreisförmiges und die damit durch Zirkel,
Richtscheid und Winkelmaß gebildeten Flächen und Körper; denn diese
sind immer und an und für sich schön und führen in sich gewisse, ganz
eigentümliche Lustgefühle“ (Philebos 51c).
Die Pythagoreer erkannten einen fixierbaren Zusammenhang zwischen
Harmonie und mathematischen Funktionen. Die Höhe derTöne hängt von
der Länge der Saiten ab, auf denen sie erzeugt werden. Musikalische
Harmonien lassen sich beschreiben durch einfache Verhältnisse rationaler
„Ars sine scientia nihil est“, stellt der aus Paris angereiste Architekt Jean
Mignot 1399 an der Mailänder Dombauhütte fest. Diese Sentenz wird
allgemein von den Deputierten akzeptiert. Sie hat eine lange Tradition.
Mignot bezieht sich wohl direkt auf Cicero, der bereits meinte, „artem sine
scientia esse non posse“ (Acad. prior. II47, 146).
Die besonderen Bedingungen der Baukunst haben schon früh die
Ausbildung einer Theorie als Grundlage für die Praxis gefördert. Der Auf-
wand, den ein großes Bauvorhaben erfordert, legt eine gründliche Voraus-
planung nahe. Da der Planer gewöhnlich nicht eigenhändig die Ausfüh-
rung besorgt, sind besondere Formen der Übermittlung des Projektes und
eine Koordinierung der Arbeitskräfte notwendig. Zum Entwurf gehört die
Berücksichtigung der Statik, die Berechnung der Maßverhältnisse, die Ver-
messung von Baugrund und Mauerwerk. Was den Architekten über andere
Handwerker hinaus besonders auszeichnet, sind seine mathematischen
Kenntnisse. So wird er im Mittelalter oft als der „wise man Geometras“
(Heinrich von Veldeke) und ähnlich bezeichnet.
In der Antike galt die Mathematik vielfach als Fundament aller Künste.
Ciceros zitiertes Diktum bezieht sich auf Phidias und Polyklet. Plinius
berichtet von einem Maler, der besonders in Arithmetik und Geometrie
gebildet sei: „sine quibus negabat artem perfici non posse“ (Nat. Hist.
XXXV 76). Die Römer gehen wiederum auf Platon zurück: „Wenn jemand
von allen Künsten die Lehre von Zahl, Maß und Gleichgewicht scheiden
wollte, dann würde sprichwörtlich überall nur mehr ein kümmerlicher Rest
übrigbleiben“ (Philebos 55e). Dahinter steht die Auffassung, das Wesen
der Schönheit erschöpfe sich nicht in einer oberflächlich-gefälligen Er-
scheinung, sondern beruhe im Regelmaß: „Als Schönheit von Formen will
ich nicht das bezeichnen, was wohl die meisten dafür halten, wie etwa die
Schönheit lebender Wesen oder gewisse Gemälde. Als schön bezeichne ich
vielmehr etwas Gerades und Kreisförmiges und die damit durch Zirkel,
Richtscheid und Winkelmaß gebildeten Flächen und Körper; denn diese
sind immer und an und für sich schön und führen in sich gewisse, ganz
eigentümliche Lustgefühle“ (Philebos 51c).
Die Pythagoreer erkannten einen fixierbaren Zusammenhang zwischen
Harmonie und mathematischen Funktionen. Die Höhe derTöne hängt von
der Länge der Saiten ab, auf denen sie erzeugt werden. Musikalische
Harmonien lassen sich beschreiben durch einfache Verhältnisse rationaler