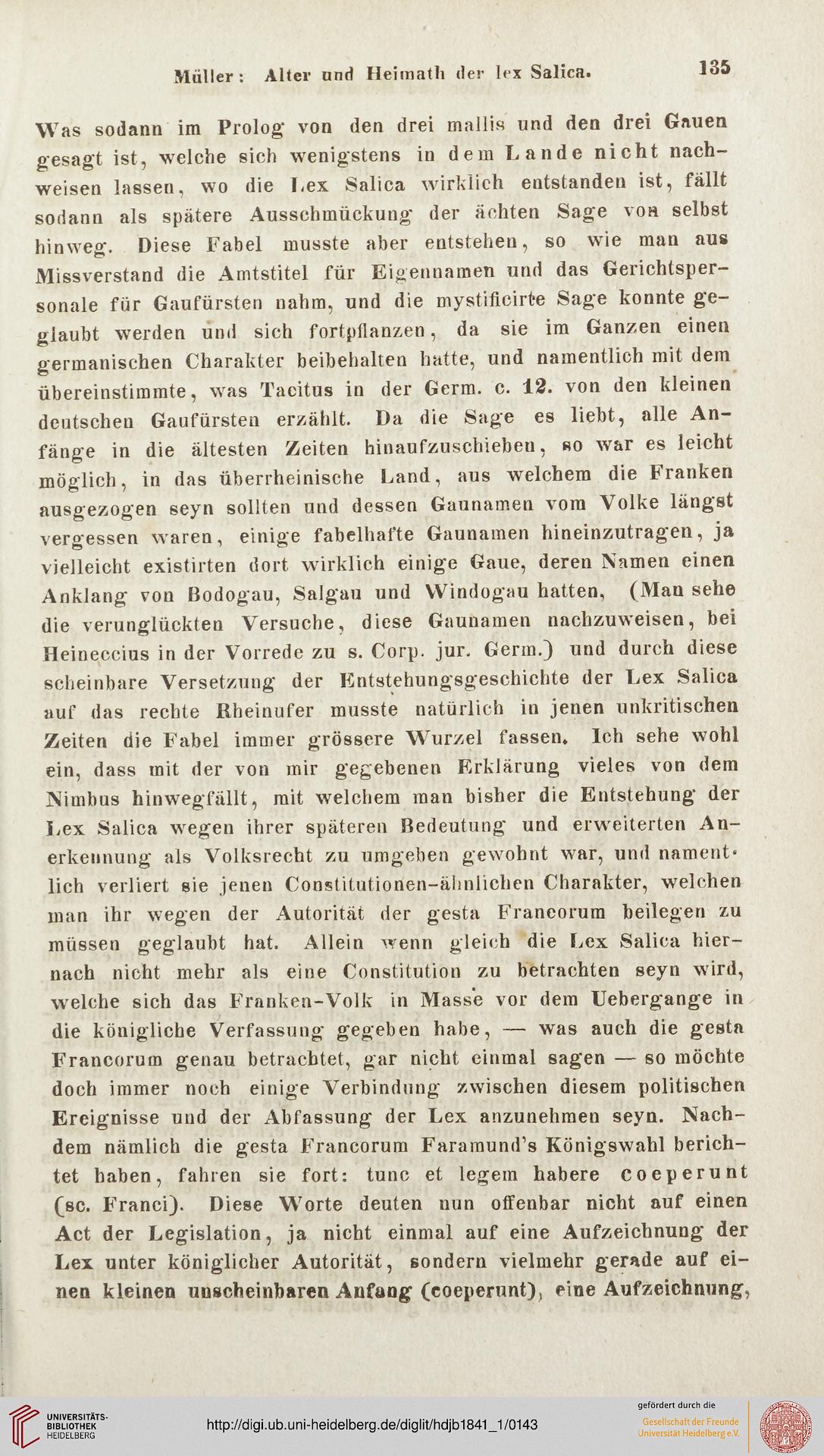Müller: Alter und Heimath der lex Salica.
135
Was sodann im Prolog* von den drei mallis und den drei Gauen
gesagt ist, welche sich wenigstens in dem Lande nicht nach-
weisen lassen, wo die Lex Salica wirklich entstanden ist, fällt
sodann als spätere Ausschmückung der ächten Sage von selbst
hinweg. Diese Fabel musste aber entstehen, so wie man aus
Missverstand die Amtstitel für Eigennamen und das Gerichtsper-
sonale für Gaufürsten nahm, und die mystificirte Sage konnte ge-
glaubt werden und sich fortpflanzen, da sie im Ganzen einen
germanischen Charakter beibehalten hatte, und namentlich mit dem
übereinstiramte, was Taeitus in der Germ. c. 12. von den kleinen
deutscheu Gaufürsten erzählt. Da die Sage es lieht, alle An-
fänge in die ältesten Zeiten hinaufzuschieben, so war es leicht
möglich, in das überrheinische Land, aus welchem die Franken
ausgezogen seyn sollten und dessen Gaunamen vom Volke längst
vergessen waren, einige fabelhafte Gaunamen hineinzutragen, ja
vielleicht existirten dort wirklich einige Gaue, deren Namen einen
Anklang von Bodogau, Salgau und Windogau hatten, (Man sehe
die verunglückten Versuche, diese Gaunamen nachzuweisen, bei
Heineccius in der Vorrede zu s. Corp. jur. Germ.) und durch diese
scheinbare Versetzung der Entstehungsgeschichte der Lex Salica
auf das rechte Rheinufer musste natürlich in jenen unkritischen
Zeiten die Fabel immer grössere Wurzel fassen. Ich sehe wohl
ein, dass mit der von mir gegebenen Erklärung vieles von dem
Nimbus hinwegfällt, mit welchem man bisher die Entstehung der
Lex Salica xvegen ihrer späteren Bedeutung und erweiterten An-
erkennung als Volksrecht zu umgeben gewohnt war, und nament*
lieh verliert sie jenen Constitutionen-älinlichen Charakter, welchen
man ihr wegen der Autorität der gesta Franeorum beilegen zu
müssen geglaubt hat. Allein wenn gleich die Lex Salica hier-
nach nicht mehr als eine Constitution zu betrachten seyn wird,
welche sich das Franken-Volk in Masse vor dem Uebergange in
die königliche Verfassung gegeben habe, — was auch die gesta
Francorum genau betrachtet, gar nicht einmal sagen — so möchte
doch immer noch einige Verbindung zwischen diesem politischen
Ereignisse und der Abfassung der Lex anzunehmen seyn. Nach-
dem nämlich die gesta Francorum Faramund’s Königswahl berich-
tet haben, fahren sie fort: tune et legem habere coeperunt
(sc. Franci). Diese Worte deuten nun offenbar nicht auf einen
Act der Legislation, ja nicht einmal auf eine Aufzeichnung der
Lex unter königlicher Autorität, sondern vielmehr gerade auf ei-
nen kleinen unscheinbaren Anfang (coeperunt), eine Aufzeichnung,
135
Was sodann im Prolog* von den drei mallis und den drei Gauen
gesagt ist, welche sich wenigstens in dem Lande nicht nach-
weisen lassen, wo die Lex Salica wirklich entstanden ist, fällt
sodann als spätere Ausschmückung der ächten Sage von selbst
hinweg. Diese Fabel musste aber entstehen, so wie man aus
Missverstand die Amtstitel für Eigennamen und das Gerichtsper-
sonale für Gaufürsten nahm, und die mystificirte Sage konnte ge-
glaubt werden und sich fortpflanzen, da sie im Ganzen einen
germanischen Charakter beibehalten hatte, und namentlich mit dem
übereinstiramte, was Taeitus in der Germ. c. 12. von den kleinen
deutscheu Gaufürsten erzählt. Da die Sage es lieht, alle An-
fänge in die ältesten Zeiten hinaufzuschieben, so war es leicht
möglich, in das überrheinische Land, aus welchem die Franken
ausgezogen seyn sollten und dessen Gaunamen vom Volke längst
vergessen waren, einige fabelhafte Gaunamen hineinzutragen, ja
vielleicht existirten dort wirklich einige Gaue, deren Namen einen
Anklang von Bodogau, Salgau und Windogau hatten, (Man sehe
die verunglückten Versuche, diese Gaunamen nachzuweisen, bei
Heineccius in der Vorrede zu s. Corp. jur. Germ.) und durch diese
scheinbare Versetzung der Entstehungsgeschichte der Lex Salica
auf das rechte Rheinufer musste natürlich in jenen unkritischen
Zeiten die Fabel immer grössere Wurzel fassen. Ich sehe wohl
ein, dass mit der von mir gegebenen Erklärung vieles von dem
Nimbus hinwegfällt, mit welchem man bisher die Entstehung der
Lex Salica xvegen ihrer späteren Bedeutung und erweiterten An-
erkennung als Volksrecht zu umgeben gewohnt war, und nament*
lieh verliert sie jenen Constitutionen-älinlichen Charakter, welchen
man ihr wegen der Autorität der gesta Franeorum beilegen zu
müssen geglaubt hat. Allein wenn gleich die Lex Salica hier-
nach nicht mehr als eine Constitution zu betrachten seyn wird,
welche sich das Franken-Volk in Masse vor dem Uebergange in
die königliche Verfassung gegeben habe, — was auch die gesta
Francorum genau betrachtet, gar nicht einmal sagen — so möchte
doch immer noch einige Verbindung zwischen diesem politischen
Ereignisse und der Abfassung der Lex anzunehmen seyn. Nach-
dem nämlich die gesta Francorum Faramund’s Königswahl berich-
tet haben, fahren sie fort: tune et legem habere coeperunt
(sc. Franci). Diese Worte deuten nun offenbar nicht auf einen
Act der Legislation, ja nicht einmal auf eine Aufzeichnung der
Lex unter königlicher Autorität, sondern vielmehr gerade auf ei-
nen kleinen unscheinbaren Anfang (coeperunt), eine Aufzeichnung,