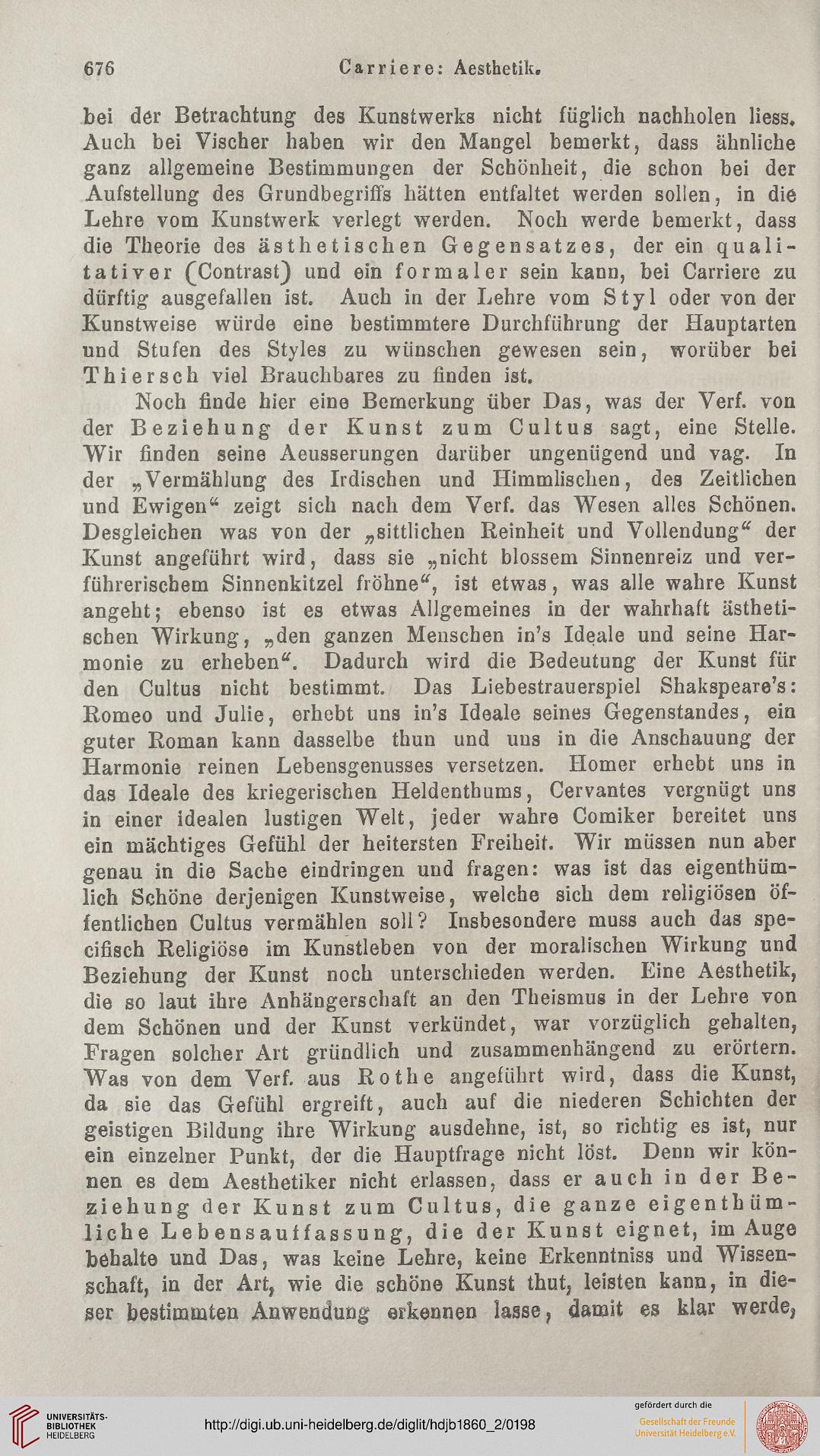676
Carriere: Aesthetik.
bei der Betrachtung des Kunstwerks nicht füglich nachholen liess.
Auch bei Vischer haben wir den Mangel bemerkt, dass ähnliche
ganz allgemeine Bestimmungen der Schönheit, die schon bei der
Aufstellung des Grundbegriffs hätten entfaltet werden sollen, in die
Lehre vom Kunstwerk verlegt werden. Noch werde bemerkt, dass
die Theorie des ästhetischen Gegensatzes, der ein quali-
tativer (Contrast) und ein formaler sein kann, bei Carriere zu
dürftig ausgefallen ist. Auch in der Lehre vom Styl oder von der
Kunstweise würde eine bestimmtere Durchführung der Hauptarten
und Stufen des Styles zu wünschen gewesen sein, worüber bei
Thier sch viel Brauchbares zu finden ist.
Noch finde hier eine Bemerkung über Das, was der Verf. von
der Beziehung der Kunst zum Cultus sagt, eine Stelle.
Wir finden seine Aeusserungen darüber ungenügend und vag. In
der „Vermählung des Irdischen und Himmlischen, des Zeitlichen
und Ewigen“ zeigt sich nach dem Verf. das Wesen alles Schönen.
Desgleichen was von der „sittlichen Reinheit und Vollendung“ der
Kunst angeführt wird, dass sie „nicht blossem Sinnenreiz und ver-
führerischem Sinnenkitzel fröhne“, ist etwas, was alle wahre Kunst
angebt; ebenso ist es etwas Allgemeines in der wahrhaft ästheti-
schen Wirkung, „den ganzen Menschen in’s Ideale und seine Har-
monie zu erheben“. Dadurch wird die Bedeutung der Kunst für
den Cultus nicht bestimmt. Das Liebestrauerspiel Shakspeare’s:
Romeo und Julie, erhebt uns in’s Ideale seines Gegenstandes, ein
guter Roman kann dasselbe thun und uns in die Anschauung der
Harmonie reinen Lebensgenusses versetzen. Homer erhebt uns in
das Ideale des kriegerischen Heldenthums, Cervantes vergnügt uns
in einer idealen lustigen Welt, jeder wahre Comiker bereitet uns
ein mächtiges Gefühl der heitersten Freiheit. Wir müssen nun aber
genau in die Sache eindringen und fragen: was ist das eigenthüm-
lich Schöne derjenigen Kunstweise, welche sich dem religiösen öf-
fentlichen Cultus vermählen soll? Insbesondere muss auch das spe-
cifisch Religiöse im Kunstleben von der moralischen Wirkung und
Beziehung der Kunst noch unterschieden werden. Eine Aesthetik,
die so laut ihre Anhängerschaft an den Theismus in der Lehre von
dem Schönen und der Kunst verkündet, war vorzüglich gehalten,
Fragen solcher Art gründlich und zusammenhängend zu erörtern.
Was von dem Verf. aus Rothe angeführt wird, dass die Kunst,
da sie das Gefühl ergreift, auch auf die niederen Schichten der
geistigen Bildung ihre Wirkung ausdehne, ist, so richtig es ist, nur
ein einzelner Punkt, der die Hauptfrage nicht löst. Denn wir kön-
nen es dem Aesthetiker nicht erlassen, dass er auch in der Be-
ziehung der Kunst zum Cultus, die ganze eigenthüm-
liche Lebensauffassung, die der Kunst eignet, im Auge
behalte und Das, was keine Lehre, keine Erkenntniss und Wissen-
schaft, in der Art, wie die schöne Kunst thut, leisten kann, in die-
ser bestimmten Anwendung erkennen lasse, damit es klar werde.
Carriere: Aesthetik.
bei der Betrachtung des Kunstwerks nicht füglich nachholen liess.
Auch bei Vischer haben wir den Mangel bemerkt, dass ähnliche
ganz allgemeine Bestimmungen der Schönheit, die schon bei der
Aufstellung des Grundbegriffs hätten entfaltet werden sollen, in die
Lehre vom Kunstwerk verlegt werden. Noch werde bemerkt, dass
die Theorie des ästhetischen Gegensatzes, der ein quali-
tativer (Contrast) und ein formaler sein kann, bei Carriere zu
dürftig ausgefallen ist. Auch in der Lehre vom Styl oder von der
Kunstweise würde eine bestimmtere Durchführung der Hauptarten
und Stufen des Styles zu wünschen gewesen sein, worüber bei
Thier sch viel Brauchbares zu finden ist.
Noch finde hier eine Bemerkung über Das, was der Verf. von
der Beziehung der Kunst zum Cultus sagt, eine Stelle.
Wir finden seine Aeusserungen darüber ungenügend und vag. In
der „Vermählung des Irdischen und Himmlischen, des Zeitlichen
und Ewigen“ zeigt sich nach dem Verf. das Wesen alles Schönen.
Desgleichen was von der „sittlichen Reinheit und Vollendung“ der
Kunst angeführt wird, dass sie „nicht blossem Sinnenreiz und ver-
führerischem Sinnenkitzel fröhne“, ist etwas, was alle wahre Kunst
angebt; ebenso ist es etwas Allgemeines in der wahrhaft ästheti-
schen Wirkung, „den ganzen Menschen in’s Ideale und seine Har-
monie zu erheben“. Dadurch wird die Bedeutung der Kunst für
den Cultus nicht bestimmt. Das Liebestrauerspiel Shakspeare’s:
Romeo und Julie, erhebt uns in’s Ideale seines Gegenstandes, ein
guter Roman kann dasselbe thun und uns in die Anschauung der
Harmonie reinen Lebensgenusses versetzen. Homer erhebt uns in
das Ideale des kriegerischen Heldenthums, Cervantes vergnügt uns
in einer idealen lustigen Welt, jeder wahre Comiker bereitet uns
ein mächtiges Gefühl der heitersten Freiheit. Wir müssen nun aber
genau in die Sache eindringen und fragen: was ist das eigenthüm-
lich Schöne derjenigen Kunstweise, welche sich dem religiösen öf-
fentlichen Cultus vermählen soll? Insbesondere muss auch das spe-
cifisch Religiöse im Kunstleben von der moralischen Wirkung und
Beziehung der Kunst noch unterschieden werden. Eine Aesthetik,
die so laut ihre Anhängerschaft an den Theismus in der Lehre von
dem Schönen und der Kunst verkündet, war vorzüglich gehalten,
Fragen solcher Art gründlich und zusammenhängend zu erörtern.
Was von dem Verf. aus Rothe angeführt wird, dass die Kunst,
da sie das Gefühl ergreift, auch auf die niederen Schichten der
geistigen Bildung ihre Wirkung ausdehne, ist, so richtig es ist, nur
ein einzelner Punkt, der die Hauptfrage nicht löst. Denn wir kön-
nen es dem Aesthetiker nicht erlassen, dass er auch in der Be-
ziehung der Kunst zum Cultus, die ganze eigenthüm-
liche Lebensauffassung, die der Kunst eignet, im Auge
behalte und Das, was keine Lehre, keine Erkenntniss und Wissen-
schaft, in der Art, wie die schöne Kunst thut, leisten kann, in die-
ser bestimmten Anwendung erkennen lasse, damit es klar werde.