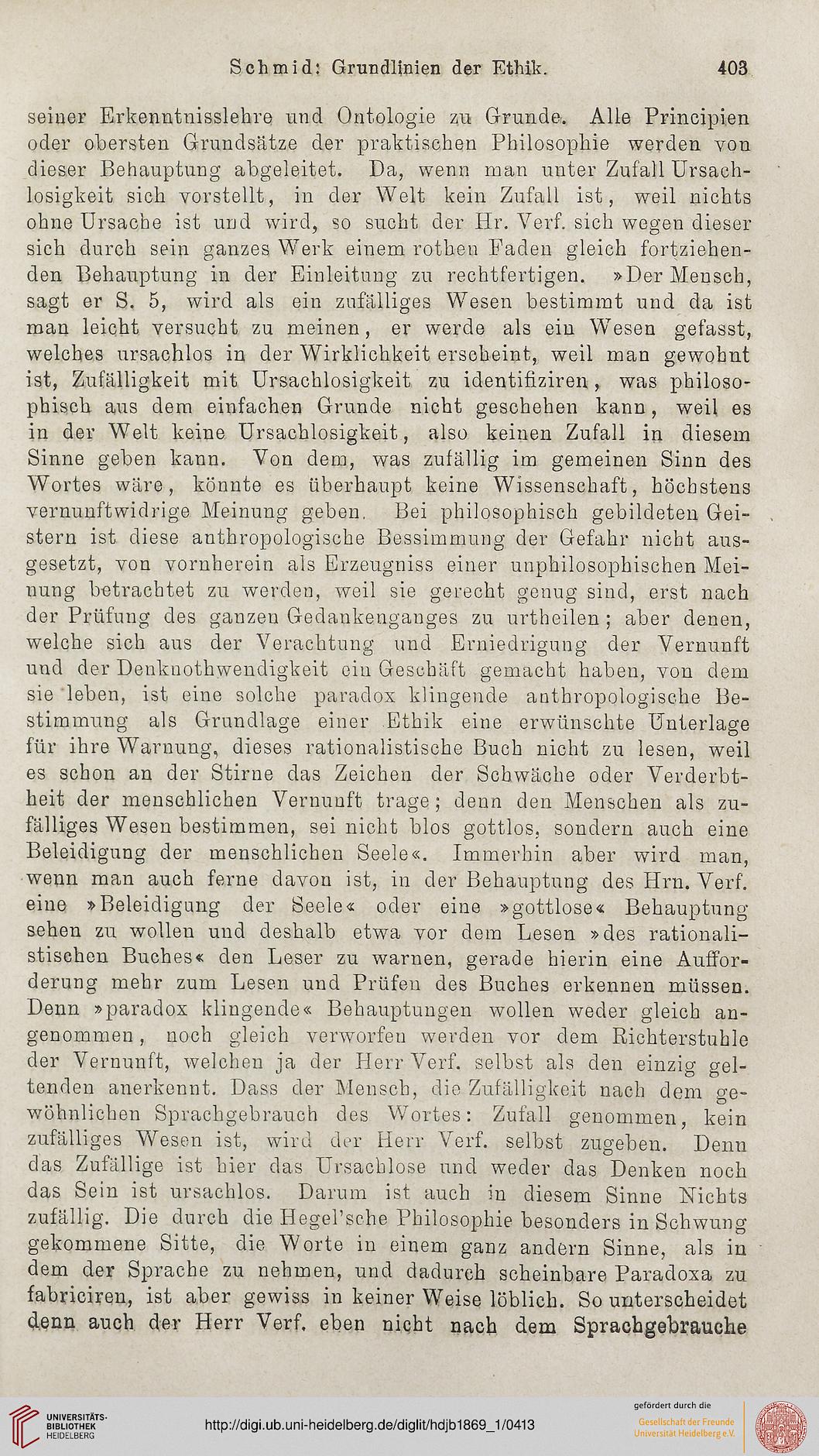Schmid: Grundlinien der Ethik. 403
seiner Erkenntnisslehre und Ontologie zu Grunde. Alle Principien
oder obersten Grundsätze der praktischen Philosophie werden von
dieser Behauptung abgeleitet. Da, wenn man unter Zufall Ursach-
losigkeit sich vorstellt, in der Welt kein Zufall ist, weil nichts
ohne Ursache ist und wird, so sucht der Hr. Verf. sich wegen dieser
sich durch sein ganzes Werk einem rothen Faden gleich fortziehen-
den Behauptung in der Einleitung zu rechtfertigen. »Der Mensch,
sagt er S. 5, wird als ein zufälliges Wesen bestimmt und da ist
man leicht versucht zu meinen, er werde als ein Wesen gefasst,
welches ursachlos in der Wirklichkeit erscheint, weil man gewohnt
ist, Zufälligkeit mit Ursachlosigkeit zu identifiziren, was philoso-
phisch aus dem einfachen Grunde nicht geschehen kann, weil es
in der Welt keine Ursachlosigkeit, also keinen Zufall in diesem
Sinne geben kann. Von dem, was zufällig im gemeinen Sinn des
Wortes wäre, könnte es überhaupt keine Wissenschaft, höchstens
vernunftwidrige Meinung geben. Bei philosophisch gebildeten Gei-
stern ist diese anthropologische Bessimmung der Gefahr nicht aus-
gesetzt, von vornherein als Erzeugniss einer unphilosophischen Mei-
nung betrachtet zu werden, weil sie gerecht genug sind, erst nach
der Prüfung des ganzen Gedankengauges zu urtheilen; aber denen,
welche sich aus der Verachtung und Erniedrigung der Vernunft
und der Denkuothwendigkeit ein Geschäft gemacht haben, von dem
sie leben, ist eine solche paradox klingende anthropologische Be-
stimmung als Grundlage einer Ethik eine erwünschte Unterlage
für ihre Warnung, dieses rationalistische Buch nicht zu lesen, weil
es schon an der Stirne das Zeichen dei· Schwäche oder Verderbt-
heit der menschlichen Vernunft trage; denn den Menschen als zu-
fälliges Wesen bestimmen, sei nicht blos gottlos, sondern auch eine
Beleidigung der menschlichen Seele«. Immerhin aber wird man,
wenn man auch ferne davon ist, in der Behauptung des Hrn. Verf.
eine »Beleidigung der Seele« oder eine »gottlose« Behauptung
sehen zu wollen und deshalb etwa vor dem Lesen »des rationali-
stischen Buches« den Leser zu warnen, gerade hierin eine Auffor-
derung mehr zum Lesen und Prüfen des Buches erkennen müssen.
Denn »paradox klingende« Behauptungen wollen weder gleich an-
genommen , noch gleich verworfen werden vor dem Richterstuhle
der Vernunft, welchen ja der Herr Verf. selbst als den einzig gel-
tenden anerkennt. Dass der Mensch, die Zufälligkeit nach dem ge-
wöhnlichen Sprachgebrauch des Wortes: Zufall genommen, kein
zufälliges Wesen ist, wird der Herr Verf. selbst zugeben. Denn
das Zufällige ist hier das Ursachlose und weder das Denken noch
das Sein ist ursachlos. Darum ist auch in diesem Sinne Nichts
zufällig. Die durch die Hegel’sche Philosophie besonders in Schwung
gekommene Sitte, die Worte in einem ganz andern Sinne, als in
dem der Sprache zu nehmen, und dadurch scheinbare Paradoxa zu
fabriciren, ist aber gewiss inkeinerWeiselöblich. So unterscheidet
denn auch der Herr Verf. eben nicht nach dem Sprachgebrauche
seiner Erkenntnisslehre und Ontologie zu Grunde. Alle Principien
oder obersten Grundsätze der praktischen Philosophie werden von
dieser Behauptung abgeleitet. Da, wenn man unter Zufall Ursach-
losigkeit sich vorstellt, in der Welt kein Zufall ist, weil nichts
ohne Ursache ist und wird, so sucht der Hr. Verf. sich wegen dieser
sich durch sein ganzes Werk einem rothen Faden gleich fortziehen-
den Behauptung in der Einleitung zu rechtfertigen. »Der Mensch,
sagt er S. 5, wird als ein zufälliges Wesen bestimmt und da ist
man leicht versucht zu meinen, er werde als ein Wesen gefasst,
welches ursachlos in der Wirklichkeit erscheint, weil man gewohnt
ist, Zufälligkeit mit Ursachlosigkeit zu identifiziren, was philoso-
phisch aus dem einfachen Grunde nicht geschehen kann, weil es
in der Welt keine Ursachlosigkeit, also keinen Zufall in diesem
Sinne geben kann. Von dem, was zufällig im gemeinen Sinn des
Wortes wäre, könnte es überhaupt keine Wissenschaft, höchstens
vernunftwidrige Meinung geben. Bei philosophisch gebildeten Gei-
stern ist diese anthropologische Bessimmung der Gefahr nicht aus-
gesetzt, von vornherein als Erzeugniss einer unphilosophischen Mei-
nung betrachtet zu werden, weil sie gerecht genug sind, erst nach
der Prüfung des ganzen Gedankengauges zu urtheilen; aber denen,
welche sich aus der Verachtung und Erniedrigung der Vernunft
und der Denkuothwendigkeit ein Geschäft gemacht haben, von dem
sie leben, ist eine solche paradox klingende anthropologische Be-
stimmung als Grundlage einer Ethik eine erwünschte Unterlage
für ihre Warnung, dieses rationalistische Buch nicht zu lesen, weil
es schon an der Stirne das Zeichen dei· Schwäche oder Verderbt-
heit der menschlichen Vernunft trage; denn den Menschen als zu-
fälliges Wesen bestimmen, sei nicht blos gottlos, sondern auch eine
Beleidigung der menschlichen Seele«. Immerhin aber wird man,
wenn man auch ferne davon ist, in der Behauptung des Hrn. Verf.
eine »Beleidigung der Seele« oder eine »gottlose« Behauptung
sehen zu wollen und deshalb etwa vor dem Lesen »des rationali-
stischen Buches« den Leser zu warnen, gerade hierin eine Auffor-
derung mehr zum Lesen und Prüfen des Buches erkennen müssen.
Denn »paradox klingende« Behauptungen wollen weder gleich an-
genommen , noch gleich verworfen werden vor dem Richterstuhle
der Vernunft, welchen ja der Herr Verf. selbst als den einzig gel-
tenden anerkennt. Dass der Mensch, die Zufälligkeit nach dem ge-
wöhnlichen Sprachgebrauch des Wortes: Zufall genommen, kein
zufälliges Wesen ist, wird der Herr Verf. selbst zugeben. Denn
das Zufällige ist hier das Ursachlose und weder das Denken noch
das Sein ist ursachlos. Darum ist auch in diesem Sinne Nichts
zufällig. Die durch die Hegel’sche Philosophie besonders in Schwung
gekommene Sitte, die Worte in einem ganz andern Sinne, als in
dem der Sprache zu nehmen, und dadurch scheinbare Paradoxa zu
fabriciren, ist aber gewiss inkeinerWeiselöblich. So unterscheidet
denn auch der Herr Verf. eben nicht nach dem Sprachgebrauche