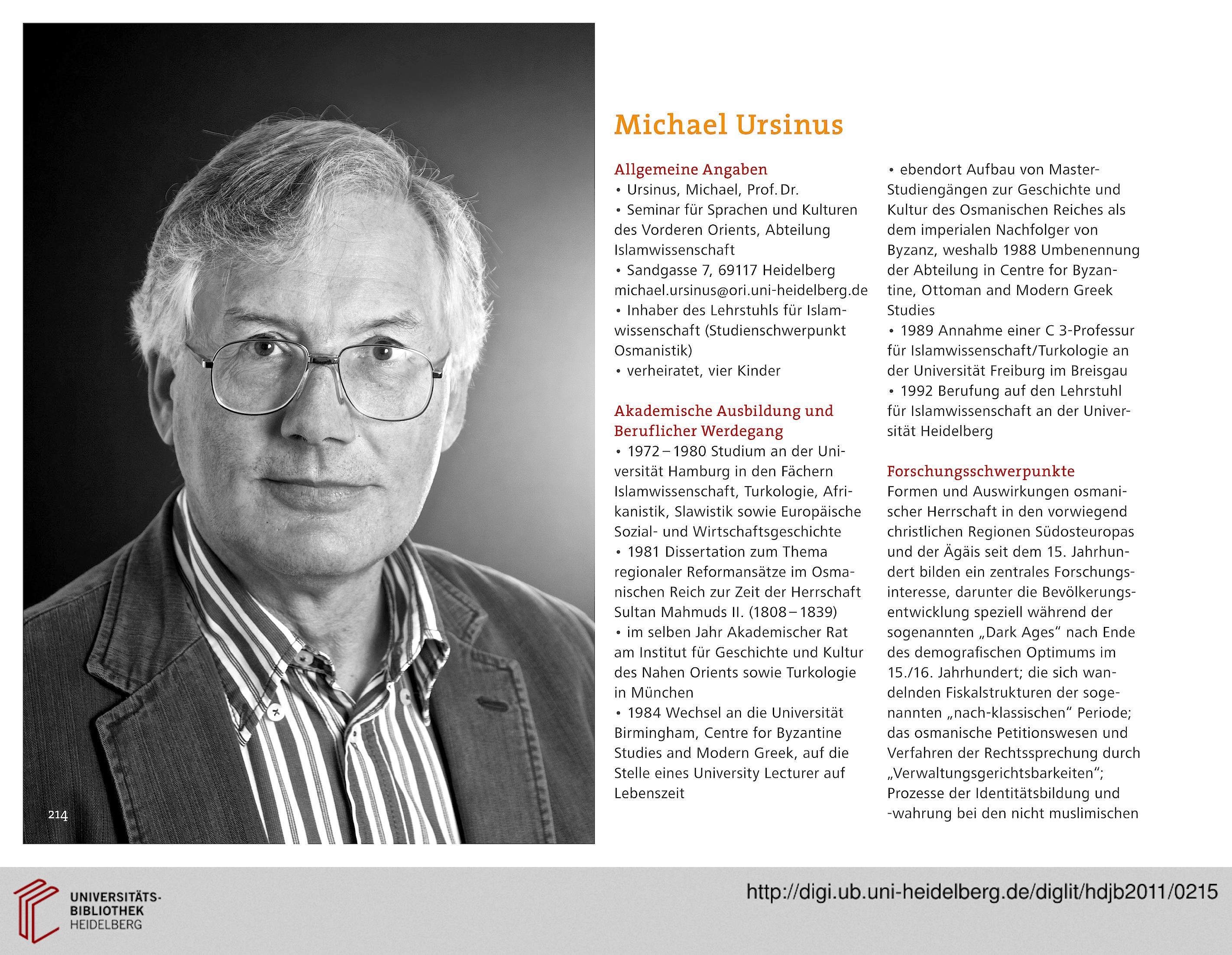Michael Ursinus
Allgemeine Angaben
• Ursinus, Michael, Prof. Dr.
• Seminar fur Sprachen und Kulturen
des Vorderen Orients, Abteilung
Islamwissenschaft
• Sandgasse 7, 69117 Heidelberg
michael.ursinus@ori.uni-heidelberg.de
• Inhaber des Lehrstuhls fur Islam-
wissenschaft (Studienschwerpunkt
Osmanistik)
• verheiratet, vier Kinder
Akademische Ausbildung und
Beruflicher Werdegang
• 1972-1980 Studium an der Uni-
versitat Hamburg in den Fachern
Islamwissenschaft, Turkologie, Afri-
kanistik, Slawistik sowie Europaische
Sozial- und Wirtschaftsgeschichte
• 1981 Dissertation zum Thema
regionaler Reformansatze im Osma-
nischen Reich zur Zeit der Herrschaft
Sultan Mahmuds II. (1808-1839)
• im selben Jahr Akademischer Rat
am Institut fur Geschichte und Kultur
des Nahen Orients sowie Turkologie
in Munchen
• 1984 Wechsel an die Universitat
Birmingham, Centre for Byzantine
Studies and Modern Greek, auf die
Stelle eines University Lecturer auf
Lebenszeit
• ebendort Aufbau von Master-
Studiengangen zur Geschichte und
Kultur des Osmanischen Reiches als
dem imperialen Nachfolger von
Byzanz, weshalb 1988 Umbenennung
der Abteilung in Centre for Byzan-
tine, Ottoman and Modern Greek
Studies
• 1989 Annahme einer C 3-Professur
fur Islamwissenschaft/Turkologie an
der Universitat Freiburg im Breisgau
• 1992 Berufung auf den Lehrstuhl
fur Islamwissenschaft an der Univer-
sitat Heidelberg
Forschungsschwerpunkte
Formen und Auswirkungen osmani-
scher Herrschaft in den vorwiegend
christlichen Regionen Sudosteuropas
und der Agais seit dem 15. Jahrhun-
dert bilden ein zentrales Forschungs-
interesse, darunter die Bevolkerungs-
entwicklung speziell wahrend der
sogenannten „Dark Ages" nach Ende
des demografischen Optimums im
15./16. Jahrhundert; die sich wan-
delnden Fiskalstrukturen der soge-
nannten „nach-klassischen" Periode;
das osmanische Petitionswesen und
Verfahren der Rechtssprechung durch
„Verwaltungsgerichtsbarkeiten";
Prozesse der Identitatsbildung und
-wahrung bei den nicht muslimischen
Allgemeine Angaben
• Ursinus, Michael, Prof. Dr.
• Seminar fur Sprachen und Kulturen
des Vorderen Orients, Abteilung
Islamwissenschaft
• Sandgasse 7, 69117 Heidelberg
michael.ursinus@ori.uni-heidelberg.de
• Inhaber des Lehrstuhls fur Islam-
wissenschaft (Studienschwerpunkt
Osmanistik)
• verheiratet, vier Kinder
Akademische Ausbildung und
Beruflicher Werdegang
• 1972-1980 Studium an der Uni-
versitat Hamburg in den Fachern
Islamwissenschaft, Turkologie, Afri-
kanistik, Slawistik sowie Europaische
Sozial- und Wirtschaftsgeschichte
• 1981 Dissertation zum Thema
regionaler Reformansatze im Osma-
nischen Reich zur Zeit der Herrschaft
Sultan Mahmuds II. (1808-1839)
• im selben Jahr Akademischer Rat
am Institut fur Geschichte und Kultur
des Nahen Orients sowie Turkologie
in Munchen
• 1984 Wechsel an die Universitat
Birmingham, Centre for Byzantine
Studies and Modern Greek, auf die
Stelle eines University Lecturer auf
Lebenszeit
• ebendort Aufbau von Master-
Studiengangen zur Geschichte und
Kultur des Osmanischen Reiches als
dem imperialen Nachfolger von
Byzanz, weshalb 1988 Umbenennung
der Abteilung in Centre for Byzan-
tine, Ottoman and Modern Greek
Studies
• 1989 Annahme einer C 3-Professur
fur Islamwissenschaft/Turkologie an
der Universitat Freiburg im Breisgau
• 1992 Berufung auf den Lehrstuhl
fur Islamwissenschaft an der Univer-
sitat Heidelberg
Forschungsschwerpunkte
Formen und Auswirkungen osmani-
scher Herrschaft in den vorwiegend
christlichen Regionen Sudosteuropas
und der Agais seit dem 15. Jahrhun-
dert bilden ein zentrales Forschungs-
interesse, darunter die Bevolkerungs-
entwicklung speziell wahrend der
sogenannten „Dark Ages" nach Ende
des demografischen Optimums im
15./16. Jahrhundert; die sich wan-
delnden Fiskalstrukturen der soge-
nannten „nach-klassischen" Periode;
das osmanische Petitionswesen und
Verfahren der Rechtssprechung durch
„Verwaltungsgerichtsbarkeiten";
Prozesse der Identitatsbildung und
-wahrung bei den nicht muslimischen