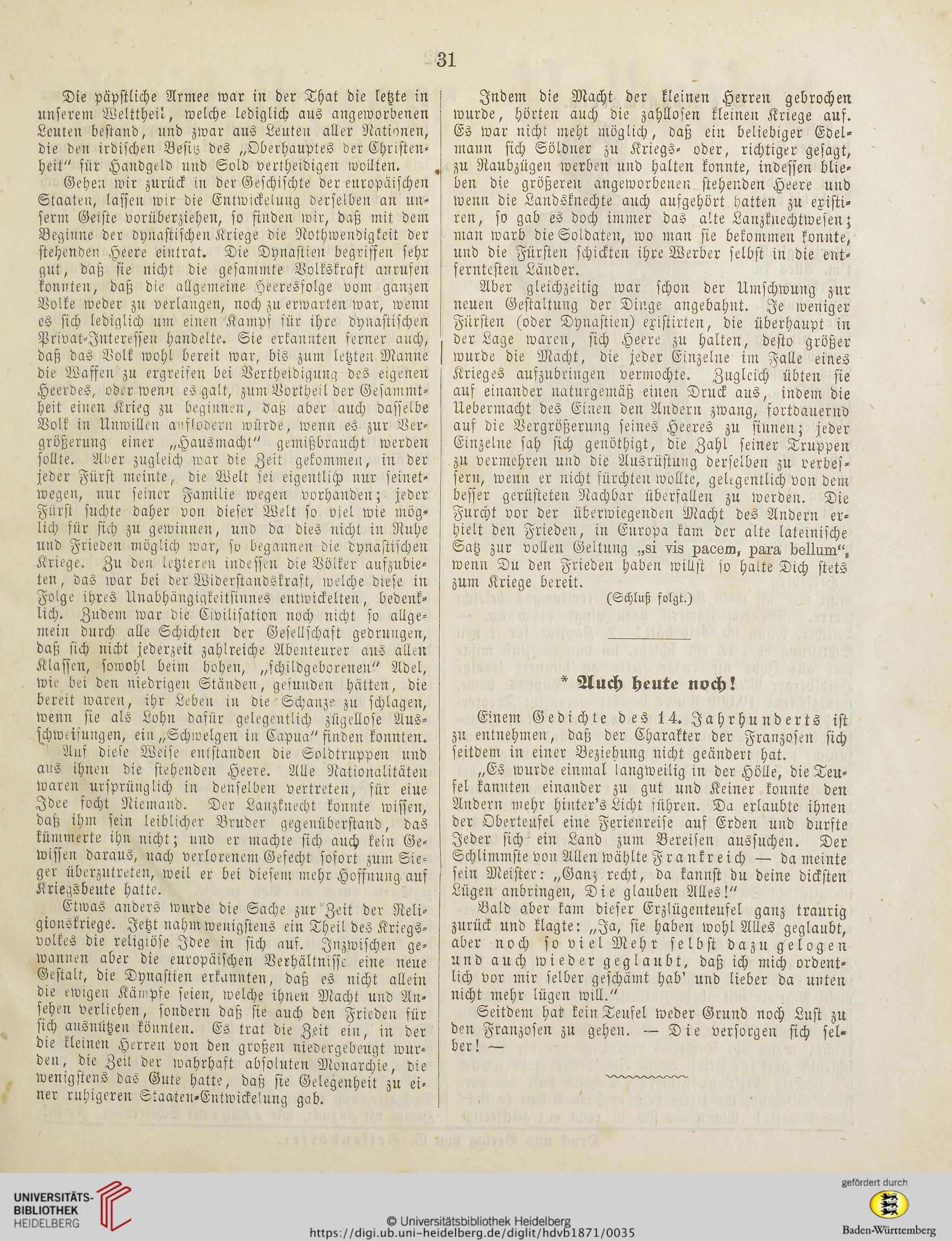31
Die päpſtliche Armee war in der That die letzte in
unſerem Welttheil, welche lediglich aus angeworbenen
Leuten beſtand, und zwar aus Leuten aller Nationen,
die den irdiſchen Beſitz des „Oberhauptes der Chriſten-
heit“ für Handgeld und Sold vertheidigen wollten.
Gehen wir zurück in der Geſchiſchte der europäiſchen
Staaten, laſſen wir die Entwickelung derſelben an un-
ſerm Geiſte vorüberziehen, ſo finden wir, daß mit dem
Beginne der dynaſtiſchen Kriege die Nothwendigkeit der
ſtehenden Heere eintrat. Die Dynaſtien begriffen ſehr
gut, daß ſie nicht die geſammte Volkskraft anrufen
konnten, daß die allgemeine Heeresfolge vom ganzen
Volke weder zu verlangen, noch zu erwarten war, wenn
es ſich lediglich um einen Kampf für ihre dynaſtiſchen
Privat-Intereſſen handelte. Sie erkannten ferner auch,
daß das Volk wohl bereit war, bis zum letzten Manne
die Waffen zu ergreifen bei Vertheidigung des eigenen
Heerdes, oder wenn es galt, zum Vortheil der Geſammt-
heit einen Krieg zu beginnen, daß aber auch daſſelbe
Volk in Unwillen anflodern würde, wenn es zur Ver-
größerung einer „Hausmacht“ gemißbraucht werden
ſollte. Aber zugleich war die Zeit gekommen, in der
jeder Fürſt meinte, die Welt ſei eigentlich nur ſeinet-
wegen, nur ſeiner Familie wegen vorhanden; -jeder
Fürſt ſuchte daher von dieſer Welt ſo viel wie mög⸗—
lich für ſich zu gewinnen, und da dies nicht in Ruhe
und Frieden möglich war, ſo begannen die dynaſtiſchen
Kriege. Zu den letzteren indeſſen die Völker aufzubie-
ten, das war bei der Widerſtandskraft, welche dieſe in
Folge ihres Unabhängigkeitſinnes entwickelten, bedenk-
lich. Zudem war die Civiliſation noch nicht ſo allge-
mein durch alle Schichten der Geſellſchaft gedrungen,
daß ſich nicht jederzeit zahlreiche Abenteurer aus allen
Klaſſen, ſowohl beim hohen, „fchildgeborenen“ Adel,
wie bei den niedrigen Ständen, gefunden hätten, die
bereit waren, ihr Leben in die Schanze zu ſchlagen,
wenn ſie als Lohn dafür gelegentlich zügelloſe Aus-—
ſchweifungen, ein „Schwelgen in Capua“ finden konnten.
Auf dieſe Weiſe entſtanden die Soldtruppen und
aus ihnen die ſtehenden Heere. Alle Nationalitäten
waren urſprünglich in denſelben vertreten, für eine
Idee focht Niemand. Der Lanzknecht konnte wiſſen,
daß ihm ſein leiblicher Bruder gegenüberſtand, das
kümmerte ihn nicht; und er machte ſich auch kein Ge-
wiſſen daraus, nach verlorenem Gefecht ſofort zum Sie-
ger überzutreten, weil er bei dieſem mehr Hoffnung auf
Kriegsbeute hatte.
Etwas anders wurde die Sache zur Zeit der Reli-
gionskriege. Jetzt nahm wenigſtens ein Theil des Kriegs-
volkes die religiöſe Idee in ſich auf. Inzwiſchen ge-
wannen aber die europäiſchen Verhältniſſe eine neue
Geſtalt, die Dynaſtien erkannten, daß es nicht allein
die ewigen Kämpfe ſeien, welche ihnen Macht und An-
ſehen verliehen, ſondern daß ſie auch den Frieden für
ſich ausnützen könnten.
die kleinen Herren von den großen niedergebeugt wur ·
den, die Zeit der wahrhaft abſoluten Monarchie, die
wenigſtens das Gute hatte, daß ſie Gelegenheit zu ei-
ner ruhigeren Staaten⸗Entwickelung gab.
Es trat die Zeit ein, in der
Indem die Macht der kleinen Herren gebrochen
wurde, hörten auch die zahlloſen kleinen Kriege auf.
Es war nicht meht möglich, daß ein beliebiger Edel-
mann ſich Söldner zu Kriegs⸗ oder, richtiger geſagt,
zu Raubzügen werben und halten konnte, indeſſen blie-
ben die größeren angeworbenen ſtehenden Heere und
wenn die Landsknechte auch aufgehört hatten zu exiſti-
ren, ſo gab es doch immer das alte Lanzknechtweſen;
man warb die Soldaten, wo man ſie bekommen konnte,
und die Fürſten ſchickten ihre Werber ſelbſt in die ent-
fernteſten Länder.
Aber gleichzeitig war ſchon der Umſchwung zur
neuen Geſtaltung der Dinge angebahnt. Je weniger
Fürſten (oder Dynaſtien) exiſtirten, die überhaupt in
der Lage waren, ſich Heere zu halten, deſto größer
wurde die Maͤcht, die jeder Einzelne im Falle eines
Krieges aufzubringen vermochte. Zugleich übten ſie
auf einander naturgemäß einen Druck aus, indem die
Uebermacht des Einen den Andern zwang, fortdauernd
auf die Vergrößerung ſeines Heeres zu ſinnen; jeder
Einzelne ſah ſich genöthigt, die Zahl ſeiner Truppen
zu vermehren und die Ausrüſtung derſelben zu verbeſ-
ſern, wenn er nicht fürchten wollte, gelegentlich von dem
beſſer gerüſteten Nachbar überfallen zu werden. Die
Furcht vor der überwiegenden Macht des Andern er-
hielt den Frieden, in Europa kam der alte lateiniſche
Satz zur vollen Geltung „si vis pacem, para bellum“,
wenn Du den Frieden haben willſt ſo halte Dich ſtets
zum Kriege bereit.
(Schluß folgt.)
* Auch heute noch!
Einem Gedichte des 14. Jahrhunderts iſt
zu entnehmen, daß der Charakter der Franzoſen ſich
ſeitdem in einer Beziehung nicht geändert hat.
„Es wurde einmal langweilig in der Hölle, die Teu-
fel kannten einander zu gut und Keiner konnte den
Andern mehr hinter's Licht führen. Da erlaubte ihnen
der Oberteufel eine Ferienreiſe auf Erden und durfte
Jeder ſich ein Land zum Bereiſen ausſuchen. Der
Schlimmſte von Allen wählte Frankreich — da meinte
ſein Meiſter: „Ganz recht, da kannſt du deine dickſten
Lügen anbringen, Die glauben Alles!“
Bald aber kam dieſer Erzlügenteufel ganz traurig
zurück und klagte: „Ja, ſie haben wohl Alles geglaubt,
aber noch ſo viel Mehr ſelbſt dazu gelogen
und auch wieder geglaubt, daß ich mich ordent-
lich vor mir ſelber geſchämt hab' und lieber da unten
nicht mehr lügen will.“
Seitdem har kein Teufel weder Grund noch Luſt zu
ben, ranzoſen zu gehen. — Die verſorgen ſich ſel-
er! —
Die päpſtliche Armee war in der That die letzte in
unſerem Welttheil, welche lediglich aus angeworbenen
Leuten beſtand, und zwar aus Leuten aller Nationen,
die den irdiſchen Beſitz des „Oberhauptes der Chriſten-
heit“ für Handgeld und Sold vertheidigen wollten.
Gehen wir zurück in der Geſchiſchte der europäiſchen
Staaten, laſſen wir die Entwickelung derſelben an un-
ſerm Geiſte vorüberziehen, ſo finden wir, daß mit dem
Beginne der dynaſtiſchen Kriege die Nothwendigkeit der
ſtehenden Heere eintrat. Die Dynaſtien begriffen ſehr
gut, daß ſie nicht die geſammte Volkskraft anrufen
konnten, daß die allgemeine Heeresfolge vom ganzen
Volke weder zu verlangen, noch zu erwarten war, wenn
es ſich lediglich um einen Kampf für ihre dynaſtiſchen
Privat-Intereſſen handelte. Sie erkannten ferner auch,
daß das Volk wohl bereit war, bis zum letzten Manne
die Waffen zu ergreifen bei Vertheidigung des eigenen
Heerdes, oder wenn es galt, zum Vortheil der Geſammt-
heit einen Krieg zu beginnen, daß aber auch daſſelbe
Volk in Unwillen anflodern würde, wenn es zur Ver-
größerung einer „Hausmacht“ gemißbraucht werden
ſollte. Aber zugleich war die Zeit gekommen, in der
jeder Fürſt meinte, die Welt ſei eigentlich nur ſeinet-
wegen, nur ſeiner Familie wegen vorhanden; -jeder
Fürſt ſuchte daher von dieſer Welt ſo viel wie mög⸗—
lich für ſich zu gewinnen, und da dies nicht in Ruhe
und Frieden möglich war, ſo begannen die dynaſtiſchen
Kriege. Zu den letzteren indeſſen die Völker aufzubie-
ten, das war bei der Widerſtandskraft, welche dieſe in
Folge ihres Unabhängigkeitſinnes entwickelten, bedenk-
lich. Zudem war die Civiliſation noch nicht ſo allge-
mein durch alle Schichten der Geſellſchaft gedrungen,
daß ſich nicht jederzeit zahlreiche Abenteurer aus allen
Klaſſen, ſowohl beim hohen, „fchildgeborenen“ Adel,
wie bei den niedrigen Ständen, gefunden hätten, die
bereit waren, ihr Leben in die Schanze zu ſchlagen,
wenn ſie als Lohn dafür gelegentlich zügelloſe Aus-—
ſchweifungen, ein „Schwelgen in Capua“ finden konnten.
Auf dieſe Weiſe entſtanden die Soldtruppen und
aus ihnen die ſtehenden Heere. Alle Nationalitäten
waren urſprünglich in denſelben vertreten, für eine
Idee focht Niemand. Der Lanzknecht konnte wiſſen,
daß ihm ſein leiblicher Bruder gegenüberſtand, das
kümmerte ihn nicht; und er machte ſich auch kein Ge-
wiſſen daraus, nach verlorenem Gefecht ſofort zum Sie-
ger überzutreten, weil er bei dieſem mehr Hoffnung auf
Kriegsbeute hatte.
Etwas anders wurde die Sache zur Zeit der Reli-
gionskriege. Jetzt nahm wenigſtens ein Theil des Kriegs-
volkes die religiöſe Idee in ſich auf. Inzwiſchen ge-
wannen aber die europäiſchen Verhältniſſe eine neue
Geſtalt, die Dynaſtien erkannten, daß es nicht allein
die ewigen Kämpfe ſeien, welche ihnen Macht und An-
ſehen verliehen, ſondern daß ſie auch den Frieden für
ſich ausnützen könnten.
die kleinen Herren von den großen niedergebeugt wur ·
den, die Zeit der wahrhaft abſoluten Monarchie, die
wenigſtens das Gute hatte, daß ſie Gelegenheit zu ei-
ner ruhigeren Staaten⸗Entwickelung gab.
Es trat die Zeit ein, in der
Indem die Macht der kleinen Herren gebrochen
wurde, hörten auch die zahlloſen kleinen Kriege auf.
Es war nicht meht möglich, daß ein beliebiger Edel-
mann ſich Söldner zu Kriegs⸗ oder, richtiger geſagt,
zu Raubzügen werben und halten konnte, indeſſen blie-
ben die größeren angeworbenen ſtehenden Heere und
wenn die Landsknechte auch aufgehört hatten zu exiſti-
ren, ſo gab es doch immer das alte Lanzknechtweſen;
man warb die Soldaten, wo man ſie bekommen konnte,
und die Fürſten ſchickten ihre Werber ſelbſt in die ent-
fernteſten Länder.
Aber gleichzeitig war ſchon der Umſchwung zur
neuen Geſtaltung der Dinge angebahnt. Je weniger
Fürſten (oder Dynaſtien) exiſtirten, die überhaupt in
der Lage waren, ſich Heere zu halten, deſto größer
wurde die Maͤcht, die jeder Einzelne im Falle eines
Krieges aufzubringen vermochte. Zugleich übten ſie
auf einander naturgemäß einen Druck aus, indem die
Uebermacht des Einen den Andern zwang, fortdauernd
auf die Vergrößerung ſeines Heeres zu ſinnen; jeder
Einzelne ſah ſich genöthigt, die Zahl ſeiner Truppen
zu vermehren und die Ausrüſtung derſelben zu verbeſ-
ſern, wenn er nicht fürchten wollte, gelegentlich von dem
beſſer gerüſteten Nachbar überfallen zu werden. Die
Furcht vor der überwiegenden Macht des Andern er-
hielt den Frieden, in Europa kam der alte lateiniſche
Satz zur vollen Geltung „si vis pacem, para bellum“,
wenn Du den Frieden haben willſt ſo halte Dich ſtets
zum Kriege bereit.
(Schluß folgt.)
* Auch heute noch!
Einem Gedichte des 14. Jahrhunderts iſt
zu entnehmen, daß der Charakter der Franzoſen ſich
ſeitdem in einer Beziehung nicht geändert hat.
„Es wurde einmal langweilig in der Hölle, die Teu-
fel kannten einander zu gut und Keiner konnte den
Andern mehr hinter's Licht führen. Da erlaubte ihnen
der Oberteufel eine Ferienreiſe auf Erden und durfte
Jeder ſich ein Land zum Bereiſen ausſuchen. Der
Schlimmſte von Allen wählte Frankreich — da meinte
ſein Meiſter: „Ganz recht, da kannſt du deine dickſten
Lügen anbringen, Die glauben Alles!“
Bald aber kam dieſer Erzlügenteufel ganz traurig
zurück und klagte: „Ja, ſie haben wohl Alles geglaubt,
aber noch ſo viel Mehr ſelbſt dazu gelogen
und auch wieder geglaubt, daß ich mich ordent-
lich vor mir ſelber geſchämt hab' und lieber da unten
nicht mehr lügen will.“
Seitdem har kein Teufel weder Grund noch Luſt zu
ben, ranzoſen zu gehen. — Die verſorgen ſich ſel-
er! —