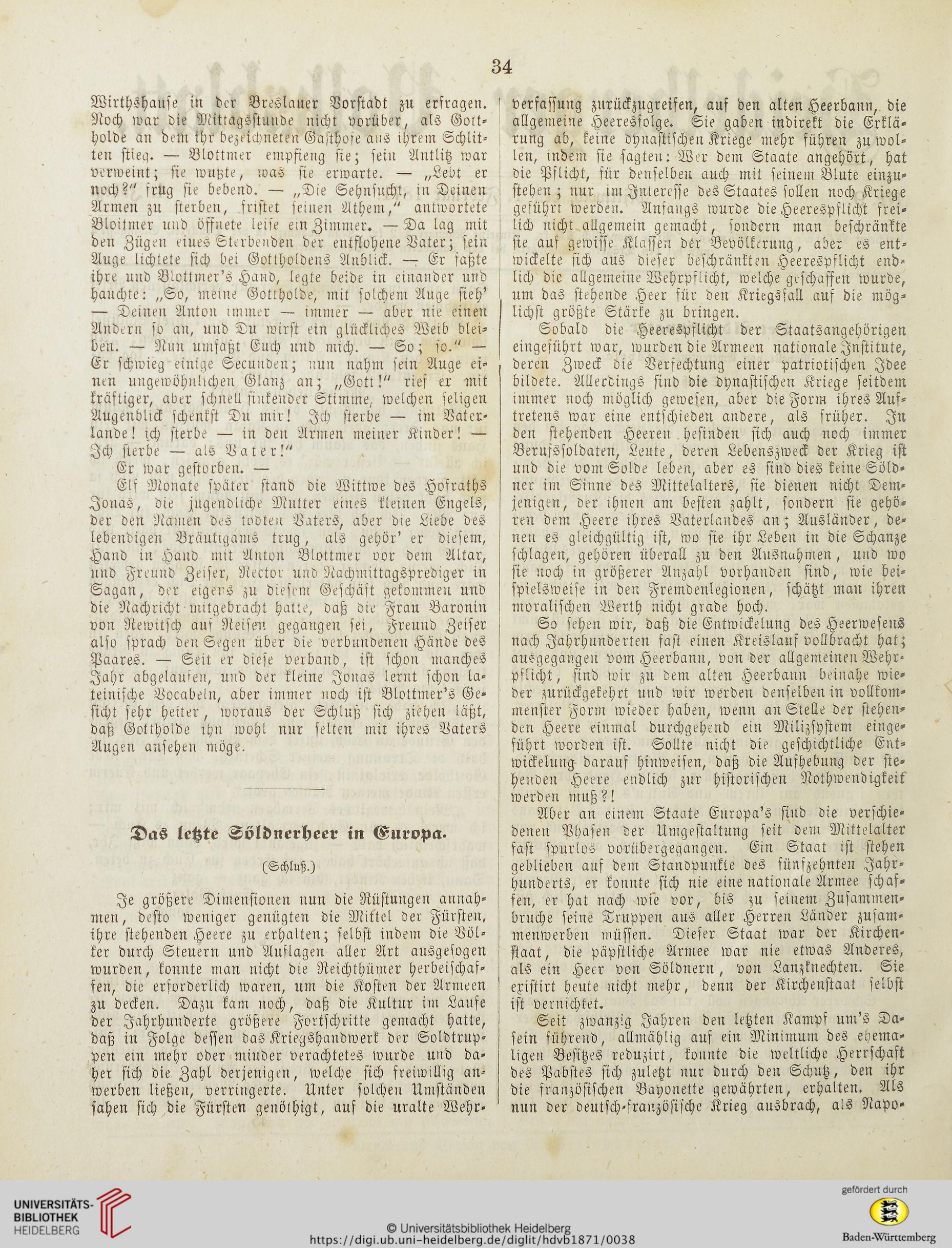Wirthshauſe in der Breslauer Vorſtadt zu erfragen.
Noch war die Mittagsſtunde nicht vorüber, als Gott⸗—
holde an dem ihr bezeichneten Gaſthofe aus ihrem Schlit-
ten ſtieg. — Blottmer empfieng ſie; ſein Antlitz war
verweint; ſie wußte, was ſie erwarte. — „Lebt er
noch?“ frug ſie bebend. — „Die Sehnſucht, in Deinen
Armen zu ſterben, friſtet ſeinen Athem,“ antwortete
Bloitmer und öffnete leiſe ein Zimmer. — Da lag mit
den Zügen eiunes Sterbenden der entflohene Vater; ſein
Auge lichtete ſich bei Gottholdens Anblick. — Er faßte
ihre und Blottmer's Hand, legte beide in einander und
hauchte: „So, meine Gottholde, mit ſolchem Auge ſieh'
— Deinen Anton immer — immer — aber nie einen
Andern ſo an, und Du wirſt ein glückliches Weib blei-
ben. — Nun umfaßt Euch und mich. — So; ſo.“ —
Er ſchwieg einige Secunden; nun nahm ſein Auge ei-
nen ungewöhnlichen Glanz an; „Gott!“ rief er mit
kräftiger, aber ſchnell fſinkender Stimme, welchen ſeligen
Augenblick ſchenkſt Du mir! Ich ſterbe — im Vater-
lande! ich ſterbe — in den Armen meiner Kinder! —
Ich ſterbe — als Vater!“
Er war geſtorben. —
Elf Monate ſpäter ſtand die Wittwe des Hofraths
Jonas, die jugendliche Mutter eines kleinen Engels,
der den Namen des todten Vaters, aber die Liebe des
lebendigen Bräutigams trug, als gehör' er dieſem,
Hand in Hand mit Anton Blottmer vor dem Altar,
und Freund Zeiſer, Rector und Nachmittagsprediger in
Sagan, der eigens zu dieſem Geſchäft gekommen und
die Nachricht mitgebracht hatte, daß die Frau Baronin
von Rewitſch auf Reiſen gegangen ſei, Freund Zeiſer
alſo ſprach den Segen über die verbundenen Hände des
Paares. — Seit er dieſe verband, iſt ſchon manches
Jahr abgelaufen, und der kleine Jonas lernt ſchon la-
teiniſche Vocabeln, aber immer noch iſt Blottmer's Ge-
ſicht ſehr heiter, woraus der Schluß ſich ziehen läßt,
daß Gottholde ihn wohl nur ſelten mit ihres Vaters
Augen anſehen möge. ö
Das letzte Söldnerheer in Europa.
Schluß.)
Je größere Dimenſionen nun die Rüſtungen annah-
men, deſto weniger genügten die Mittel der Fürſten,
ihre ſtehenden Heere zu erhalten; ſelbſt indem die Völ-
ker durch Steuern und Auflagen aller Art ausgeſogen
wurden, konnte man nicht die Reichthümer herbeiſchaf-
fen, die erforderlich waren, um die Koſten der Armeen
zu decken. Dazu kam noch, daß die Kultur im Laufe
der Jahrhunderte größere Fortſchritte gemacht hatte,
daß in Folge deſſen das Kriegshandwerk der Soldtrup⸗—
pen ein mehr oder miuder verachtetes wurde und da-
her ſich die Zahl derjenigen, welche ſich freiwillig an-
werben ließen, verringerte. Unter ſolchen Umſtänden
ſahen ſich die Fürſten genöthigt, auf die uralte Wehr-
faſt ſpurlos vorübergegangen.
verfaſſung zurückzugreifen, auf den alten Heerbann, die
allgemeine Heeresfolge. Sie gaben indirekt die Erklä-
rung ab, keine dynaſtiſchen Kriege mehr führen zu wol-
len, indem ſie ſagten: Wer dem Staate angehört, hat
die Pflicht, für denſelben auch mit ſeinem Blute einzu-
ſtehen; nur im Intereſſe des Staates ſollen noch Kriege
geführt werden. Anfangs wurde die Heerespflicht frei-
lich nicht allgemein gemacht, ſondern man beſchränkte
ſie auf gewiſſe Klaſſen der Bevölkerung, aber es ent-
wickelte ſich aus dieſer beſchränkten Heerespflicht end-
lich die allgemeine Wehrpflicht, welche geſchaffen wurde,
um das ſtehende Heer für den Kriegsfall auf die mög-
lichſt größte Stärke zu bringen.
Sobald die Heerespflicht der Staatsangehörigen
eingeführt war, wurden die Armeen nationale Inſtitute,
deren Zweck die Verfechtung einer patriotiſchen Idee
bildete. Allerdings ſind die dynaſtiſchen Kriege ſeitdem
immer noch möglich geweſen, aber die Form ihres Auf-
tretens war eine entſchieden andere, als früher. In
den ſtehenden Heeren heſinden ſich auch noch immer
Berufsſoldaten, Leute, deren Lebenszweck der Krieg iſt
und die vom Solde leben, aber es ſind dies keine Söld-
ner im Sinne des Mittelalters, ſie dienen nicht Dem-—
jenigen, der ihnen am beſten zahlt, ſondern ſie gehö-
ren dem Heere ihres Vaterlandes an; Ausländer, de-
nen es gleichgültig iſt, wo ſie ihr Leben in die Schanze
ſchlagen, gehören überall zu den Ausnahmen, und wo
ſie noch in größerer Anzahl vorhanden ſind, wie bei-
ſpielsweiſe in den Fremdenlegionen, ſchätzt man ihren
moraliſchen Werth nicht grade hoch.
So ſehen wir, daß die Entwickelung des Heerweſens
nach Jahrhunderten faſt einen Kreislauf vollbracht hat;
ausgegangen vom Heerbann, von der allgemeinen Wehr-
pflicht, ſind wir zu dem alten Heerbann beinahe wie-
der zurückgekehrt und wir werden denſelben in vollkom-
menſter Form wieder haben, wenn an Stelle der ſtehen-
den Heere einmal durchgehend ein Milizſyſtem einge-
führt worden iſt. Sollte nicht die geſchichtliche Ent-
wickelung darauf hinweiſen, daß die Aufhebung der ſte-
henden Heere endlich zur hiſtoriſchen Nothwendigkeit
werden muß?!
Aber an einem Staate Europa's ſind die verſchie-
denen Phaſen der Umgeſtaltung ſeit dem Mittelalter
Ein Staat iſt ſtehen
geblieben auf dem Standpunkte des fünfzehnten Jahr-
hunderts, er konnte ſich nie eine nationale Armee ſchaf-
fen, er hat nach wie vor, bis zu ſeinem Zuſammen-
bruche ſeine Truppen aus aller Herren Länder zuſam-
menwerben wüſſen. Dieſer Staat war der Kirchen-
ſtaat, die päpſtliche Armee war nie etwas Anderes,
als ein Heer von Söldnern, von Lanzknechten. Sie
exiſtirt heute nicht mehr, denn der Kirchenſtaat ſelbſt
iſt vernichtet.
Seit zwanzig Jahren den letzten Kampf um's Da⸗-
ſein führend, allmählig auf ein Minimum des ehema-
ligen Beſitzes reduzirt, konnte die weltliche Herrſchaft
des Pabſtes ſich zuletzt nur durch den Schutz, den ihr
die franzöſiſchen Bayonette gewährten, erhalten. Als
nun der deutſch⸗franzöſiſche Krieg ausbrach, als Napo-—
Noch war die Mittagsſtunde nicht vorüber, als Gott⸗—
holde an dem ihr bezeichneten Gaſthofe aus ihrem Schlit-
ten ſtieg. — Blottmer empfieng ſie; ſein Antlitz war
verweint; ſie wußte, was ſie erwarte. — „Lebt er
noch?“ frug ſie bebend. — „Die Sehnſucht, in Deinen
Armen zu ſterben, friſtet ſeinen Athem,“ antwortete
Bloitmer und öffnete leiſe ein Zimmer. — Da lag mit
den Zügen eiunes Sterbenden der entflohene Vater; ſein
Auge lichtete ſich bei Gottholdens Anblick. — Er faßte
ihre und Blottmer's Hand, legte beide in einander und
hauchte: „So, meine Gottholde, mit ſolchem Auge ſieh'
— Deinen Anton immer — immer — aber nie einen
Andern ſo an, und Du wirſt ein glückliches Weib blei-
ben. — Nun umfaßt Euch und mich. — So; ſo.“ —
Er ſchwieg einige Secunden; nun nahm ſein Auge ei-
nen ungewöhnlichen Glanz an; „Gott!“ rief er mit
kräftiger, aber ſchnell fſinkender Stimme, welchen ſeligen
Augenblick ſchenkſt Du mir! Ich ſterbe — im Vater-
lande! ich ſterbe — in den Armen meiner Kinder! —
Ich ſterbe — als Vater!“
Er war geſtorben. —
Elf Monate ſpäter ſtand die Wittwe des Hofraths
Jonas, die jugendliche Mutter eines kleinen Engels,
der den Namen des todten Vaters, aber die Liebe des
lebendigen Bräutigams trug, als gehör' er dieſem,
Hand in Hand mit Anton Blottmer vor dem Altar,
und Freund Zeiſer, Rector und Nachmittagsprediger in
Sagan, der eigens zu dieſem Geſchäft gekommen und
die Nachricht mitgebracht hatte, daß die Frau Baronin
von Rewitſch auf Reiſen gegangen ſei, Freund Zeiſer
alſo ſprach den Segen über die verbundenen Hände des
Paares. — Seit er dieſe verband, iſt ſchon manches
Jahr abgelaufen, und der kleine Jonas lernt ſchon la-
teiniſche Vocabeln, aber immer noch iſt Blottmer's Ge-
ſicht ſehr heiter, woraus der Schluß ſich ziehen läßt,
daß Gottholde ihn wohl nur ſelten mit ihres Vaters
Augen anſehen möge. ö
Das letzte Söldnerheer in Europa.
Schluß.)
Je größere Dimenſionen nun die Rüſtungen annah-
men, deſto weniger genügten die Mittel der Fürſten,
ihre ſtehenden Heere zu erhalten; ſelbſt indem die Völ-
ker durch Steuern und Auflagen aller Art ausgeſogen
wurden, konnte man nicht die Reichthümer herbeiſchaf-
fen, die erforderlich waren, um die Koſten der Armeen
zu decken. Dazu kam noch, daß die Kultur im Laufe
der Jahrhunderte größere Fortſchritte gemacht hatte,
daß in Folge deſſen das Kriegshandwerk der Soldtrup⸗—
pen ein mehr oder miuder verachtetes wurde und da-
her ſich die Zahl derjenigen, welche ſich freiwillig an-
werben ließen, verringerte. Unter ſolchen Umſtänden
ſahen ſich die Fürſten genöthigt, auf die uralte Wehr-
faſt ſpurlos vorübergegangen.
verfaſſung zurückzugreifen, auf den alten Heerbann, die
allgemeine Heeresfolge. Sie gaben indirekt die Erklä-
rung ab, keine dynaſtiſchen Kriege mehr führen zu wol-
len, indem ſie ſagten: Wer dem Staate angehört, hat
die Pflicht, für denſelben auch mit ſeinem Blute einzu-
ſtehen; nur im Intereſſe des Staates ſollen noch Kriege
geführt werden. Anfangs wurde die Heerespflicht frei-
lich nicht allgemein gemacht, ſondern man beſchränkte
ſie auf gewiſſe Klaſſen der Bevölkerung, aber es ent-
wickelte ſich aus dieſer beſchränkten Heerespflicht end-
lich die allgemeine Wehrpflicht, welche geſchaffen wurde,
um das ſtehende Heer für den Kriegsfall auf die mög-
lichſt größte Stärke zu bringen.
Sobald die Heerespflicht der Staatsangehörigen
eingeführt war, wurden die Armeen nationale Inſtitute,
deren Zweck die Verfechtung einer patriotiſchen Idee
bildete. Allerdings ſind die dynaſtiſchen Kriege ſeitdem
immer noch möglich geweſen, aber die Form ihres Auf-
tretens war eine entſchieden andere, als früher. In
den ſtehenden Heeren heſinden ſich auch noch immer
Berufsſoldaten, Leute, deren Lebenszweck der Krieg iſt
und die vom Solde leben, aber es ſind dies keine Söld-
ner im Sinne des Mittelalters, ſie dienen nicht Dem-—
jenigen, der ihnen am beſten zahlt, ſondern ſie gehö-
ren dem Heere ihres Vaterlandes an; Ausländer, de-
nen es gleichgültig iſt, wo ſie ihr Leben in die Schanze
ſchlagen, gehören überall zu den Ausnahmen, und wo
ſie noch in größerer Anzahl vorhanden ſind, wie bei-
ſpielsweiſe in den Fremdenlegionen, ſchätzt man ihren
moraliſchen Werth nicht grade hoch.
So ſehen wir, daß die Entwickelung des Heerweſens
nach Jahrhunderten faſt einen Kreislauf vollbracht hat;
ausgegangen vom Heerbann, von der allgemeinen Wehr-
pflicht, ſind wir zu dem alten Heerbann beinahe wie-
der zurückgekehrt und wir werden denſelben in vollkom-
menſter Form wieder haben, wenn an Stelle der ſtehen-
den Heere einmal durchgehend ein Milizſyſtem einge-
führt worden iſt. Sollte nicht die geſchichtliche Ent-
wickelung darauf hinweiſen, daß die Aufhebung der ſte-
henden Heere endlich zur hiſtoriſchen Nothwendigkeit
werden muß?!
Aber an einem Staate Europa's ſind die verſchie-
denen Phaſen der Umgeſtaltung ſeit dem Mittelalter
Ein Staat iſt ſtehen
geblieben auf dem Standpunkte des fünfzehnten Jahr-
hunderts, er konnte ſich nie eine nationale Armee ſchaf-
fen, er hat nach wie vor, bis zu ſeinem Zuſammen-
bruche ſeine Truppen aus aller Herren Länder zuſam-
menwerben wüſſen. Dieſer Staat war der Kirchen-
ſtaat, die päpſtliche Armee war nie etwas Anderes,
als ein Heer von Söldnern, von Lanzknechten. Sie
exiſtirt heute nicht mehr, denn der Kirchenſtaat ſelbſt
iſt vernichtet.
Seit zwanzig Jahren den letzten Kampf um's Da⸗-
ſein führend, allmählig auf ein Minimum des ehema-
ligen Beſitzes reduzirt, konnte die weltliche Herrſchaft
des Pabſtes ſich zuletzt nur durch den Schutz, den ihr
die franzöſiſchen Bayonette gewährten, erhalten. Als
nun der deutſch⸗franzöſiſche Krieg ausbrach, als Napo-—