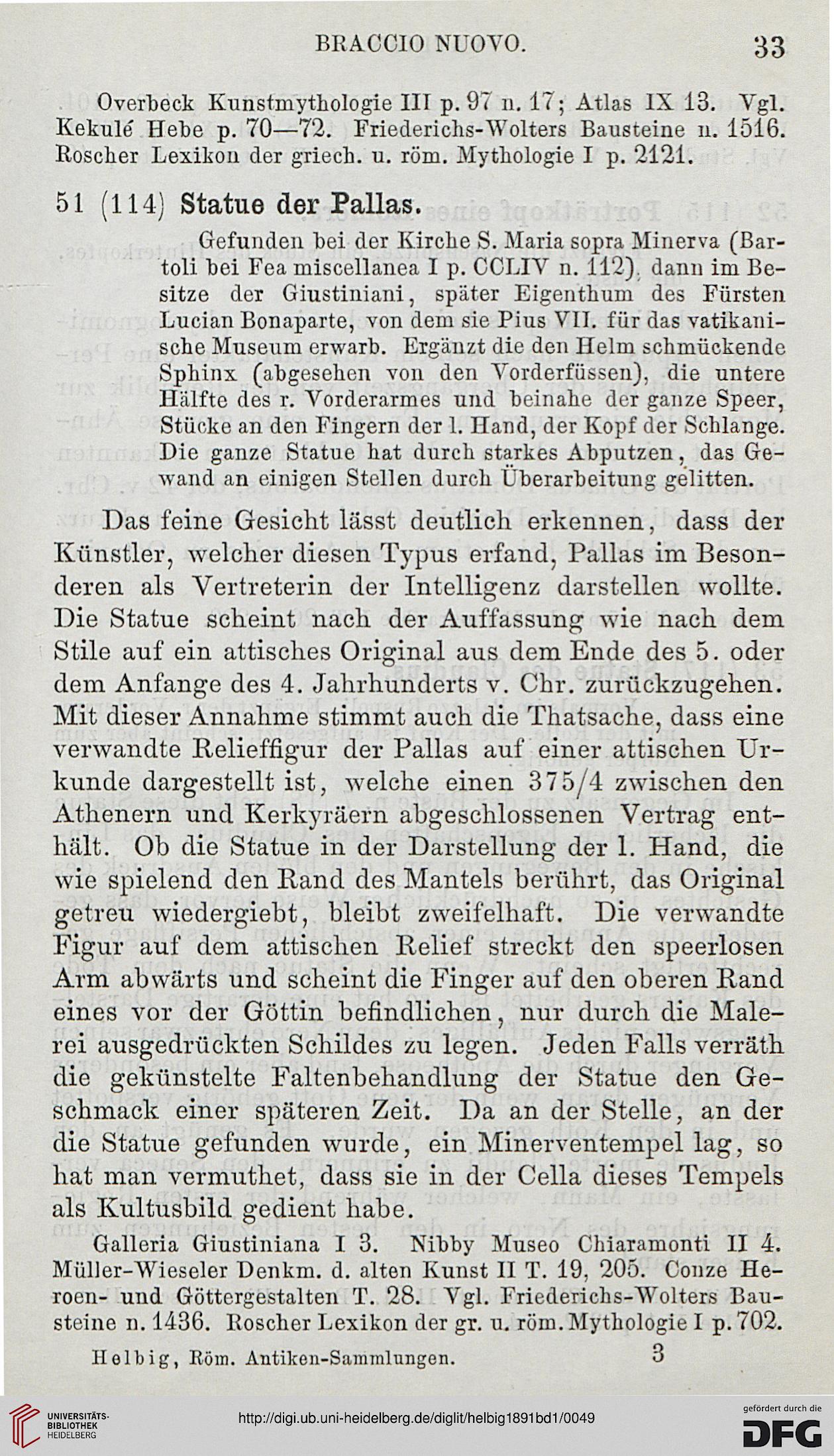BRACCIO NUOVO. 33
Overbeck Kunstmythologie III p. 97 n. 17; Atlas IX 13. Vgl.
Kekule' Hebe p. 70—72. Friederichs-Wolters Bausteine n. 1516.
Roscher Lexikon der griech. ti. röm. Mythologie I p. 2121.
51 (114) Statue der Pallas.
Gefunden bei der Kirche S. Maria sopra Minerva (Bar-
toli bei Fea miscellanea I p. CCLIV n. 112). dann im Be-
sitze der Giustiniani, später Eigenthum des Fürsten
Lucian Bonaparte, von dem sie Pius VII. für das vatikani-
sche Museum erwarb. Ergänzt die den Helm schmückende
Sphinx (abgesehen von den Vorderfüssen), die untere
Hälfte des r. Vorderarmes und beinahe der ganze Speer,
Stücke an den Fingern der 1. Hand, der Kopf der Schlange.
Die ganze Statue hat durch starkes Abputzen, das Ge-
wand an einigen Stellen durch Überarbeitung gelitten.
Das feine Gesieht lässt deutlich erkennen, dass der
Künstler, welcher diesen Typus erfand, Pallas im Beson-
deren als Vertreterin der Intelligenz darstellen wollte.
Die Statue scheint nach der Auffassung wie nach dem
Stile auf ein attisches Original aus dem Ende des 5. oder
dem Anfange des 4. Jahrhunderts v. Chr. zurückzugehen.
Mit dieser Annahme stimmt auch die Thatsache, dass eine
verwandte Relieffigur der Pallas auf einer attischen Ur-
kunde dargestellt ist, welche einen 375/4 zwischen den
Athenern und Kerkyräern abgeschlossenen Vertrag ent-
hält. Ob die Statue in der Darstellung der 1. Hand, die
wie spielend den Rand des Mantels berührt, das Original
getreu wiedergiebt, bleibt zweifelhaft. Die verwandte
Figur auf dem attischen Relief streckt den speerlosen
Arm abwärts und scheint die Finger auf den oberen Rand
eines vor der Göttin befindlichen, nur durch die Male-
rei ausgedrückten Schildes zu legen. Jeden Falls verräth
die gekünstelte Faltenbehandlung der Statue den Ge-
schmack einer späteren Zeit. Da an der Stelle, an der
die Statue gefunden wurde, ein Minerventempel lag, so
hat man vermuthet, dass sie in der Cella dieses Tempels
als Kultusbild gedient habe.
Galleria Giustiniana I 3. Nibby Museo Chiaramonti II 4.
Müller-Wieseler Denkm. d. alten Kunst II T. 19, 205. Conze He-
roen- und Göttcrgestalten T. 28. Vgl. Friederichs-Wolters Bau-
steine n. 1436. Roscher Lexikon der gr. u. röm. Mythologie I p. 702.
Holbig, Röm. Antiken-Sammlungen. 3
Overbeck Kunstmythologie III p. 97 n. 17; Atlas IX 13. Vgl.
Kekule' Hebe p. 70—72. Friederichs-Wolters Bausteine n. 1516.
Roscher Lexikon der griech. ti. röm. Mythologie I p. 2121.
51 (114) Statue der Pallas.
Gefunden bei der Kirche S. Maria sopra Minerva (Bar-
toli bei Fea miscellanea I p. CCLIV n. 112). dann im Be-
sitze der Giustiniani, später Eigenthum des Fürsten
Lucian Bonaparte, von dem sie Pius VII. für das vatikani-
sche Museum erwarb. Ergänzt die den Helm schmückende
Sphinx (abgesehen von den Vorderfüssen), die untere
Hälfte des r. Vorderarmes und beinahe der ganze Speer,
Stücke an den Fingern der 1. Hand, der Kopf der Schlange.
Die ganze Statue hat durch starkes Abputzen, das Ge-
wand an einigen Stellen durch Überarbeitung gelitten.
Das feine Gesieht lässt deutlich erkennen, dass der
Künstler, welcher diesen Typus erfand, Pallas im Beson-
deren als Vertreterin der Intelligenz darstellen wollte.
Die Statue scheint nach der Auffassung wie nach dem
Stile auf ein attisches Original aus dem Ende des 5. oder
dem Anfange des 4. Jahrhunderts v. Chr. zurückzugehen.
Mit dieser Annahme stimmt auch die Thatsache, dass eine
verwandte Relieffigur der Pallas auf einer attischen Ur-
kunde dargestellt ist, welche einen 375/4 zwischen den
Athenern und Kerkyräern abgeschlossenen Vertrag ent-
hält. Ob die Statue in der Darstellung der 1. Hand, die
wie spielend den Rand des Mantels berührt, das Original
getreu wiedergiebt, bleibt zweifelhaft. Die verwandte
Figur auf dem attischen Relief streckt den speerlosen
Arm abwärts und scheint die Finger auf den oberen Rand
eines vor der Göttin befindlichen, nur durch die Male-
rei ausgedrückten Schildes zu legen. Jeden Falls verräth
die gekünstelte Faltenbehandlung der Statue den Ge-
schmack einer späteren Zeit. Da an der Stelle, an der
die Statue gefunden wurde, ein Minerventempel lag, so
hat man vermuthet, dass sie in der Cella dieses Tempels
als Kultusbild gedient habe.
Galleria Giustiniana I 3. Nibby Museo Chiaramonti II 4.
Müller-Wieseler Denkm. d. alten Kunst II T. 19, 205. Conze He-
roen- und Göttcrgestalten T. 28. Vgl. Friederichs-Wolters Bau-
steine n. 1436. Roscher Lexikon der gr. u. röm. Mythologie I p. 702.
Holbig, Röm. Antiken-Sammlungen. 3