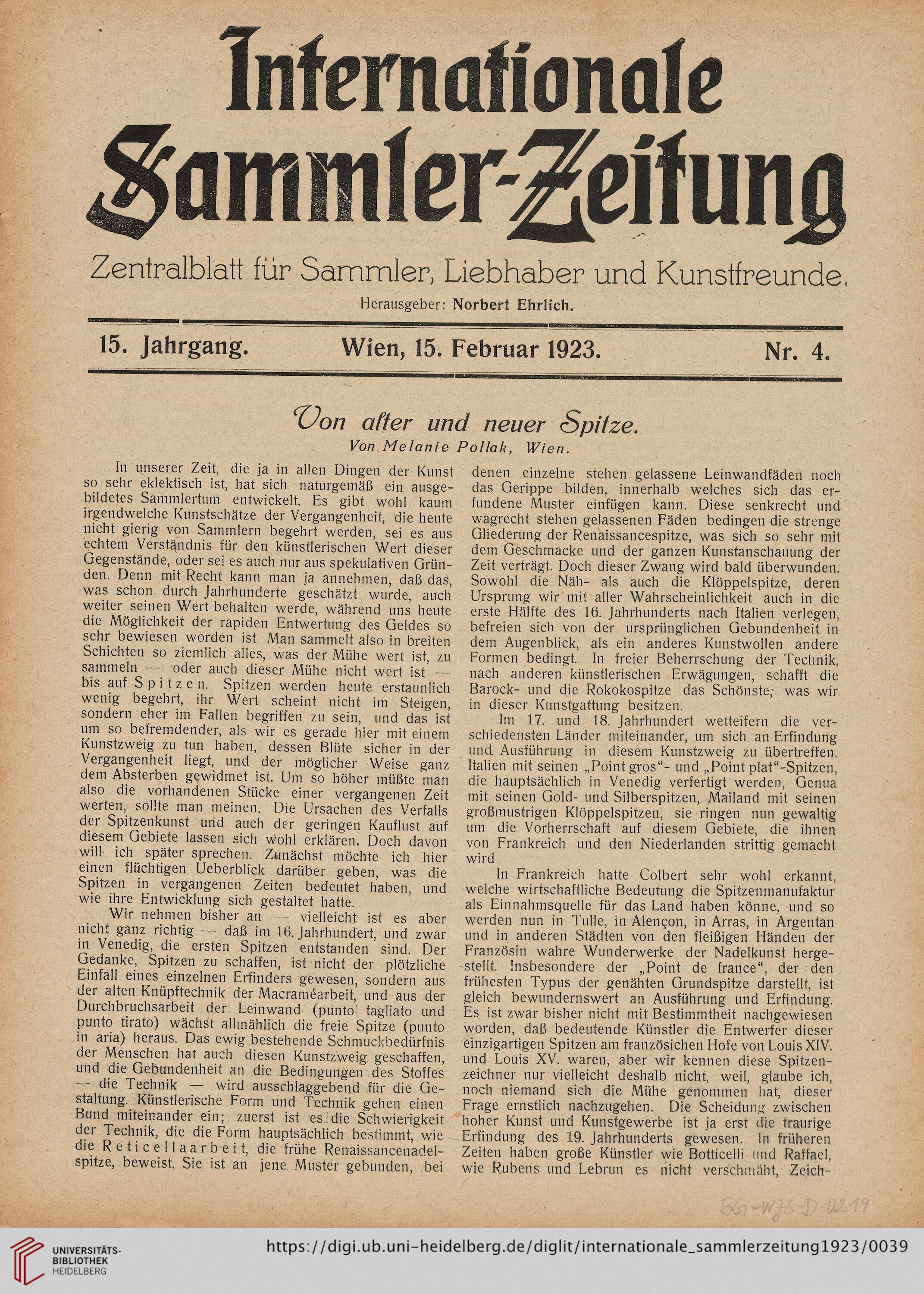15. Jahrgang.
Nr. 4.
Internationale
5'flinnilergeifuiifl
Zentralblatt für Sammler, Liebhaber und Kunstfreunde.
Herausgeber: Norbert Ehrlich.
Wien, 15. Februar 1923.
cOon atter und neuer Spitze.
Von Melanie Pollak, Wien.
In unserer Zeit, die ja in allen Dingen der Kunst
so sehr eklektisch ist, hat sich naturgemäß ein ausge-
bildetes Sammlertum entwickelt. Es gibt wohl kaum
irgendwelche Kunstschätze der Vergangenheit, die heute
nicht gierig von Sammlern begehrt werden, sei es aus
echtem Verständnis für den künstlerischen Wert dieser
Gegenstände, oder sei es auch nur aus spekulativen Grün-
den. Denn mit Recht kann man ja annehmen, daß das,
was schon durch Jahrhunderte geschätzt wurde, auch
weiter seinen Wert behalten werde, während uns heute
die Möglichkeit der rapiden Entwertung des Geldes so
sehr bewiesen worden ist Man sammelt also in breiten
Schichten so ziemlich alles, was der Mühe wert ist, zu
sammeln — oder auch dieser Mühe nicht wert ist —
bis auf Spitzen. Spitzen werden heute erstaunlich
wenig begehrt, ihr Wert scheint nicht im Steigen,
sondern eher im Fallen begriffen zu sein, und das ist
um so befremdender, als wir es gerade hier mit einem
Kunstzweig zu tun haben, dessen Blüte sicher in der
Vergangenheit liegt, und der möglicher Weise ganz
dem Absterben gewidmet ist. Um so höher müßte man
also die vorhandenen Stücke einer vergangenen Zeit
werten, sollte man meinen. Die Ursachen des Verfalls
der Spitzenkunst und auch der geringen Kauflust auf
diesem Gebiete lassen sich wohl erklären. Doch davon
will ich später sprechen. Zunächst möchte ich hier
einen flüchtigen Ueberblick darüber geben, was die
Spitzen in vergangenen Zeiten bedeutet haben, und
wie ihre Entwicklung sich gestaltet hatte.
Wir nehmen bisher an — vielleicht ist es aber
nicht ganz richtig — daß im 16. Jahrhundert, und zwar
in Venedig, die ersten Spitzen entstanden sind. Der
Gedanke, Spitzen zu schaffen, ist nicht der plötzliche
Einfall eines einzelnen Erfinders gewesen, sondern aus
der alten Knüpftechnik der Macramearbeit, und aus der
Durchbruchsarbeit der Leinwand (punto tagliato und
punto tirato) wächst allmählich die freie Spitze (punto
in aria) heraus. Das ewig bestehende Schmuckbedürfnis
der Menschen hat auch diesen Kunstzweig geschaffen,
und die Gebundenheit an die Bedingungen des Stoffes
— die Technik — wird ausschlaggebend für die Ge-
staltung. Künstlerische Form und Technik gehen einen
Bund miteinander ein; zuerst ist es die Schwierigkeit
der Technik, die die Form hauptsächlich bestimmt, wie
die R e t i c e 11 a a r b e i t, die frühe Renaissancenadel-
spitze, beweist. Sie ist an jene Muster gebunden, bei
denen einzelne stehen gelassene Leinwandfäden noch
das Gerippe bilden, innerhalb welches sich das er-
fundene Muster einfügen kann. Diese senkrecht und
wagrecht stehen gelassenen Fäden bedingen die strenge
Gliederung der Renaissancespitze, was sich so sehr mit
dem Geschmacke und der ganzen Kunstanschauung der
Zeit verträgt. Doch dieser Zwang wird bald überwunden.
Sowohl die Näh- als auch die Klöppelspitze, deren
Ursprung wir mit aller Wahrscheinlichkeit auch in die
erste Hälfte des 16. Jahrhunderts nach Italien verlegen,
befreien sich von der ursprünglichen Gebundenheit in
dem Augenblick, als ein anderes Kunstwollen andere
Formen bedingt. In freier Beherrschung der Technik,
nach anderen künstlerischen Erwägungen, schafft die
Barock- und die Rokokospitze das Schönste,- was wir
in dieser Kunstgattung besitzen.
Im 17. und 18. Jahrhundert wetteifern die ver-
schiedensten Länder miteinander, um sich an Erfindung
und Ausführung in diesem Kunstzweig zu übertreffen.
Italien mit seinen „Point gros“- und „Point plat“-Spitzen,
die hauptsächlich in Venedig verfertigt werden, Genua
mit seinen Gold- und Silberspitzen, Mailand mit seinen
großmustrigen Klöppelspitzen, sie ringen nun gewaltig
um die Vorherrschaft auf diesem Gebiete, die ihnen
von Frankreich und den Niederlanden strittig gemacht
wird
In Frankreich hatte Colbert sehr wohl erkannt,
welche wirtschaftliche Bedeutung die Spitzenmanufaktur
als Einnahmsquelle für das Land haben könne, und so
werden nun in Tülle, in Alengon, in Arras, in Argentan
und in anderen Städten von den fleißigen Händen der
Französin wahre Wunderwerke der Nadelkunst herge-
stellt. Insbesondere der „Point de france“, der den
frühesten Typus der genähten Grundspitze darstellt, ist
gleich bewundernswert an Ausführung und Erfindung.
Es ist zwar bisher nicht mit Bestimmtheit nachgewiesen
worden, daß bedeutende Künstler die Entwerfer dieser
einzigartigen Spitzen am französichen Hofe von Louis XIV.
und Louis XV. waren, aber wir kennen diese Spitzen-
zeichner nur vielleicht deshalb nicht, weil, glaube ich,
noch niemand sich die Mühe genommen hat, dieser
Frage ernstlich nachzugehen. Die Scheidung zwischen
hoher Kunst und Kunstgewerbe ist ja erst die traurige
Erfindung des 19. Jahrhunderts gewesen. In früheren
Zeiten haben große Künstler wie Botticelli und Raffael,
wie Rubens und Lebrun es nicht verschmäht, Zeich-
Nr. 4.
Internationale
5'flinnilergeifuiifl
Zentralblatt für Sammler, Liebhaber und Kunstfreunde.
Herausgeber: Norbert Ehrlich.
Wien, 15. Februar 1923.
cOon atter und neuer Spitze.
Von Melanie Pollak, Wien.
In unserer Zeit, die ja in allen Dingen der Kunst
so sehr eklektisch ist, hat sich naturgemäß ein ausge-
bildetes Sammlertum entwickelt. Es gibt wohl kaum
irgendwelche Kunstschätze der Vergangenheit, die heute
nicht gierig von Sammlern begehrt werden, sei es aus
echtem Verständnis für den künstlerischen Wert dieser
Gegenstände, oder sei es auch nur aus spekulativen Grün-
den. Denn mit Recht kann man ja annehmen, daß das,
was schon durch Jahrhunderte geschätzt wurde, auch
weiter seinen Wert behalten werde, während uns heute
die Möglichkeit der rapiden Entwertung des Geldes so
sehr bewiesen worden ist Man sammelt also in breiten
Schichten so ziemlich alles, was der Mühe wert ist, zu
sammeln — oder auch dieser Mühe nicht wert ist —
bis auf Spitzen. Spitzen werden heute erstaunlich
wenig begehrt, ihr Wert scheint nicht im Steigen,
sondern eher im Fallen begriffen zu sein, und das ist
um so befremdender, als wir es gerade hier mit einem
Kunstzweig zu tun haben, dessen Blüte sicher in der
Vergangenheit liegt, und der möglicher Weise ganz
dem Absterben gewidmet ist. Um so höher müßte man
also die vorhandenen Stücke einer vergangenen Zeit
werten, sollte man meinen. Die Ursachen des Verfalls
der Spitzenkunst und auch der geringen Kauflust auf
diesem Gebiete lassen sich wohl erklären. Doch davon
will ich später sprechen. Zunächst möchte ich hier
einen flüchtigen Ueberblick darüber geben, was die
Spitzen in vergangenen Zeiten bedeutet haben, und
wie ihre Entwicklung sich gestaltet hatte.
Wir nehmen bisher an — vielleicht ist es aber
nicht ganz richtig — daß im 16. Jahrhundert, und zwar
in Venedig, die ersten Spitzen entstanden sind. Der
Gedanke, Spitzen zu schaffen, ist nicht der plötzliche
Einfall eines einzelnen Erfinders gewesen, sondern aus
der alten Knüpftechnik der Macramearbeit, und aus der
Durchbruchsarbeit der Leinwand (punto tagliato und
punto tirato) wächst allmählich die freie Spitze (punto
in aria) heraus. Das ewig bestehende Schmuckbedürfnis
der Menschen hat auch diesen Kunstzweig geschaffen,
und die Gebundenheit an die Bedingungen des Stoffes
— die Technik — wird ausschlaggebend für die Ge-
staltung. Künstlerische Form und Technik gehen einen
Bund miteinander ein; zuerst ist es die Schwierigkeit
der Technik, die die Form hauptsächlich bestimmt, wie
die R e t i c e 11 a a r b e i t, die frühe Renaissancenadel-
spitze, beweist. Sie ist an jene Muster gebunden, bei
denen einzelne stehen gelassene Leinwandfäden noch
das Gerippe bilden, innerhalb welches sich das er-
fundene Muster einfügen kann. Diese senkrecht und
wagrecht stehen gelassenen Fäden bedingen die strenge
Gliederung der Renaissancespitze, was sich so sehr mit
dem Geschmacke und der ganzen Kunstanschauung der
Zeit verträgt. Doch dieser Zwang wird bald überwunden.
Sowohl die Näh- als auch die Klöppelspitze, deren
Ursprung wir mit aller Wahrscheinlichkeit auch in die
erste Hälfte des 16. Jahrhunderts nach Italien verlegen,
befreien sich von der ursprünglichen Gebundenheit in
dem Augenblick, als ein anderes Kunstwollen andere
Formen bedingt. In freier Beherrschung der Technik,
nach anderen künstlerischen Erwägungen, schafft die
Barock- und die Rokokospitze das Schönste,- was wir
in dieser Kunstgattung besitzen.
Im 17. und 18. Jahrhundert wetteifern die ver-
schiedensten Länder miteinander, um sich an Erfindung
und Ausführung in diesem Kunstzweig zu übertreffen.
Italien mit seinen „Point gros“- und „Point plat“-Spitzen,
die hauptsächlich in Venedig verfertigt werden, Genua
mit seinen Gold- und Silberspitzen, Mailand mit seinen
großmustrigen Klöppelspitzen, sie ringen nun gewaltig
um die Vorherrschaft auf diesem Gebiete, die ihnen
von Frankreich und den Niederlanden strittig gemacht
wird
In Frankreich hatte Colbert sehr wohl erkannt,
welche wirtschaftliche Bedeutung die Spitzenmanufaktur
als Einnahmsquelle für das Land haben könne, und so
werden nun in Tülle, in Alengon, in Arras, in Argentan
und in anderen Städten von den fleißigen Händen der
Französin wahre Wunderwerke der Nadelkunst herge-
stellt. Insbesondere der „Point de france“, der den
frühesten Typus der genähten Grundspitze darstellt, ist
gleich bewundernswert an Ausführung und Erfindung.
Es ist zwar bisher nicht mit Bestimmtheit nachgewiesen
worden, daß bedeutende Künstler die Entwerfer dieser
einzigartigen Spitzen am französichen Hofe von Louis XIV.
und Louis XV. waren, aber wir kennen diese Spitzen-
zeichner nur vielleicht deshalb nicht, weil, glaube ich,
noch niemand sich die Mühe genommen hat, dieser
Frage ernstlich nachzugehen. Die Scheidung zwischen
hoher Kunst und Kunstgewerbe ist ja erst die traurige
Erfindung des 19. Jahrhunderts gewesen. In früheren
Zeiten haben große Künstler wie Botticelli und Raffael,
wie Rubens und Lebrun es nicht verschmäht, Zeich-