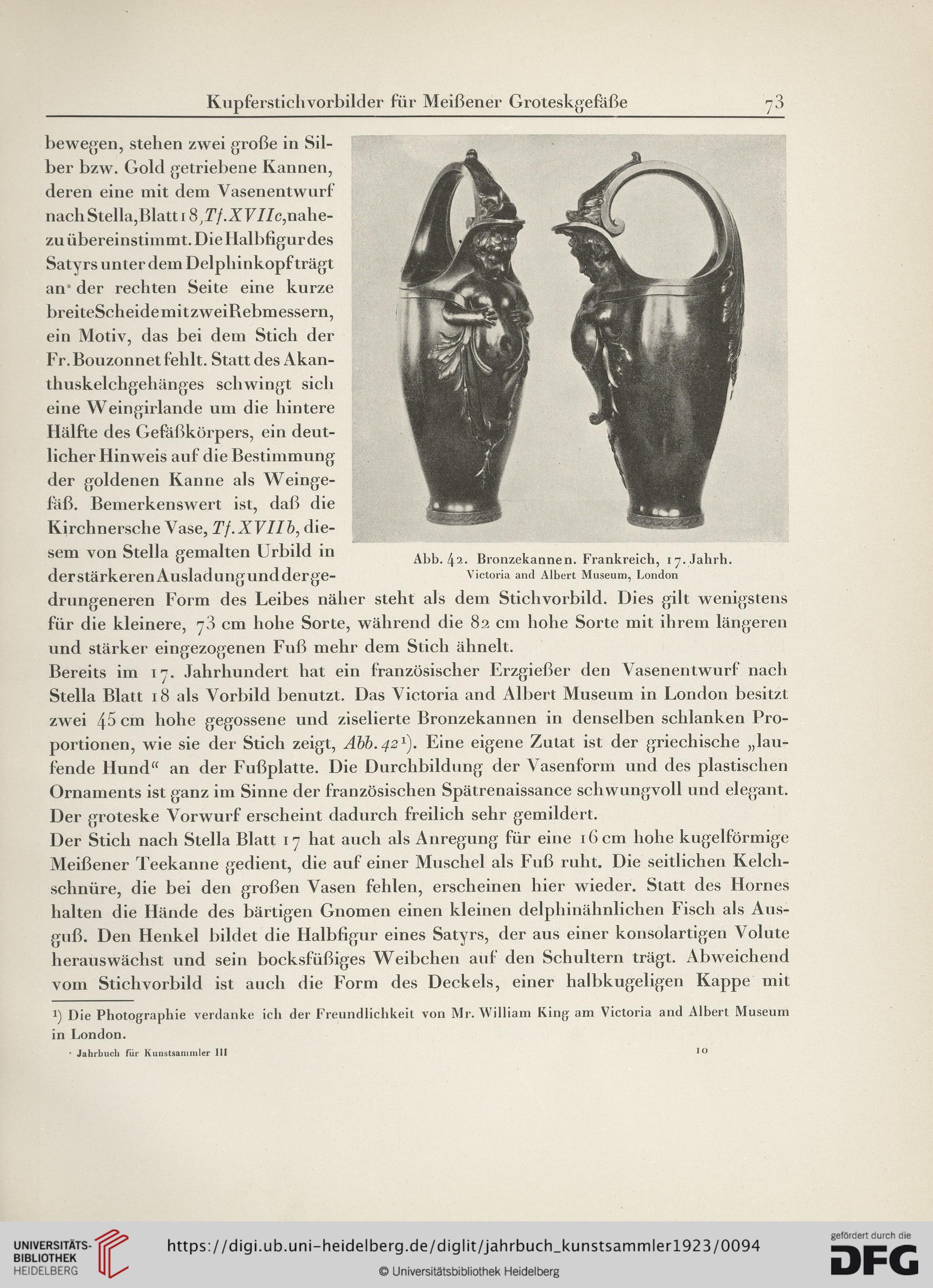Kupferstichvorbilder für Meißener Groteskgefäße
73
bewegen, stehen zwei große in Sil¬
ber bzw. Gold getriebene Kannen,
deren eine mit dem Vasenentwurf
nach Stella,Blatt 187T/.VFZZc,nahe¬
zu übereinstimmt. Die Halbfigur des
Satyrs unter dem Delpliinkopf trägt
an4 der rechten Seite eine kurze
breiteScheidemitzweiRebmessern,
ein Motiv, das bei dem Stich der
Fr. Bouzonnet fehlt. Statt des Akan-
thuskelchgehänges schwingt sich
eine Weingirlande um die hintere
Hälfte des Gefäßkörpers, ein deut¬
licher Hinweis auf die Bestimmung
der goldenen Kanne als Weinge¬
fäß. Bemerkenswert ist, daß die
Kirchnersche Vase, Tf.XVIIb^ die¬
sem von Stella gemalten Urbild in
der stärkeren Ausladungund derge-
drungeneren Form des Leibes näher steht als dem Stichvorbild. Dies gilt wenigstens
für die kleinere, 73 cm hohe Sorte, während die 82 cm hohe Sorte mit ihrem längeren
und stärker eingezogenen Fuß mehr dem Stich ähnelt.
Bereits im 17. Jahrhundert hat ein französischer Erzgießer den Vasenentwurf nach
Stella Blatt 18 als Vorbild benutzt. Das Victoria and Albert Museum in London besitzt
zwei 45 cm hohe gegossene und ziselierte Bronzekannen in denselben schlanken Pro-
portionen, wie sie der Stich zeigt, Abb. 42^. Eine eigene Zutat ist der griechische „lau-
fende Hund“ an der Fußplatte. Die Durchbildung der Vasenform und des plastischen
Ornaments ist ganz im Sinne der französischen Spätrenaissance schwungvoll und elegant.
Der groteske Vorwurf erscheint dadurch freilich sehr gemildert.
Der Stich nach Stella Blatt 17 hat auch als Anregung für eine 16 cm hohe kugelförmige
Meißener Teekanne gedient, die auf einer Muschel als Fuß ruht. Die seitlichen Kelch-
schnüre, die bei den großen Vasen fehlen, erscheinen hier wieder. Statt des Hornes
halten die Hände des bärtigen Gnomen einen kleinen delphinähnlichen Fisch als Aus-
guß. Den Henkel bildet die Halbfigur eines Satyrs, der aus einer konsolartigen Volute
herauswächst und sein bocksfüßiges Weibchen auf den Schultern trägt. Abweichend
vom Stichvorbild ist auch die Form des Deckels, einer halbkugeligen Kappe mit
1) Die Photographie verdanke ich der Freundlichkeit von Mr. William King am Victoria and Albert Museum
in London.
Abb. 42. Bronzekannen. Frankreich, iy. Jahrh.
Victoria and Albert Museum, London
• Jahrbuch für Kunstsammler III
IO
73
bewegen, stehen zwei große in Sil¬
ber bzw. Gold getriebene Kannen,
deren eine mit dem Vasenentwurf
nach Stella,Blatt 187T/.VFZZc,nahe¬
zu übereinstimmt. Die Halbfigur des
Satyrs unter dem Delpliinkopf trägt
an4 der rechten Seite eine kurze
breiteScheidemitzweiRebmessern,
ein Motiv, das bei dem Stich der
Fr. Bouzonnet fehlt. Statt des Akan-
thuskelchgehänges schwingt sich
eine Weingirlande um die hintere
Hälfte des Gefäßkörpers, ein deut¬
licher Hinweis auf die Bestimmung
der goldenen Kanne als Weinge¬
fäß. Bemerkenswert ist, daß die
Kirchnersche Vase, Tf.XVIIb^ die¬
sem von Stella gemalten Urbild in
der stärkeren Ausladungund derge-
drungeneren Form des Leibes näher steht als dem Stichvorbild. Dies gilt wenigstens
für die kleinere, 73 cm hohe Sorte, während die 82 cm hohe Sorte mit ihrem längeren
und stärker eingezogenen Fuß mehr dem Stich ähnelt.
Bereits im 17. Jahrhundert hat ein französischer Erzgießer den Vasenentwurf nach
Stella Blatt 18 als Vorbild benutzt. Das Victoria and Albert Museum in London besitzt
zwei 45 cm hohe gegossene und ziselierte Bronzekannen in denselben schlanken Pro-
portionen, wie sie der Stich zeigt, Abb. 42^. Eine eigene Zutat ist der griechische „lau-
fende Hund“ an der Fußplatte. Die Durchbildung der Vasenform und des plastischen
Ornaments ist ganz im Sinne der französischen Spätrenaissance schwungvoll und elegant.
Der groteske Vorwurf erscheint dadurch freilich sehr gemildert.
Der Stich nach Stella Blatt 17 hat auch als Anregung für eine 16 cm hohe kugelförmige
Meißener Teekanne gedient, die auf einer Muschel als Fuß ruht. Die seitlichen Kelch-
schnüre, die bei den großen Vasen fehlen, erscheinen hier wieder. Statt des Hornes
halten die Hände des bärtigen Gnomen einen kleinen delphinähnlichen Fisch als Aus-
guß. Den Henkel bildet die Halbfigur eines Satyrs, der aus einer konsolartigen Volute
herauswächst und sein bocksfüßiges Weibchen auf den Schultern trägt. Abweichend
vom Stichvorbild ist auch die Form des Deckels, einer halbkugeligen Kappe mit
1) Die Photographie verdanke ich der Freundlichkeit von Mr. William King am Victoria and Albert Museum
in London.
Abb. 42. Bronzekannen. Frankreich, iy. Jahrh.
Victoria and Albert Museum, London
• Jahrbuch für Kunstsammler III
IO