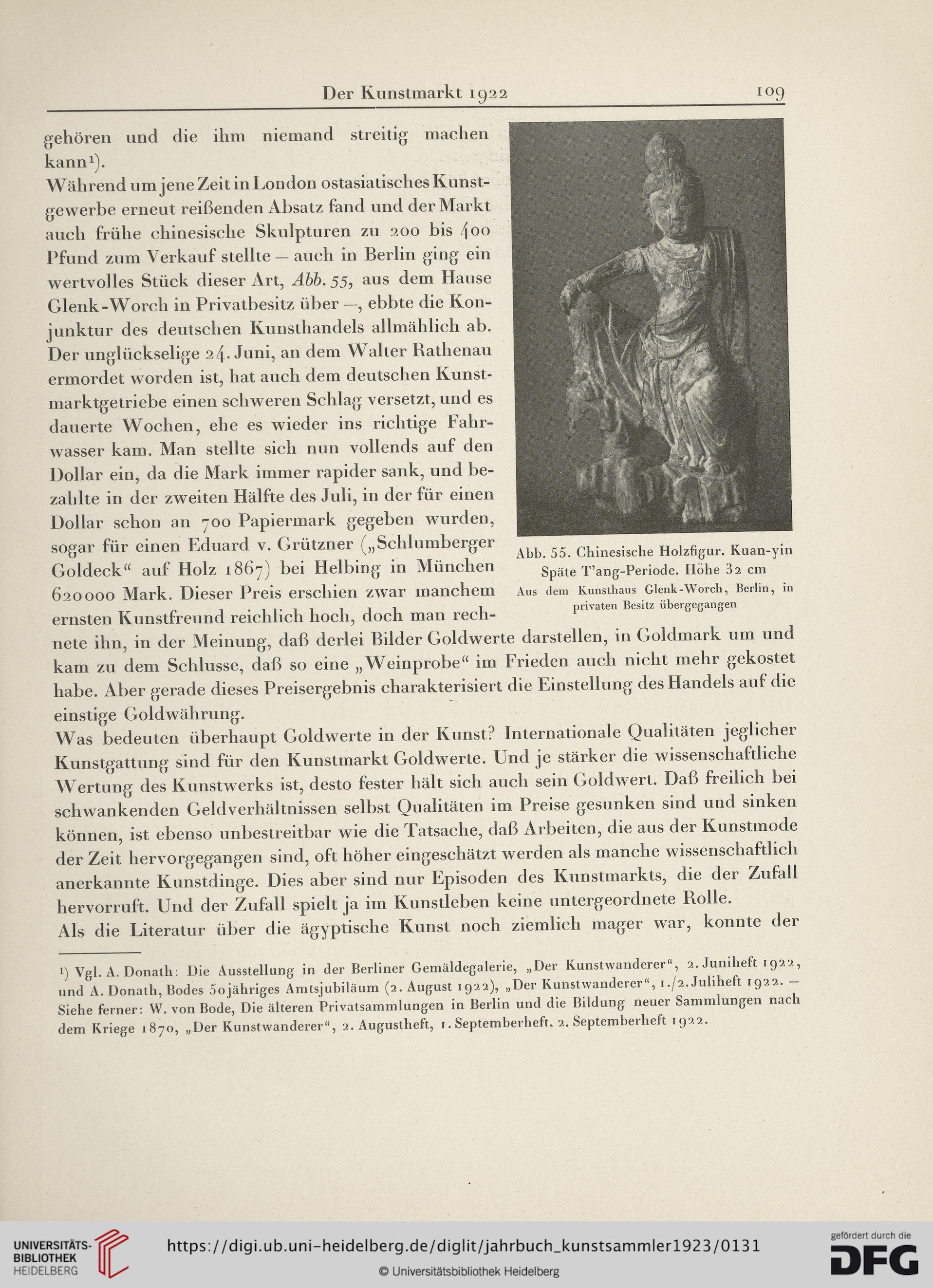Der Kunstmarkt 1922
109
gehören und die ihm niemand streitig machen
kann1).
Während um jene Zeit in London ostasiatisches Kunst¬
gewerbe erneut reißenden Absatz fand und der Markt
auch frühe chinesische Skulpturen zu 200 bis 4oo
Pfund zum Verkauf stellte — auch in Berlin ging ein
wertvolles Stück dieser Art, Abb. 55, aus dem Hause
Glenk-Worch in Privatbesitz über —, ebbte die Kon¬
junktur des deutschen Kunsthandels allmählich ab.
Der unglückselige 24. Juni, an dem Walter Rathenau
ermordet worden ist, hat auch dem deutschen Kunst¬
marktgetriebe einen schweren Schlag versetzt, und es
dauerte Wochen, ehe es wieder ins richtige Fahr¬
wasser kam. Man stellte sich nun vollends auf den
Dollar ein, da die Mark immer rapider sank, und be¬
zahlte in der zweiten Hälfte des Juli, in der für einen
Dollar schon an ’j'oo Papiermark gegeben wurden,
sogar für einen Eduard v. Grützner („Schlumberger
Goldeck“ auf Holz 1867) bei Helbing in München
620000 Mark. Dieser Preis erschien zwar manchem
ernsten Kunstfreund reichlich hoch, doch man rech-
nete ihn, in der Meinung, daß derlei Bilder Goldwerte darstellen, in Goldmark um und
kam zu dem Schlüsse, daß so eine „Weinprobe“ im Frieden auch nicht mehr gekostet
habe. Aber gerade dieses Preisergebnis charakterisiert die Einstellung des Handels auf die
einstige Goldwährung.
Was bedeuten überhaupt Goldwerte in der Kunst? Internationale Qualitäten jeglicher
Kunstgattung sind für den Kunstmarkt Goldwerte. Und je stärker die wissenschaftliche
Wertung des Kunstwerks ist, desto fester hält sich auch sein Goldwert. Daß freilich bei
schwankenden Geldverhältnissen selbst Qualitäten im Preise gesunken sind und sinken
können, ist ebenso unbestreitbar wie die Tatsache, daß Arbeiten, die aus der Kunstmode
der Zeit hervorgegangen sind, oft höher eingeschätzt werden als manche wissenschaftlich
anerkannte Kunstdinge. Dies aber sind nur Episoden des Kunstmarkts, die der Zufall
hervorruft. Und der Zufall spielt ja im Kunstleben keine untergeordnete Rolle.
Als die Literatur über die ägyptische Kunst noch ziemlich mager war, konnte der
Abb. 55. Chinesische Holzfigur. Kuan-yin
Späte T’ang-Periode. Höhe 32 cm
Aus dem Kunsthaus Glenk-Worch, Berlin, ir
privaten Besitz übergegangen
i) Vgl. A. Donath: Die Ausstellung in der Berliner Gemäldegalerie, „Der Kunstwanderer“, 2. Juniheft 1922,
und A. Donath, Bodes Sojähriges Amtsjubiläum (2. August 1922), „Der Kunstwanderer“, 1./2. Juliheft 1922. —
Siehe ferner: W. von Bode, Die älteren Privatsammlungen in Berlin und die Bildung neuer Sammlungen nach
dem Kriege 1870, „Der Kunstwanderer“, 2. Augustheft, 1. Septemberheft, 2. Septemberheft 1922.
109
gehören und die ihm niemand streitig machen
kann1).
Während um jene Zeit in London ostasiatisches Kunst¬
gewerbe erneut reißenden Absatz fand und der Markt
auch frühe chinesische Skulpturen zu 200 bis 4oo
Pfund zum Verkauf stellte — auch in Berlin ging ein
wertvolles Stück dieser Art, Abb. 55, aus dem Hause
Glenk-Worch in Privatbesitz über —, ebbte die Kon¬
junktur des deutschen Kunsthandels allmählich ab.
Der unglückselige 24. Juni, an dem Walter Rathenau
ermordet worden ist, hat auch dem deutschen Kunst¬
marktgetriebe einen schweren Schlag versetzt, und es
dauerte Wochen, ehe es wieder ins richtige Fahr¬
wasser kam. Man stellte sich nun vollends auf den
Dollar ein, da die Mark immer rapider sank, und be¬
zahlte in der zweiten Hälfte des Juli, in der für einen
Dollar schon an ’j'oo Papiermark gegeben wurden,
sogar für einen Eduard v. Grützner („Schlumberger
Goldeck“ auf Holz 1867) bei Helbing in München
620000 Mark. Dieser Preis erschien zwar manchem
ernsten Kunstfreund reichlich hoch, doch man rech-
nete ihn, in der Meinung, daß derlei Bilder Goldwerte darstellen, in Goldmark um und
kam zu dem Schlüsse, daß so eine „Weinprobe“ im Frieden auch nicht mehr gekostet
habe. Aber gerade dieses Preisergebnis charakterisiert die Einstellung des Handels auf die
einstige Goldwährung.
Was bedeuten überhaupt Goldwerte in der Kunst? Internationale Qualitäten jeglicher
Kunstgattung sind für den Kunstmarkt Goldwerte. Und je stärker die wissenschaftliche
Wertung des Kunstwerks ist, desto fester hält sich auch sein Goldwert. Daß freilich bei
schwankenden Geldverhältnissen selbst Qualitäten im Preise gesunken sind und sinken
können, ist ebenso unbestreitbar wie die Tatsache, daß Arbeiten, die aus der Kunstmode
der Zeit hervorgegangen sind, oft höher eingeschätzt werden als manche wissenschaftlich
anerkannte Kunstdinge. Dies aber sind nur Episoden des Kunstmarkts, die der Zufall
hervorruft. Und der Zufall spielt ja im Kunstleben keine untergeordnete Rolle.
Als die Literatur über die ägyptische Kunst noch ziemlich mager war, konnte der
Abb. 55. Chinesische Holzfigur. Kuan-yin
Späte T’ang-Periode. Höhe 32 cm
Aus dem Kunsthaus Glenk-Worch, Berlin, ir
privaten Besitz übergegangen
i) Vgl. A. Donath: Die Ausstellung in der Berliner Gemäldegalerie, „Der Kunstwanderer“, 2. Juniheft 1922,
und A. Donath, Bodes Sojähriges Amtsjubiläum (2. August 1922), „Der Kunstwanderer“, 1./2. Juliheft 1922. —
Siehe ferner: W. von Bode, Die älteren Privatsammlungen in Berlin und die Bildung neuer Sammlungen nach
dem Kriege 1870, „Der Kunstwanderer“, 2. Augustheft, 1. Septemberheft, 2. Septemberheft 1922.