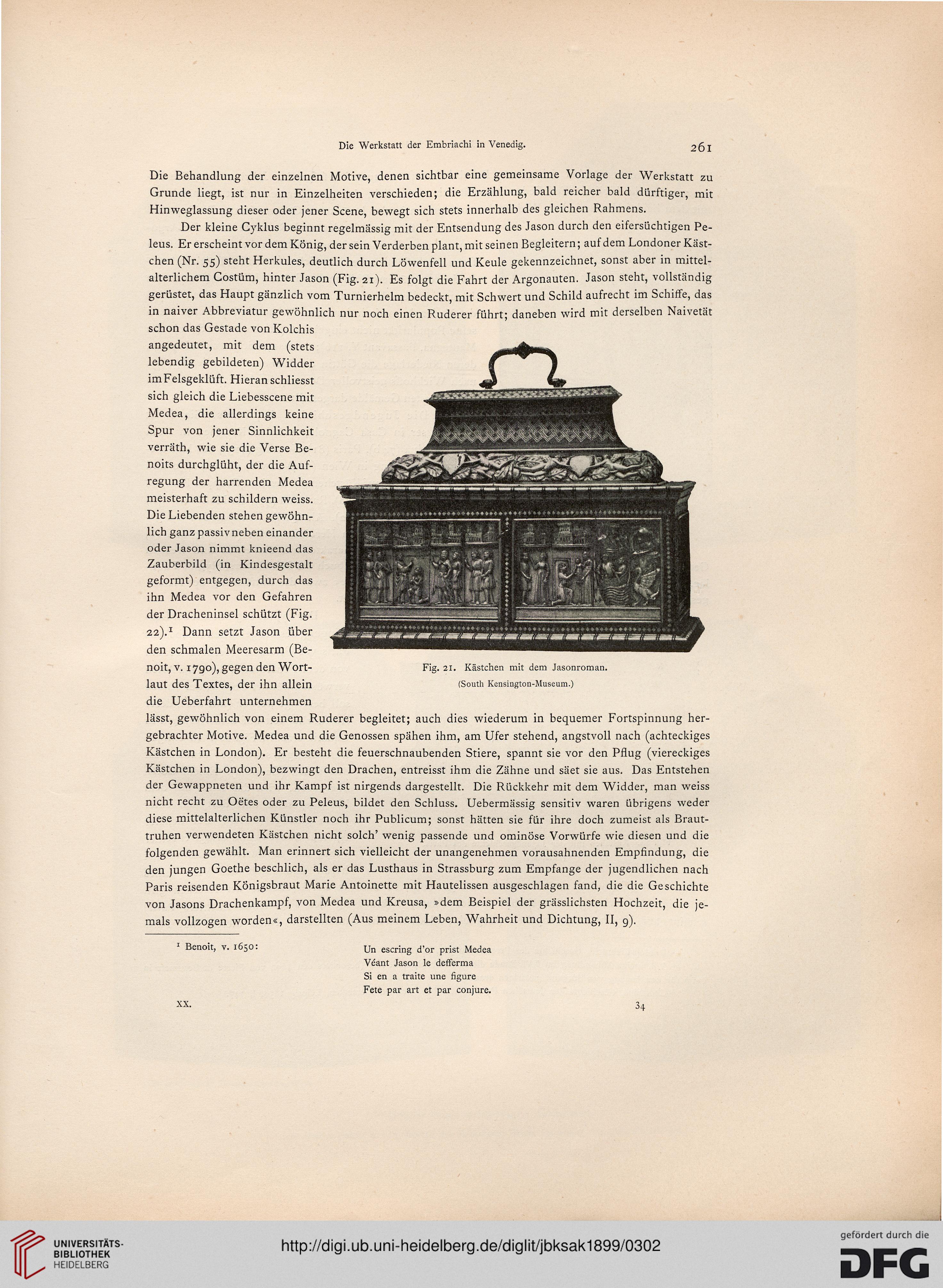Die Werkstatt der Embriachi in Venedig.
2ÖI
Die Behandlung der einzelnen Motive, denen sichtbar eine gemeinsame Vorlage der Werkstatt zu
Grunde liegt, ist nur in Einzelheiten verschieden; die Erzählung, bald reicher bald dürftiger, mit
Hinweglassung dieser oder jener Scene, bewegt sich stets innerhalb des gleichen Rahmens.
Der kleine Cyklus beginnt regelmässig mit der Entsendung des Jason durch den eifersüchtigen Pe-
leus. Er erscheint vor dem König, der sein Verderben plant, mit seinen Begleitern; auf dem Londoner Käst-
chen (Nr. 55) steht Herkules, deutlich durch Löwenfell und Keule gekennzeichnet, sonst aber in mittel-
alterlichem Costüm, hinter Jason (Fig. 21). Es folgt die Fahrt der Argonauten. Jason steht, vollständig
gerüstet, das Haupt gänzlich vom Turnierhelm bedeckt, mit Schwert und Schild aufrecht im Schiffe, das
in naiver Abbreviatur gewöhnlich nur noch einen Ruderer führt; daneben wird mit derselben Naivetät
schon das Gestade von Kolchis
angedeutet, mit dem (stets
lebendig gebildeten) Widder
imFelsgeklüft. Hieranschliesst
sich gleich die Liebesscene mit
Medea, die allerdings keine
Spur von jener Sinnlichkeit
verräth, wie sie die Verse Be-
noits durchglüht, der die Auf-
regung der harrenden Medea
meisterhaft zu schildern weiss.
Die Liebenden stehen gewöhn-
lich ganz passiv neben einander
oder Jason nimmt knieend das
Zauberbild (in Kindesgestalt
geformt) entgegen, durch das
ihn Medea vor den Gefahren
der Dracheninsel schützt (Fig.
22). * Dann setzt Jason über
den schmalen Meeresarm (Be-
noit, v. 1790), gegen den Wort-
laut des Textes, der ihn allein
die Ueberfahrt unternehmen
lässt, gewöhnlich von einem Ruderer begleitet; auch dies wiederum in bequemer Fortspinnung her-
gebrachter Motive. Medea und die Genossen spähen ihm, am Ufer stehend, angstvoll nach (achteckiges
Kästchen in London). Er besteht die feuerschnaubenden Stiere, spannt sie vor den Pflug (viereckiges
Kästchen in London), bezwingt den Drachen, entreisst ihm die Zähne und säet sie aus. Das Entstehen
der Gewappneten und ihr Kampf ist nirgends dargestellt. Die Rückkehr mit dem Widder, man weiss
nicht recht zu Oetes oder zu Peleus, bildet den Schluss. Uebermässig sensitiv waren übrigens weder
diese mittelalterlichen Künstler noch ihr Publicum; sonst hätten sie für ihre doch zumeist als Braut-
truhen verwendeten Kästchen nicht solch' wenig passende und ominöse Vorwürfe wie diesen und die
folgenden gewählt. Man erinnert sich vielleicht der unangenehmen vorausahnenden Empfindung, die
den jungen Goethe beschlich, als er das Lusthaus in Strassburg zum Empfange der jugendlichen nach
Paris reisenden Königsbraut Marie Antoinette mit Hautelissen ausgeschlagen fand, die die Geschichte
von Jasons Drachenkampf, von Medea und Kreusa, »dem Beispiel der grässlichsten Hochzeit, die je-
mals vollzogen worden«, darstellten (Aus meinem Leben, Wahrheit und Dichtung, II, 9).
Fig. 21. Kästchen mit dem Jasonroman.
(South Kensington-Museum.)
1 Benoit, v. 1650:
XX.
Un escring d'or prist Medea
Veant Jason le defferma
Si en a traite une figure
Fete par art et par conjure.
34
2ÖI
Die Behandlung der einzelnen Motive, denen sichtbar eine gemeinsame Vorlage der Werkstatt zu
Grunde liegt, ist nur in Einzelheiten verschieden; die Erzählung, bald reicher bald dürftiger, mit
Hinweglassung dieser oder jener Scene, bewegt sich stets innerhalb des gleichen Rahmens.
Der kleine Cyklus beginnt regelmässig mit der Entsendung des Jason durch den eifersüchtigen Pe-
leus. Er erscheint vor dem König, der sein Verderben plant, mit seinen Begleitern; auf dem Londoner Käst-
chen (Nr. 55) steht Herkules, deutlich durch Löwenfell und Keule gekennzeichnet, sonst aber in mittel-
alterlichem Costüm, hinter Jason (Fig. 21). Es folgt die Fahrt der Argonauten. Jason steht, vollständig
gerüstet, das Haupt gänzlich vom Turnierhelm bedeckt, mit Schwert und Schild aufrecht im Schiffe, das
in naiver Abbreviatur gewöhnlich nur noch einen Ruderer führt; daneben wird mit derselben Naivetät
schon das Gestade von Kolchis
angedeutet, mit dem (stets
lebendig gebildeten) Widder
imFelsgeklüft. Hieranschliesst
sich gleich die Liebesscene mit
Medea, die allerdings keine
Spur von jener Sinnlichkeit
verräth, wie sie die Verse Be-
noits durchglüht, der die Auf-
regung der harrenden Medea
meisterhaft zu schildern weiss.
Die Liebenden stehen gewöhn-
lich ganz passiv neben einander
oder Jason nimmt knieend das
Zauberbild (in Kindesgestalt
geformt) entgegen, durch das
ihn Medea vor den Gefahren
der Dracheninsel schützt (Fig.
22). * Dann setzt Jason über
den schmalen Meeresarm (Be-
noit, v. 1790), gegen den Wort-
laut des Textes, der ihn allein
die Ueberfahrt unternehmen
lässt, gewöhnlich von einem Ruderer begleitet; auch dies wiederum in bequemer Fortspinnung her-
gebrachter Motive. Medea und die Genossen spähen ihm, am Ufer stehend, angstvoll nach (achteckiges
Kästchen in London). Er besteht die feuerschnaubenden Stiere, spannt sie vor den Pflug (viereckiges
Kästchen in London), bezwingt den Drachen, entreisst ihm die Zähne und säet sie aus. Das Entstehen
der Gewappneten und ihr Kampf ist nirgends dargestellt. Die Rückkehr mit dem Widder, man weiss
nicht recht zu Oetes oder zu Peleus, bildet den Schluss. Uebermässig sensitiv waren übrigens weder
diese mittelalterlichen Künstler noch ihr Publicum; sonst hätten sie für ihre doch zumeist als Braut-
truhen verwendeten Kästchen nicht solch' wenig passende und ominöse Vorwürfe wie diesen und die
folgenden gewählt. Man erinnert sich vielleicht der unangenehmen vorausahnenden Empfindung, die
den jungen Goethe beschlich, als er das Lusthaus in Strassburg zum Empfange der jugendlichen nach
Paris reisenden Königsbraut Marie Antoinette mit Hautelissen ausgeschlagen fand, die die Geschichte
von Jasons Drachenkampf, von Medea und Kreusa, »dem Beispiel der grässlichsten Hochzeit, die je-
mals vollzogen worden«, darstellten (Aus meinem Leben, Wahrheit und Dichtung, II, 9).
Fig. 21. Kästchen mit dem Jasonroman.
(South Kensington-Museum.)
1 Benoit, v. 1650:
XX.
Un escring d'or prist Medea
Veant Jason le defferma
Si en a traite une figure
Fete par art et par conjure.
34