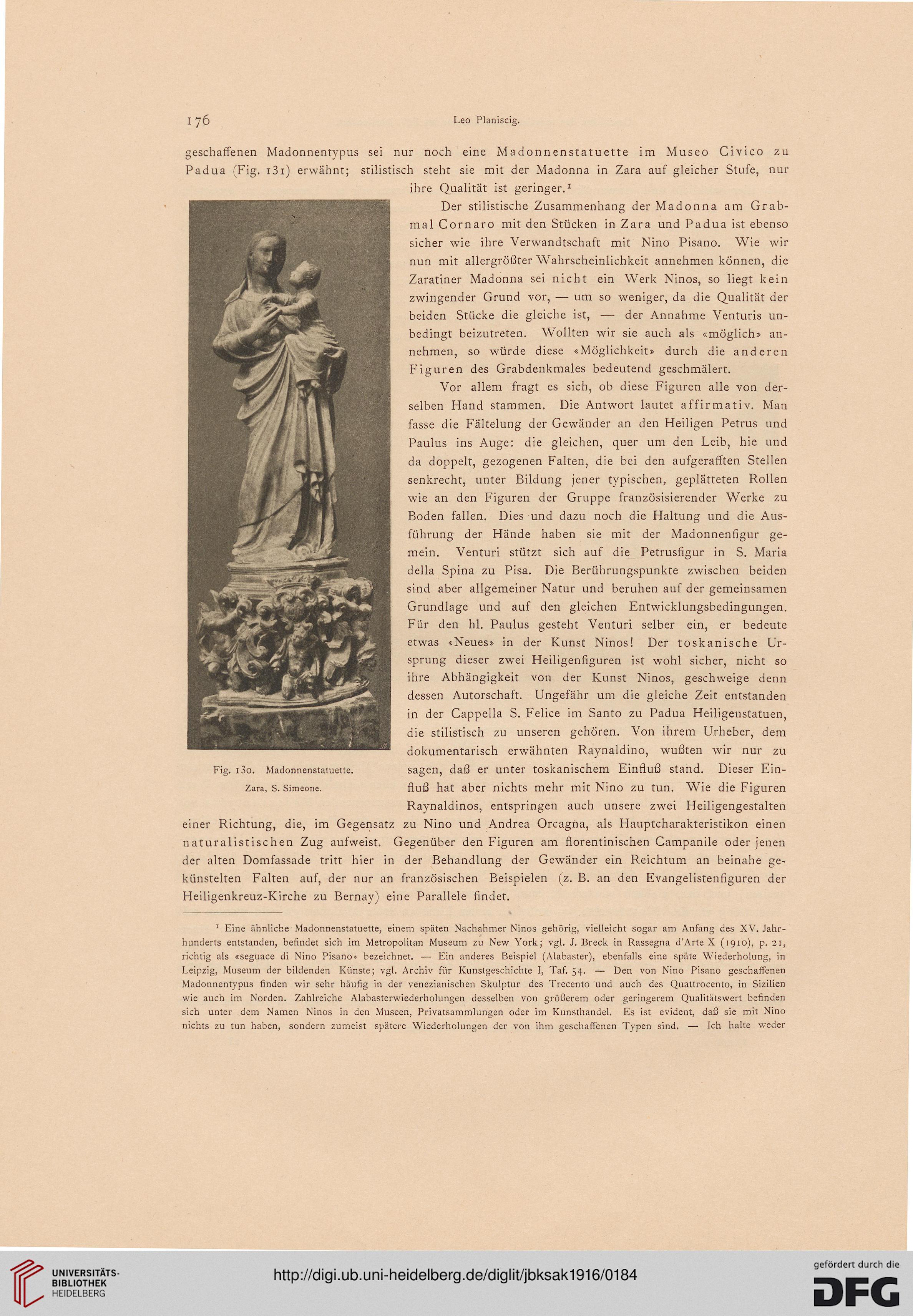Leo Planiscig.
geschaffenen Madonnentypus sei nur noch eine Madonnenstatuette im Museo Civico zu
Padua (Fig. i3i) erwähnt; stilistisch steht sie mit der Madonna in Zara auf gleicher Stufe, nur
ihre Qualität ist geringer.1
Der stilistische Zusammenhang der Madonna am Grab-
mal Cornaro mit den Stücken in Zara und Padua ist ebenso
sicher wie ihre Verwandtschaft mit Nino Pisano. Wie wir
nun mit allergrößter Wahrscheinlichkeit annehmen können, die
Zaratiner Madonna sei nicht ein Werk Ninos, so liegt kein
zwingender Grund vor, — um so weniger, da die Qualität der
beiden Stücke die gleiche ist, — der Annahme Venturis un-
bedingt beizutreten. Wollten wir sie auch als «möglich» an-
nehmen, so würde diese «Möglichkeit» durch die anderen
Figuren des Grabdenkmales bedeutend geschmälert.
Vor allem fragt es sich, ob diese Figuren alle von der-
selben Hand stammen. Die Antwort lautet affirmativ. Man
fasse die Fältelung der Gewänder an den Heiligen Petrus und
Paulus ins Auge: die gleichen, quer um den Leib, hie und
da doppelt, gezogenen Falten, die bei den aufgerafften Stellen
senkrecht, unter Bildung jener typischen, geplätteten Rollen
wie an den Figuren der Gruppe französisierender Werke zu
Boden fallen. Dies und dazu noch die Haltung und die Aus-
führung der Hände haben sie mit der Madonnenfigur ge-
mein. Venturi stützt sich auf die Petrusfigur in S. Maria
della Spina zu Pisa. Die Berührungspunkte zwischen beiden
sind aber allgemeiner Natur und beruhen auf der gemeinsamen
Grundlage und auf den gleichen Entwicklungsbedingungen.
Für den hl. Paulus gesteht Venturi selber ein, er bedeute
etwas «Neues» in der Kunst Ninos! Der toskanische Ur-
sprung dieser zwei Heiligenfiguren ist wohl sicher, nicht so
ihre Abhängigkeit von der Kunst Ninos, geschweige denn
dessen Autorschaft. Ungefähr um die gleiche Zeit entstanden
in der Cappella S. Feiice im Santo zu Padua Heiligenstatuen,
die stilistisch zu unseren gehören. Von ihrem Urheber, dem
dokumentarisch erwähnten Raynaldino, wußten wir nur zu
Fig. i3o. Madonnenstatuette. sagen, daß er unter toskanischem Einfluß stand. Dieser Ein-
Zara, s. Simeone. fluß hat aber nichts mehr mit Nino zu tun. Wie die Figuren
Raynaldinos, entspringen auch unsere zwei Heiligengestalten
einer Richtung, die, im Gegensatz zu Nino und Andrea Orcagna, als Hauptcharakteristikon einen
naturalistischen Zug aufweist. Gegenüber den Figuren am florentinischen Campanile oder jenen
der alten Domfassade tritt hier in der Behandlung der Gewänder ein Reichtum an beinahe ge-
künstelten Falten auf, der nur an französischen Beispielen (z. B. an den Evangelistenfiguren der
Heiligenkreuz-Kirche zu Bernay) eine Parallele findet.
1 Eine ähnliche Madonnenstatuette, einem späten Nachahmer Ninos gehörig, vielleicht sogar am Anfang des XV. Jahr-
hunderts entstanden, befindet sich im Metropolitan Museum zu New York; vgl. J. Breck in Rassegna d'Arte X (1910), p. 21,
richtig als «seguace di Nino Pisano» bezeichnet. — Ein anderes Beispiel (Alabaster), ebenfalls eine späte Wiederholung, in
Leipzig, Museum der bildenden Künste; vgl. Archiv für Kunstgeschichte I, Taf. 54. — Den von Nino Pisano geschaffenen
Madonnentypus finden wir sehr häufig in der venezianischen Skulptur des Trecento und auch des Quattrocento, in Sizilien
wie auch im Norden. Zahlreiche Alabasterwiederholungen desselben von größerem oder geringerem Qualitätswert befinden
sich unter dem Namen Ninos in den Museen, Privatsammlungen oder im Kunsthandel. Es ist evident, daß sie mit Nino
nichts zu tun haben, sondern zumeist spätere Wiederholungen der von ihm geschaffenen Typen sind. — Ich halte weder
geschaffenen Madonnentypus sei nur noch eine Madonnenstatuette im Museo Civico zu
Padua (Fig. i3i) erwähnt; stilistisch steht sie mit der Madonna in Zara auf gleicher Stufe, nur
ihre Qualität ist geringer.1
Der stilistische Zusammenhang der Madonna am Grab-
mal Cornaro mit den Stücken in Zara und Padua ist ebenso
sicher wie ihre Verwandtschaft mit Nino Pisano. Wie wir
nun mit allergrößter Wahrscheinlichkeit annehmen können, die
Zaratiner Madonna sei nicht ein Werk Ninos, so liegt kein
zwingender Grund vor, — um so weniger, da die Qualität der
beiden Stücke die gleiche ist, — der Annahme Venturis un-
bedingt beizutreten. Wollten wir sie auch als «möglich» an-
nehmen, so würde diese «Möglichkeit» durch die anderen
Figuren des Grabdenkmales bedeutend geschmälert.
Vor allem fragt es sich, ob diese Figuren alle von der-
selben Hand stammen. Die Antwort lautet affirmativ. Man
fasse die Fältelung der Gewänder an den Heiligen Petrus und
Paulus ins Auge: die gleichen, quer um den Leib, hie und
da doppelt, gezogenen Falten, die bei den aufgerafften Stellen
senkrecht, unter Bildung jener typischen, geplätteten Rollen
wie an den Figuren der Gruppe französisierender Werke zu
Boden fallen. Dies und dazu noch die Haltung und die Aus-
führung der Hände haben sie mit der Madonnenfigur ge-
mein. Venturi stützt sich auf die Petrusfigur in S. Maria
della Spina zu Pisa. Die Berührungspunkte zwischen beiden
sind aber allgemeiner Natur und beruhen auf der gemeinsamen
Grundlage und auf den gleichen Entwicklungsbedingungen.
Für den hl. Paulus gesteht Venturi selber ein, er bedeute
etwas «Neues» in der Kunst Ninos! Der toskanische Ur-
sprung dieser zwei Heiligenfiguren ist wohl sicher, nicht so
ihre Abhängigkeit von der Kunst Ninos, geschweige denn
dessen Autorschaft. Ungefähr um die gleiche Zeit entstanden
in der Cappella S. Feiice im Santo zu Padua Heiligenstatuen,
die stilistisch zu unseren gehören. Von ihrem Urheber, dem
dokumentarisch erwähnten Raynaldino, wußten wir nur zu
Fig. i3o. Madonnenstatuette. sagen, daß er unter toskanischem Einfluß stand. Dieser Ein-
Zara, s. Simeone. fluß hat aber nichts mehr mit Nino zu tun. Wie die Figuren
Raynaldinos, entspringen auch unsere zwei Heiligengestalten
einer Richtung, die, im Gegensatz zu Nino und Andrea Orcagna, als Hauptcharakteristikon einen
naturalistischen Zug aufweist. Gegenüber den Figuren am florentinischen Campanile oder jenen
der alten Domfassade tritt hier in der Behandlung der Gewänder ein Reichtum an beinahe ge-
künstelten Falten auf, der nur an französischen Beispielen (z. B. an den Evangelistenfiguren der
Heiligenkreuz-Kirche zu Bernay) eine Parallele findet.
1 Eine ähnliche Madonnenstatuette, einem späten Nachahmer Ninos gehörig, vielleicht sogar am Anfang des XV. Jahr-
hunderts entstanden, befindet sich im Metropolitan Museum zu New York; vgl. J. Breck in Rassegna d'Arte X (1910), p. 21,
richtig als «seguace di Nino Pisano» bezeichnet. — Ein anderes Beispiel (Alabaster), ebenfalls eine späte Wiederholung, in
Leipzig, Museum der bildenden Künste; vgl. Archiv für Kunstgeschichte I, Taf. 54. — Den von Nino Pisano geschaffenen
Madonnentypus finden wir sehr häufig in der venezianischen Skulptur des Trecento und auch des Quattrocento, in Sizilien
wie auch im Norden. Zahlreiche Alabasterwiederholungen desselben von größerem oder geringerem Qualitätswert befinden
sich unter dem Namen Ninos in den Museen, Privatsammlungen oder im Kunsthandel. Es ist evident, daß sie mit Nino
nichts zu tun haben, sondern zumeist spätere Wiederholungen der von ihm geschaffenen Typen sind. — Ich halte weder