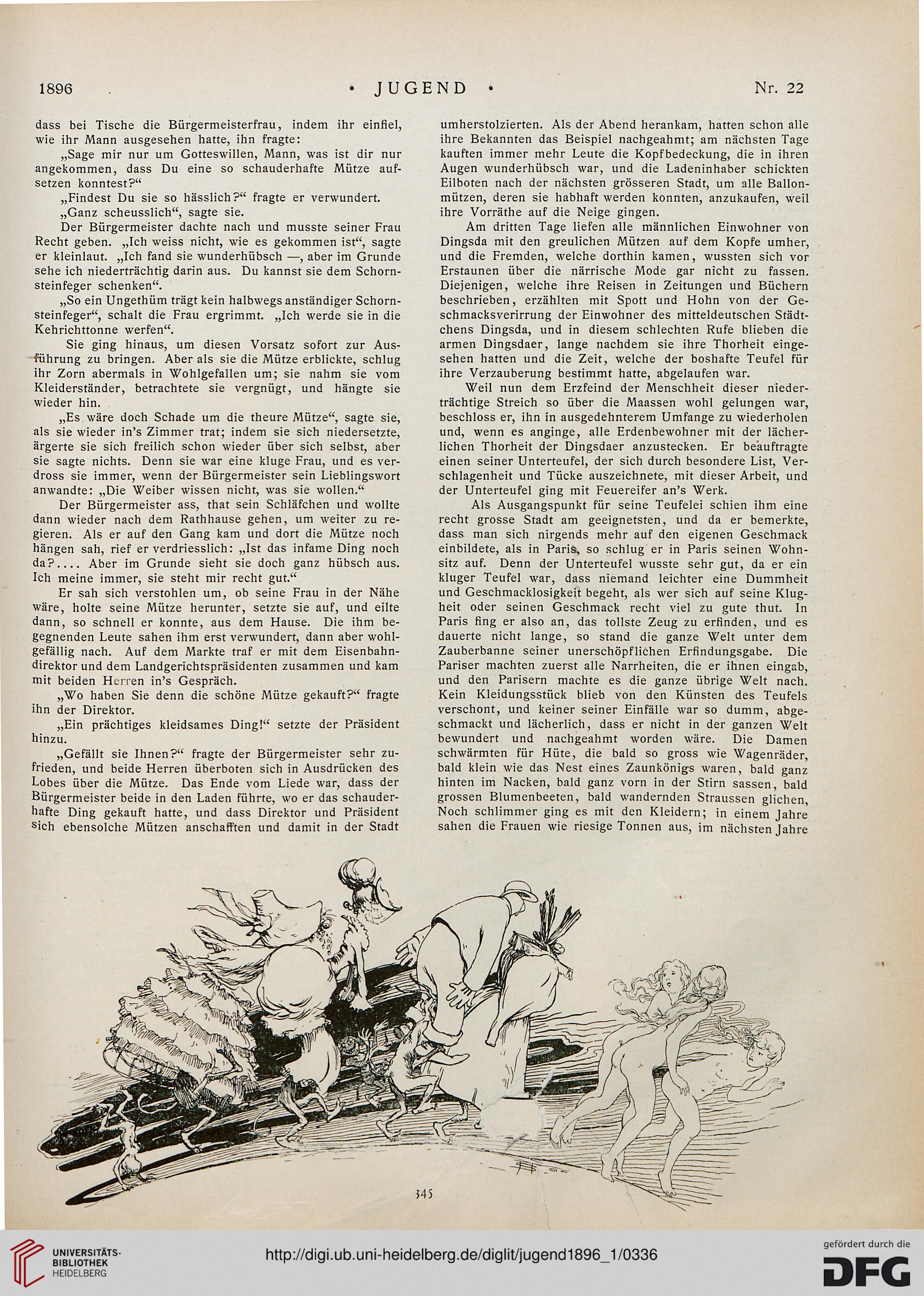1896
JUGEND
Nr. 22
dass bei Tische die Bürgermeisterfrau, indem ihr einfiel,
wie ihr Mann ausgesehen hatte, ihn fragte:
„Sage mir nur um Gotteswillen, Mann, was ist dir nur
angekommen, dass Du eine so schauderhafte Mütze auf-
setzen konntest?“
„Findest Du sie so hässlich?“ fragte er verwundert.
„Ganz scheusslich“, sagte sie.
Der Bürgermeister dachte nach und musste seiner Frau
Recht geben. „Ich weiss nicht, wie es gekommen ist“, sagte
er kleinlaut. „Ich fand sie wunderhübsch —, aber im Grunde
sehe ich niederträchtig darin aus. Du kannst sie dem Schorn-
steinfeger schenken“.
„So ein Ungethüm trägt kein halbwegs anständiger Schorn-
steinfeger“, schalt die Frau ergrimmt. „Ich werde sie in die
Kehrichttonne werfen“.
Sie ging hinaus, um diesen Vorsatz sofort zur Aus-
führung zu bringen. Aber als sie die Mütze erblickte, schlug
ihr Zorn abermals in Wohlgefallen um; sie nahm sie vom
Kleiderständer, betrachtete sie vergnügt, und hängte sie
wieder hin.
„Es wäre doch Schade um die theure Mütze“, sagte sie,
als sie wieder in’s Zimmer trat; indem sie sich niedersetzte,
ärgerte sie sich freilich schon wieder über sich selbst, aber
sie sagte nichts. Denn sie war eine kluge Frau, und es ver-
dross sie immer, wenn der Bürgermeister sein Lieblingswort
anwandte: „Die Weiber wissen nicht, was sie wollen.“
Der Bürgermeister ass, that sein Schläfchen und wollte
dann wieder nach dem Rathhause gehen, um weiter zu re-
gieren. Als er auf den Gang kam und dort die Mütze noch
hängen sah, rief er verdriesslich: „Ist das infame Ding noch
da?.... Aber im Grunde sieht sie doch ganz hübsch aus.
Ich meine immer, sie steht mir recht gut.“
Er sah sich verstohlen um, ob seine Frau in der Nähe
wäre, holte seine Mütze herunter, setzte sie auf, und eilte
dann, so schnell er konnte, aus dem Hause. Die ihm be-
gegnenden Leute sahen ihm erst verwundert, dann aber wohl-
gefällig nach. Auf dem Markte traf er mit dem Eisenbahn-
direktor und dem Landgerichtspräsidenten zusammen und kam
mit beiden Herren in’s Gespräch.
„Wo haben Sie denn die schöne Mütze gekauft?“ fragte
ihn der Direktor.
„Ein prächtiges kleidsames Ding!“ setzte der Präsident
hinzu.
„Gefällt sie Ihnen?“ fragte der Bürgermeister sehr zu-
frieden, und beide Herren überboten sich in Ausdrücken des
Lobes über die Mütze. Das Ende vom Liede war, dass der
Bürgermeister beide in den Laden führte, wo er das schauder-
hafte Ding gekauft hatte, und dass Direktor und Präsident
sich ebensolche Mützen anschafften und damit in der Stadt
umherstolzierten. Als der Abend herankam, hatten schon alle
ihre Bekannten das Beispiel nachgeahmt; am nächsten Tage
kauften immer mehr Leute die Kopfbedeckung, die in ihren
Augen wunderhübsch war, und die Ladeninhaber schickten
Eilboten nach der nächsten grösseren Stadt, um alle Ballon-
mützen, deren sie habhaft werden konnten, anzukaufen, weil
ihre Vorräthe auf die Neige gingen.
Am dritten Tage liefen alle männlichen Einwohner von
Dingsda mit den greulichen Mützen auf dem Kopfe umher,
und die Fremden, welche dorthin kamen, wussten sich vor
Erstaunen über die närrische Mode gar nicht zu fassen.
Diejenigen, welche ihre Reisen in Zeitungen und Büchern
beschrieben, erzählten mit Spott und Hohn von der Ge-
schmacksverirrung der Einwohner des mitteldeutschen Städt-
chens Dingsda, und in diesem schlechten Rufe blieben die
armen Dingsdaer, lange nachdem sie ihre Thorheit einge-
sehen hatten und die Zeit, welche der boshafte Teufel für
ihre Verzauberung bestimmt hatte, abgelaufen war.
Weil nun dem Erzfeind der Menschheit dieser nieder-
trächtige Streich so über die Maassen wohl gelungen war,
beschloss er, ihn in ausgedehnterem Umfange zu wiederholen
und, wenn es anginge, alle Erdenbewohner mit der lächer-
lichen Thorheit der Dingsdaer anzustecken. Er beauftragte
einen seiner Unterteufel, der sich durch besondere List, Ver-
schlagenheit und Tücke auszeichnete, mit dieser Arbeit, und
der Unterteufel ging mit Feuereifer an’s Werk.
Als Ausgangspunkt für seine Teufelei schien ihm eine
recht grosse Stadt am geeignetsten, und da er bemerkte,
dass man sich nirgends mehr auf den eigenen Geschmack
einbildete, als in Paris, so schlug er in Paris seinen Wohn-
sitz auf. Denn der Unterteufel wusste sehr gut, da er ein
kluger Teufel war, dass niemand leichter eine Dummheit
und Geschmacklosigkeit begeht, als wer sich auf seine Klug-
heit oder seinen Geschmack recht viel zu gute thut. In
Paris fing er also an, das tollste Zeug zu erfinden, und es
dauerte nicht lange, so stand die ganze Welt unter dem
Zauberbanne seiner unerschöpflichen Erfindungsgabe. Die
Pariser machten zuerst alle Narrheiten, die er ihnen eingab,
und den Parisern machte es die ganze übrige Welt nach.
Kein Kleidungsstück blieb von den Künsten des Teufels
verschont, und keiner seiner Einfälle war so dumm, abge-
schmackt und lächerlich, dass er nicht in der ganzen Welt
bewundert und nachgeahmt worden wäre. Die Damen
schwärmten für Hüte, die bald so gross wie Wagenräder,
bald klein wie das Nest eines Zaunkönigs waren, bald ganz
hinten im Nacken, bald ganz vorn in der Stirn sassen, bald
grossen Blumenbeeten, bald wandernden Straussen glichen,
Noch schlimmer ging es mit den Kleidern; in einem Jahre
sahen die Frauen wie riesige Tonnen aus, im nächsten Jahre
JUGEND
Nr. 22
dass bei Tische die Bürgermeisterfrau, indem ihr einfiel,
wie ihr Mann ausgesehen hatte, ihn fragte:
„Sage mir nur um Gotteswillen, Mann, was ist dir nur
angekommen, dass Du eine so schauderhafte Mütze auf-
setzen konntest?“
„Findest Du sie so hässlich?“ fragte er verwundert.
„Ganz scheusslich“, sagte sie.
Der Bürgermeister dachte nach und musste seiner Frau
Recht geben. „Ich weiss nicht, wie es gekommen ist“, sagte
er kleinlaut. „Ich fand sie wunderhübsch —, aber im Grunde
sehe ich niederträchtig darin aus. Du kannst sie dem Schorn-
steinfeger schenken“.
„So ein Ungethüm trägt kein halbwegs anständiger Schorn-
steinfeger“, schalt die Frau ergrimmt. „Ich werde sie in die
Kehrichttonne werfen“.
Sie ging hinaus, um diesen Vorsatz sofort zur Aus-
führung zu bringen. Aber als sie die Mütze erblickte, schlug
ihr Zorn abermals in Wohlgefallen um; sie nahm sie vom
Kleiderständer, betrachtete sie vergnügt, und hängte sie
wieder hin.
„Es wäre doch Schade um die theure Mütze“, sagte sie,
als sie wieder in’s Zimmer trat; indem sie sich niedersetzte,
ärgerte sie sich freilich schon wieder über sich selbst, aber
sie sagte nichts. Denn sie war eine kluge Frau, und es ver-
dross sie immer, wenn der Bürgermeister sein Lieblingswort
anwandte: „Die Weiber wissen nicht, was sie wollen.“
Der Bürgermeister ass, that sein Schläfchen und wollte
dann wieder nach dem Rathhause gehen, um weiter zu re-
gieren. Als er auf den Gang kam und dort die Mütze noch
hängen sah, rief er verdriesslich: „Ist das infame Ding noch
da?.... Aber im Grunde sieht sie doch ganz hübsch aus.
Ich meine immer, sie steht mir recht gut.“
Er sah sich verstohlen um, ob seine Frau in der Nähe
wäre, holte seine Mütze herunter, setzte sie auf, und eilte
dann, so schnell er konnte, aus dem Hause. Die ihm be-
gegnenden Leute sahen ihm erst verwundert, dann aber wohl-
gefällig nach. Auf dem Markte traf er mit dem Eisenbahn-
direktor und dem Landgerichtspräsidenten zusammen und kam
mit beiden Herren in’s Gespräch.
„Wo haben Sie denn die schöne Mütze gekauft?“ fragte
ihn der Direktor.
„Ein prächtiges kleidsames Ding!“ setzte der Präsident
hinzu.
„Gefällt sie Ihnen?“ fragte der Bürgermeister sehr zu-
frieden, und beide Herren überboten sich in Ausdrücken des
Lobes über die Mütze. Das Ende vom Liede war, dass der
Bürgermeister beide in den Laden führte, wo er das schauder-
hafte Ding gekauft hatte, und dass Direktor und Präsident
sich ebensolche Mützen anschafften und damit in der Stadt
umherstolzierten. Als der Abend herankam, hatten schon alle
ihre Bekannten das Beispiel nachgeahmt; am nächsten Tage
kauften immer mehr Leute die Kopfbedeckung, die in ihren
Augen wunderhübsch war, und die Ladeninhaber schickten
Eilboten nach der nächsten grösseren Stadt, um alle Ballon-
mützen, deren sie habhaft werden konnten, anzukaufen, weil
ihre Vorräthe auf die Neige gingen.
Am dritten Tage liefen alle männlichen Einwohner von
Dingsda mit den greulichen Mützen auf dem Kopfe umher,
und die Fremden, welche dorthin kamen, wussten sich vor
Erstaunen über die närrische Mode gar nicht zu fassen.
Diejenigen, welche ihre Reisen in Zeitungen und Büchern
beschrieben, erzählten mit Spott und Hohn von der Ge-
schmacksverirrung der Einwohner des mitteldeutschen Städt-
chens Dingsda, und in diesem schlechten Rufe blieben die
armen Dingsdaer, lange nachdem sie ihre Thorheit einge-
sehen hatten und die Zeit, welche der boshafte Teufel für
ihre Verzauberung bestimmt hatte, abgelaufen war.
Weil nun dem Erzfeind der Menschheit dieser nieder-
trächtige Streich so über die Maassen wohl gelungen war,
beschloss er, ihn in ausgedehnterem Umfange zu wiederholen
und, wenn es anginge, alle Erdenbewohner mit der lächer-
lichen Thorheit der Dingsdaer anzustecken. Er beauftragte
einen seiner Unterteufel, der sich durch besondere List, Ver-
schlagenheit und Tücke auszeichnete, mit dieser Arbeit, und
der Unterteufel ging mit Feuereifer an’s Werk.
Als Ausgangspunkt für seine Teufelei schien ihm eine
recht grosse Stadt am geeignetsten, und da er bemerkte,
dass man sich nirgends mehr auf den eigenen Geschmack
einbildete, als in Paris, so schlug er in Paris seinen Wohn-
sitz auf. Denn der Unterteufel wusste sehr gut, da er ein
kluger Teufel war, dass niemand leichter eine Dummheit
und Geschmacklosigkeit begeht, als wer sich auf seine Klug-
heit oder seinen Geschmack recht viel zu gute thut. In
Paris fing er also an, das tollste Zeug zu erfinden, und es
dauerte nicht lange, so stand die ganze Welt unter dem
Zauberbanne seiner unerschöpflichen Erfindungsgabe. Die
Pariser machten zuerst alle Narrheiten, die er ihnen eingab,
und den Parisern machte es die ganze übrige Welt nach.
Kein Kleidungsstück blieb von den Künsten des Teufels
verschont, und keiner seiner Einfälle war so dumm, abge-
schmackt und lächerlich, dass er nicht in der ganzen Welt
bewundert und nachgeahmt worden wäre. Die Damen
schwärmten für Hüte, die bald so gross wie Wagenräder,
bald klein wie das Nest eines Zaunkönigs waren, bald ganz
hinten im Nacken, bald ganz vorn in der Stirn sassen, bald
grossen Blumenbeeten, bald wandernden Straussen glichen,
Noch schlimmer ging es mit den Kleidern; in einem Jahre
sahen die Frauen wie riesige Tonnen aus, im nächsten Jahre